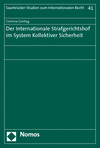Der Internationale Strafgerichtshof im System Kollektiver Sicherheit
Zusammenfassung
Die Autorin untersucht die völkerrechtliche Umsetzung der Überzeugung der Staatengemeinschaft, dass Grundlage der kollektiven Sicherheit das Vertrauen auf die friedensbringende Kraft von Recht und Gerechtigkeit ist, die in der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes seine konsequente Ausbildung erfährt.
Dabei liegt ein zentraler Punkt der Arbeit in der Gegenüberstellung der weitreichenden Befugnisse des Exekutivorgans Sicherheitsrat der United Nations – des Systems Kollektiver Sicherheit heutiger Zeit – und der Unabhängigkeit des Strafgerichtshofes. Die Spannung zwischen beiden Institutionen, die sich aus dem Einfluss der Politik auf die Arbeit des Rechts ergibt, muss im Sinne der komplementären Ziele zwischen Frieden und Gerechtigkeit beider aufgelöst werden. Dies ist im Rom-Statut berücksichtigt worden.
So liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf den Art. 13 und 16 des Rom-Statuts und in den möglichen Einflüssen auf den Aggressionstatbestand, die analysiert und in den Kontext ihrer jeweiligen kurz- und langfristigen Ziele gesetzt werden.
- 2–14 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–14
- 15–16 Abkürzungsverzeichnis 15–16
- 17–20 Einleitung 17–20
- 21–43 Kapitel 1 Das System Kollektiver Sicherheit 21–43
- 21–28 I. Grundlagen 21–28
- 21–23 1. Die Theorie: Penn und Kant 21–23
- a) William Penn
- b) Immanuel Kant
- 23–28 2. Die Praxis: Bündnisse und Allianzen 23–28
- a) Die Heilige Allianz
- b) Der Völkerbund
- c) Der Briand – Kellogg Pakt
- 28–38 II. Inhalt 28–38
- 28–32 1. Das Gewaltverbot 28–32
- a) Entwicklung
- b) Inhalt
- c) Ausnahmen
- d) Bewertung
- 32–34 2. Frieden 32–34
- a) Negativer, enger Friedensbegriff
- b) Positiver, weiter Friedensbegriff
- 34–36 3. Das System Kollektiver Sicherheit 34–36
- 36–38 4. Die Sicherung der Sicherheit 36–38
- a) Durch Machtkonzentration: Ein zentrales Organ
- b) Durch das Recht: Die friedliche Streitbeilegung
- 38–43 III. Die Umsetzung: die United Nations 38–43
- 38–41 1. Ziele und Grundsätze 38–41
- a) Ziele, Art. 1 UN Charta
- b) Der Friedensbegriff der UN Charta
- c) Grundsätze, Art. 2 UN Charta
- 41–43 2. Organe 41–43
- a) Generalversammlung
- b) Sicherheitsrat
- c) Internationaler Gerichtshof
- 43–43 IV. Ergebnis 43–43
- 44–66 Kapitel 2 Die internationale Strafgerichtsbarkeit 44–66
- 44–49 I. Grundlagen 44–49
- 44–45 1. Die Anfänge in Völkerbund und United Nations 44–45
- 45–47 2. Der Beitrag des Sicherheitsrates der UN 45–47
- 47–49 3. Ein ständiger Internationaler Strafgerichtshof 47–49
- 49–66 II. Der Internationale Strafgerichtshof 49–66
- 49–53 1. Ziel und Zweck 49–53
- a) Die Präambel des Rom – Statutes: Gerechtigkeit
- b) Was ist Gerechtigkeit?
- aa) Gerechtigkeit als Konzept
- bb) Gerechtigkeit, um Frieden zu wahren
- 53–55 2. Struktur 53–55
- 55–56 3. Anwendbares Recht 55–56
- 56–57 4. Komplementarität 56–57
- 57–58 5. Zulässigkeit 57–58
- 58–60 6. Zuständigkeiten 58–60
- a) in zeitlicher Hinsicht
- b) in sachlicher Hinsicht
- c) in persönlicher und örtlicher Hinsicht
- d) Ausnahmen
- 60–63 7. Das Verfahren 60–63
- a) Die Verfahrenseinleitung
- b) Das Ermittlungsverfahren
- c) Das Hauptverfahren und das Rechtsmittelverfahren
- 63–64 8. Internationale Zusammenarbeit und Rechtshilfe 63–64
- 64–66 9. Das Relationship Agreement 64–66
- 67–99 Kapitel 3 Der Sicherheitsrat 67–99
- 67–70 I. Die Aufgaben des Sicherheitsrates 67–70
- 67–69 1. Frieden als Aufgabe des Sicherheitsrates 67–69
- 69–70 2. Sonstige Aufgaben 69–70
- 70–78 II. Befugnisse des Sicherheitsrates zur Wahrung des Weltfriedens 70–78
- 70–71 1. Die friedliche Beilegung von Streitigkeiten 70–71
- 71–75 2. Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen 71–75
- a) Voraussetzung: Art. 39 UN Charta
- b) Art. 40 UN Charta
- c) Art. 41 UN Charta
- d) Art. 42 UN Charta
- 75–77 3. Weitere besondere Befugnisse 75–77
- a) Legislative und judikative Kompetenzen
- b) Sonstige Kompetenzen
- 77–78 4. Ergebnis 77–78
- 78–89 III. Grenzen der Befugnisse 78–89
- 78–83 1. Aus dem Text der UN Charta 78–83
- a) Art. 1 – Ziele
- aa) Grundsätze der Gerechtigkeit und des Völkerrechts
- bb) Die Menschenrechte
- b) Art. 2 – Grundsätze
- 83–85 2. Aus dem Internationalen Vertragsrecht 83–85
- a) Grundsätzlich: Völkerrechtliche Verträge der Mitgliedsstaaten
- b) Ausnahme: Internationale Verträge zur Begründung eines Internationalen Gerichtes?
- 85–88 3. Aus dem allgemeinen Völkerrecht 85–88
- a) Ius cogens und Völkergewohnheitsrecht
- b) Prinzip der Verhältnismäßigkeit
- c) Treu und Glauben
- 88–89 4. Ergebnis 88–89
- 89–99 IV. Überprüfbarkeit von Resolutionen des Sicherheitsrates und rechtliche Folgen von Handlungen ultra vires 89–99
- 89–95 1. Überprüfbarkeit durch den Internationalen Gerichtshof 89–95
- a) Die direkte Überprüfbarkeit
- b) Die indirekte Überprüfbarkeit
- c) Das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof als Friedensbedrohung?
- 95–95 2. Überprüfbarkeit durch andere internationale Gerichte 95–95
- 95–98 3. Die rechtlichen Folgen von Handlungen ultra vires 95–98
- a) Aufhebung durch den Internationalen Gerichtshof
- b) Nichtbefolgung durch die Mitgliedsstaaten
- c) Automatische Nichtigkeit
- d) Gültigkeit
- 98–99 4. Ergebnis 98–99
- 100–137 Kapitel 4 Die Verweisung nach Art. 13 b) durch den Sicherheitsrat 100–137
- 100–104 I. Grundlagen 100–104
- 100–102 1. Art. 23 I ILC Draft Statute for an International Criminal Court 100–102
- 102–104 2. Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court 102–104
- 104–104 3. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court 104–104
- 104–127 II. Art. 13 b) Rom – Statut 104–127
- 104–109 1. Voraussetzungen der UN Charta 104–109
- a) Befugnis zur Verweisung aus Kapitel VII
- b) Befugnis zur Verweisung aus Kapitel VI
- aa) Anwendbarkeit von Kapitel VI nur auf zwischenstaatliche Streitigkeiten
- bb) Einmischung in innere Angelegenheiten, Art. 2 Nr. 7 UN Charta
- cc) Ergebnis
- 109–110 2. Verweisung auch ohne Referenznorm möglich? 109–110
- 110–117 3. Voraussetzungen 110–117
- a) Begriff und Inhalt der „Situation“
- b) Eine Resolution nach Kapitel VII UN Charta
- aa) Eine Feststellung nach Art. 39 UN Charta
- bb) Eine gültige Abstimmung nach Art. 27 III UN Charta
- cc) Die im Einklang mit den Zielen der UN steht
- dd) Die Art. 41 UN Charta einhält
- c) Die dem Ankläger unterbreitet wird
- aa) Art. 17 Relationship Agreement
- bb) Programmatische Richtlinien der Anklagebehörde
- 117–124 4. Besonderheiten des Verfahrens 117–124
- a) Bei der Zuständigkeit
- aa) in sachlicher, persönlicher und örtlicher Hinsicht
- bb) in zeitlicher Hinsicht
- b) Bei der Zulässigkeit
- aa) nach Art. 17 Rom – Statut
- bb) nach Art. 18 I Rom – Statut
- c) Einfluß auf die Arbeit des Anklägers
- 124–125 5. Die Kompetenz des Sicherheitsrates weiterhin ad hoc Tribunale zu errichten 124–125
- 125–125 6. Auswirkungen der Verweisung des Sicherheitsrates auf (Nicht-)Mitgliedsstaaten der UN 125–125
- 125–127 7. Auswirkungen auf die Kooperation der Staaten mit dem Strafgerichtshof 125–127
- 127–131 III. Die gerichtliche Überprüfbarkeit der Sicherheitsratsresolution 127–131
- 127–128 1. Durch den Internationalen Strafgerichtshof 127–128
- 128–129 2. Konkurrierende Zuständigkeit des IGH? 128–129
- 129–130 3. Anwendbares Recht und Prüfungsumfang 129–130
- a) Anwendbares Recht
- b) Überprüfung nur formal oder auch inhaltlich?
- 130–131 4. Konkret: zu überprüfende Elemente der Sicherheitsratsresolution 130–131
- 131–135 IV. Die Verweisung nach Resolution 1593 (2005) 131–135
- 1. Das Verfahren
- a) Ausübung der Gerichtsbarkeit
- b) Zuständigkeit
- c) Zulässigkeit
- 135–135 2. Das Verfahren bis heute 135–135
- 135–137 V. Ergebnis 135–137
- 138–183 Kapitel 5 Der Aufschub von Ermittlungen und Strafverfolgung nach Art. 16 durch den Sicherheitsrat 138–183
- 138–142 I. Grundlagen 138–142
- 138–140 1. Art. 23 III ILC Draft Statute for an International Criminal Court 138–140
- 140–142 2. Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court 140–142
- 142–142 3. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court 142–142
- 142–162 II. Art. 16 Rom – Statut 142–162
- 142–144 1. Die Befugnis des Sicherheitsrates aus der UN Charta 142–144
- 144–145 2. Aufschub auch ohne Referenznorm möglich? 144–145
- 145–156 3. Die Voraussetzungen 145–156
- a) Eine Resolution nach Kapitel VII der UN Charta
- aa) Eine Feststellung nach Art. 39 UN Charta
- bb) Eine gültige Abstimmung nach Art. 27 III UN Charta
- cc) Im Einklang mit den Zielen der UN
- dd) Rechtsfolge: Art. 41 UN Charta
- b) Anwendungsbereich: Ermittlungsverfahren und Strafverfolgungen
- aa) Teil 5 oder auch Teile 6 und 8 des Rom – Statuts?
- bb) Vollständige oder nur fallbezogene Aussetzung?
- c) Das Ersuchen
- aa) Der Begriff des Ersuchens
- bb) Problem der Informationsbeschaffung
- d) An den Gerichtshof
- aa) Der Begriff Gerichtshof
- bb) Die Entscheidungsbefugnis
- e) Für einen Zeitraum von 12 Monaten
- 156–158 4. Die Rechtsfolgen 156–158
- a) Einstellung von Ermittlungen
- b) Einstellung von Strafverfolgungen
- 158–161 5. Probleme der Aussetzung 158–161
- a) Vereinbarkeit mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
- b) Reaktion betroffener Mitgliedsstaaten und Drittstaaten
- c) Informationsbeschränkungen zwischen Gerichtshof und Sicherheitsrat
- 161–162 6. Ergebnis 161–162
- 162–163 III. Die gerichtliche Überprüfbarkeit der Sicherheitsratsresolution 162–163
- 163–182 IV. Resolutionen 1422 (2002) und 1487 (2003) 163–182
- 163–165 1. Hintergrund 163–165
- 165–166 2. Die Resolutionen im Wortlaut 165–166
- 166–173 3. Vereinbarkeit mit der UN Charta 166–173
- a) formale Voraussetzungen
- b) materielle Voraussetzungen
- c) Achtung der Grundsätze Verhältnismäßigkeit und Treu und Glauben
- d) Vertragsänderung des Rom – Statutes durch den Sicherheitsrat?
- e) Art. 41 UN Charta
- 173–174 4. Automatische Verlängerung und Übergang ins Völkergewohnheitsrecht? 173–174
- a) Automatische Verlängerung
- b) Übergang des Resolutionsinhaltes ins Völkergewohnheitsrecht?
- 174–181 5. Vereinbarkeit mit dem Rom – Statut 174–181
- a) Resolution nach Kapitel VII
- b) Das Ersuchen an den Gerichtshof
- c) Der Anwendungsbereich
- aa) Zukünftige und abstrakte Ermittlungen und Strafverfolgungen?
- bb) Die pauschale Herausnahme von Personengruppen?
- cc) Ehemalige Amtsträger und Bedienstete?
- dd) Insbesondere Personal von UN Einsätzen?
- d) Rückfall zu den überkommenen Verhältnissen des Art. 23 III ILC Draft von 1994?
- 181–182 6. Ergebnis 181–182
- 182–183 V. Rechtliche Konsequenzen der Rechtswidrigkeit 182–183
- 183–183 VI. Ergebnis 183–183
- 184–213 Kapitel 6 Der Tatbestand der Aggression des Art. 5 184–213
- 184–194 I. Historisches 184–194
- 184–186 1. Der Aggressionstatbestand bis 1945 184–186
- 186–187 2. Art. 6 a) IMT – Statut 186–187
- 187–191 3. Die Aggression im Rahmen der UN Charta 187–191
- a) Im Text der UN Charta
- b) In der Arbeit des Sicherheitsrates
- c) In den Texten und der Arbeit der Generalversammlung
- d) Die Aggressionsdefinition der Generalversammlung
- e) In der Arbeit des IGH
- 191–192 4. Im Entwurf der ILC zur „Konvention über Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit“ von 1996 191–192
- 192–193 5. In den Statuten der Tribunale für Jugoslawien und Ruanda 192–193
- 193–194 6. Ergebnis 193–194
- 194–196 II. Inhaltliche Unsicherheiten 194–196
- 194–195 1. Anwendungsbereich 194–195
- 195–196 2. Intensität der Gewaltanwendung 195–196
- 196–200 III. Grundlagen 196–200
- 196–198 1. Art. 23 II ILC Draft Statute for an International Criminal Court 196–198
- 198–199 2. Art. 5 Rom – Statut 198–199
- 199–200 3. Die Situation ohne Art. 5 II S. 2 Rom – Statut 199–200
- 200–204 IV. Probleme der Aggression als Straftatbestand 200–204
- 200–202 1. Die Probleme der Brücke zwischen staatlicher und individueller Verantwortlichkeit 200–202
- 202–204 2. Das politische Element 202–204
- 204–212 V. Die Frage der Zuständigkeit für einen Straftatbestand der Aggression 204–212
- 204–208 1. Die inhaltliche Zuständigkeit des Sicherheitsrates 204–208
- 208–212 2. Die formale Zuständigkeit des Sicherheitsrates 208–212
- a) Der Vorschlag des Vorsitzenden des Special Working Group
- b) Die Zustimmung des Sicherheitsrates als Vorbedingung der Zuständigkeit
- c) Das Nichteingreifen des Sicherheitsrates als Vorbedingung der Zuständigkeit des Strafgerichtshofes?
- d) Die Generalversammlung oder der IGH als Substitut des Sicherheitsrates?
- 212–213 VI. Ergebnis 212–213
- 214–218 Zusammenfassung 214–218
- 219–229 Literaturverzeichnis 219–229