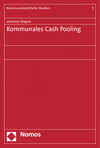Kommunales Cash Pooling
Zusammenfassung
Die Finanzbündelung im kommunalen Konzern führt zu erheblichen Zinseinsparungen und Zinsgewinnen. Kommunales Cash Pooling ist damit für finanzschwache Kommunen ein wirksames Entlastungsmittel. Der Verfasser erörtert erstmalig umfassend die von Kommunen zu beachtenden rechtlichen Voraussetzungen dieses Finanzinstruments. In übersichtlicher und verständlicher Art und Weise werden dabei zunächst die Grundlagen des kommunalen Cash Poolings, sowie die von den Akteuren zu beachtenden rechtlichen Hürden und schließlich die Beziehungen der Einheiten zueinander dargestellt: Auf welchen Verträgen und rechtlichen Beziehungen beruht es? Was muss in Bezug auf Kernverwaltung, Eigenbetrieb und Kommunaler Anstalt beachtet werden? Wie verhalten sich die Kapitalschutzvorschriften der Kapitalgesellschaften zum kommunalen Cash Pooling? Ist ein interkommunales Cash Pooling möglich? Diese und weitere Fragen werden in diesem Werk beantwortet. Das Buch leistet somit nicht nur in der Wissenschaft Pionierarbeit, sondern ist gerade auch für die Praxis ein überaus nützlicher Leitfaden.
- 2–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–8
- 9–16 Inhaltsverzeichnis 9–16
- 17–22 Abkürzungsverzeichnis 17–22
- 23–31 Einleitung 23–31
- 32–118 Kapitel 1 Grundlagen des kommunalen Cash Poolings 32–118
- 32–56 A. Rechtliche Grundlagen eines kommunalen Cash Pools 32–56
- 32–40 I. Beziehungen zwischen den öffentlichen Einheiten und Geldinstituten 32–40
- 1. Zahlungsdiensterahmenverträge
- 2. Verträge zwischen Betreibergesellschaft und Geldinstitut
- 3. Gesamtschuldnerische Haftung der angeschlossenen Unternehmen gegenüber dem Geldinstitut
- 4. Geldverkehrskonten und Internetplattform als Dienstleistung
- 40–55 II. Beziehungen der öffentlichen Einheiten untereinander 40–55
- 1. Verpflichtungen zur Bereitstellung von Liquidität
- 2. Kontokorrentvereinbarung
- a) Die Kontokorrentvereinbarung zur Reduzierung von Ansprüchen
- b) Erhöhung der Kassenkredite durch Kontokorrentabrede?
- c) Unterscheidung zwischen rechtstechnischer und wirtschaftlicher Betrachtungsweise
- 3. Vereinbarung über die Durchführung des Cash Poolings durch die Betreibergesellschaft
- 4. Steuerrechtliche Einordnung der internen Darlehen
- 55–56 III. Rechtliche Verbindungen beim virtuellen Pooling 55–56
- 56–66 B. Einordnung der bestehenden Darlehensbeziehungen in das kommunale Haushaltsrecht 56–66
- 56–58 I. Einordnung als »herkömmlicher« Kassenkredit 56–58
- 58–61 II. Einordnung als Investitionskredit 58–61
- 61–62 III. Einordnung als »Innere Darlehen« 61–62
- 62–63 IV. Einordnung als »Durchlaufende Gelder« 62–63
- 63–66 V. Einordnung als »moderner« Kassenkredit 63–66
- 66–73 C. Cash Pooling innerhalb des »Konzerns Kommune« 66–73
- 66–70 I. Definition des »Konzerns Kommune« 66–70
- 70–73 II. Die Kernverwaltung als herrschendes Unternehmen 70–73
- 1. Kriterien der »beherrschenden Stellung« und der »einheitlichen Leitung«
- 2. Beherrschende Beteiligung macht Kernverwaltung zum herrschenden Unternehmen
- 73–96 D. Cash Pooling über den »Konzern Kommune« hinaus 73–96
- 73–87 I. Grundsatz der Unzulässigkeit interkommunaler Kreditgeschäfte 73–87
- 1. »Interkommunale Kreditgeschäfte«
- 2. Der Tatbestand des § 32 I 1 KWG
- a) Erlaubnispflicht bei Betrieb von Bankgeschäften
- b) Gewerbsmäßigkeit der Bankgeschäfte
- c) Unternehmen i.S.d. KWG
- 3. Versagung der Erlaubnis
- 4. Möglichkeit eines kommunalen Cash Pools aufgrund des Konzernprivilegs nach § 2 I Nr. 7 KWG
- 87–96 II. Ausnahme der Zulässigkeit interkommunaler Kreditgeschäfte 87–96
- 1. Liquiditätsverbund zwischen Gesamtgemeinde und ihren Mitgliedsgemeinden
- 2. Kein Bankgeschäft bei der »Erfüllung öffentlicher Aufgaben«
- 96–110 E. Genaue Struktur eines kommunalen Cash Pools 96–110
- 96–101 I. Kommunale GmbH als Betreiberin des zentralen Cash Pool Kontos 96–101
- 101–110 II. Kommunale Anstalt als Betreiberin des Cash Pools 101–110
- 1. Vergleich der Kommunalen Anstalt und der GmbH
- 2. Die Bindung der kommunalen Anstalt an die Regelungen über die kommunale Kreditwirtschaft
- 3. Die Kreditkonditionen insbesondere aufgrund einer möglichen Gewährträgerhaftung
- 4. Zwischenergebnis
- 110–118 F. Weitere vergleichbare Finanzoptimierungsinstrumente 110–118
- 110–112 I. Der kommunale Querverbund 110–112
- 112–114 II. Die kommunale Darlehensgemeinschaft 112–114
- 114–118 III. Der Reservefonds der Sparkassen- und Giroverbände 114–118
- 118–118 IV. Das Netting 118–118
- 119–122 Zwischenergebnis zu Kapitel 1 119–122
- 123–237 Kapitel 2 Rechtliche Voraussetzungen der Teilnahme am kommunalen Cash Pool 123–237
- 123–132 A. Von der Teilnahme am kommunalen Cash Pool ausgeschlossene Rechtsformen 123–132
- 123–127 I. Regiebetriebe 123–127
- 127–132 II. Private Rechtsformen 127–132
- 1. Private Rechtsformen zur wirtschaftlichen Betätigung
- 2. Private Rechtsformen zur nichtwirtschaftlichen Betätigung
- 132–159 B. Die Kernverwaltung 132–159
- 132–136 I. Das kommunale Haushaltsrecht als »Kapitalschutzvorschriften« 132–136
- 136–144 II. Einzahlung in den Cash Pool 136–144
- 1. Reduzierung der Kassenmittel und angemessener Ertrag durch die Geldanlage
- 2. Hinreichende Sicherheit der gewählten Geldanlage
- 3. Rechtzeitige Verfügbarkeit der eingezahlten Kassenmittel
- 144–145 III. Entnahme von Geldern aus dem Cash Pool 144–145
- 145–159 IV. Die Kernverwaltung als Cash Pool Betreuer 145–159
- 1. Haushaltsrechtliche Vorgaben für Beziehungen zu externem Bankinstitut
- a) Vorgaben für »klassische« Geldanlage bei externen Dritten
- aa) Reduzierung der Kassenmittel und angemessener Ertrag durch die Geldanlage
- bb) Hinreichende Sicherheit der gewählten Geldanlage
- cc) Rechtzeitige Verfügbarkeit der angelegten Kassenmittel
- b) Vorgaben für die Kreditaufnahme
- 2. Haushaltsrechtliche Vorgaben für Beziehungen zu angeschlossenen Einheiten
- a) Vorgaben für »atypische« Geldanlage bei Teilnehmern des Cash Pools
- aa) Reduzierung der Kassenmittel; angemessener Ertrag; rechtzeitige Verfügbarkeit
- bb) Hinreichende Sicherheit der gewählten Geldanlage
- b) Vorgaben für die Kreditaufnahme – der »moderne« Kassenkredit
- 159–173 C. Der Eigenbetrieb 159–173
- 159–168 I. Geldanlage durch Eigenbetrieb bei Kernverwaltung als Cash Pool Führer 159–168
- 1. Die kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften zur Geldanlage
- 2. Schutz des Stamm- bzw. Eigenkapitals bei Einzahlung in den Cash Pool
- a) Die Kapitalaufbringung beim Eigenbetrieb
- b) Die Kapitalerhaltung beim Eigenbetrieb
- 168–173 II. Kassenkreditaufnahme durch Eigenbetrieb bei Kernverwaltung als Cash Pool Betreuer 168–173
- 1. Der »moderne, schlechte« Kassenkredit
- 2. Die Kassenkreditaufnahme des Eigenbetriebs als verdeckte Sacheinlage der Kernverwaltung
- 173–183 D. Die kommunale Anstalt 173–183
- 173–176 I. Das kommunale Haushaltsrecht 173–176
- 176–183 II. Schutz des Stamm- bzw. Eigenkapitals 176–183
- 1. Die Kapitalaufbringung bei der kommunalen Anstalt
- 2. Die Kapitalerhaltung bei der kommunalen Anstalt
- 183–184 Zwischenergebnis zu den Teilnahmevoraussetzungen der öffentlich-rechtlichen Rechtsformen am Cash Pool 183–184
- 184–219 E. Die GmbH 184–219
- 184–213 I. Geldanlage durch GmbH bei Kernverwaltung – upstream loan 184–213
- 1. Geldanlage und Kapitalaufbringung bei der GmbH
- a) Mögliche Umgehung eines Hin- und Herzahlens i.S.d. § 19 V GmbHG
- aa) Die »Geldanlage der GmbH« als »offizielle Sacheinlage« der Kernverwaltung
- bb) Die »Verminderung von Verbindlichkeiten der GmbH« als »offizielle Sacheinlage«
- cc) Kapitalerhöhung unter Einhaltung der Kapitalerhöhungsnormen aus Gesellschaftsmitteln
- dd) Umgehung des § 19 V GmbHG durch Zugriff der GmbH auf das Zentralkonto
- ee) Zeitweise Verschiebung der Bareinlage auf ein Sonderkonto
- ff) Dauerhafte Verschiebung der Bareinlage auf ein Sonderkonto
- gg) Die Verwendung der Bareinlage zum Erwerb von Anlagevermögen
- b) Die Voraussetzungen des § 19 V GmbHG
- aa) Vorherige Absprache hinsichtlich Rückflusses der Bareinlage
- bb) Keine verdeckte Sacheinlage i.S.d. § 19 IV GmbHG
- cc) Vollwertigkeit des Rückgewähranspruchs
- dd) Liquidität des Rückgewähranspruchs
- ee) Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Voraussetzungen
- ff) Offenlegung der Vereinbarung gegenüber dem Registergericht
- 2. Geldanlage und Kapitalerhaltung bei der GmbH
- a) Vollwertigkeit des Rückgewähranspruchs
- b) Verstoß gegen den Grundsatz der Kapitalerhaltung aufgrund unterlassener Rückforderung
- 213–219 II. Kreditaufnahme durch GmbH bei Kernverwaltung – downstream loan 213–219
- 1. Kreditaufnahme und Kapitalaufbringung bei der GmbH – die verdeckte Sacheinlage, § 19 IV
- a) Unzulässigkeit der verdeckten Sacheinlage
- b) Wirksamkeit der der verdeckten Sacheinlage zugrundeliegenden Verträge
- c) Anrechnung der verdeckten Sacheinlage auf die Geldeinlagepflicht
- d) Zwischenergebnis
- 2. Kreditaufnahme bei bereits aufgebrachtem Kapital
- 219–229 F. Die AG 219–229
- 219–227 I. Der Kapitalschutz in der AG 219–227
- 1. Die Kapitalaufbringung in der AG
- a) Die Vereinbarkeit von § 27 III AktG mit der Kapitalrichtlinie
- b) Die Vereinbarkeit von § 27 IV AktG mit der Kapitalrichtlinie
- 2. Die Kapitalerhaltung in der AG
- 227–229 II. Vereinbarkeit der Kapitalschutzvorschriften in der AG mit kommunalem Cash Pooling 227–229
- 1. Zur Kapitalaufbringung
- 2. Zur Kapitalerhaltung
- 229–230 Zwischenergebnis zu den Teilnahmevoraussetzungen privatrechtlicher Rechtsformen am Cash Pool 229–230
- 230–237 G. Die kommunale Stiftung 230–237
- 230–234 I. Mögliche Rechtsformen und Charakteristika kommunaler Stiftungen 230–234
- 1. Mögliche Rechtsformen kommunaler Stiftungen
- 2. Charakteristika kommunaler Stiftungen
- 234–237 II. Der Anschluss der kommunalen Stiftung an den Cash Pool 234–237
- 1. Die rechtsfähige kommunale Stiftung
- 2. Die nichtrechtsfähige kommunale Stiftung
- 238–240 Zwischenergebnis zu Kapitel 2 238–240
- 241–287 Kapitel 3 Die regelungstechnische Ausgestaltung des kommunalen Cash Pools 241–287
- 241–266 A. Die Ausgestaltung des kommunalen Cash Pools unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten 241–266
- 241–249 I. Die im kommunalen Konzern existierenden Steuersubjekte 241–249
- 1. Die Steuersubjekte im KStG
- 2. Die Steuersubjekte im GewStG
- 249–257 II. Die Gefahr verdeckter Gewinnausschüttungen beim kommunalen Cash Pooling 249–257
- 1. Die Möglichkeit von vGA bei den einzelnen teilnehmenden Einheiten
- 2. Die im Cash Pool bestehende Vereinbarung zur Vermeidung von vGA
- 3. Die zur Vermeidung von vGA notwendige Verzinsung
- 4. vGA bei Uneinbringlichkeit des Darlehens und Darlehensverzicht
- 257–262 III. Das Problem der Zinsschranke 257–262
- 1. Die Kommune als Konzern i.S.d. Zinsschranke
- 2. Das Eingreifen der Zinsschranke außerhalb des Konzerns
- 262–266 IV. Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen 262–266
- 1. Durchlaufkredite
- 2. Gewerbesteuerlich relevante Zinszahlungen mit und ohne Cash Pooling
- 3. Keine Gefahr steuerlicher Doppelbelastung beim kommunalen Cash Pooling
- 266–273 B. Europarechtliche Bedenken gegen das kommunale Cash Pooling 266–273
- 266–269 I. Keine missbräuchliche Verwendung von Beihilfen aufgrund eines kommunalen Cash Pools 266–269
- 269–273 II. Downstream loans im Cash Pool außerhalb der Beihilferegelungen des AEUV 269–273
- 1. Darlehen in Erfüllung der Kriterien der Altmark Trans Rechtsprechung und des Monti Pakets
- 2. Darlehen im Rahmen der De-minimis-Regelung
- 3. Darlehen unter Berücksichtigung eines angemessenen Zinssatzes
- 273–287 C. Insolvenzrechtliche Auswirkungen auf das kommunale Cash Pooling 273–287
- 273–277 I. Cash Pool Forderungen als liquide Mittel i.S.d. Insolvenzrechts 273–277
- 277–287 II. Die Anfechtung von Einzahlungen in den Cash Pool nach § 135 InsO 277–287
- 1. Der genaue Gegenstand der Anfechtung
- 2. § 135 I Nr. 1 oder Nr. 2 InsO als einschlägiger Anfechtungstatbestand
- 3. Das Bargeschäftsprivileg nach § 142 InsO
- 288–290 Zwischenergebnis zu Kapitel 3 288–290
- 291–296 Endergebnis 291–296
- 297–344 Anhang 297–344
- 297–334 A. Die Abbildung des kommunalen Cash Poolings in der Rechnungslegung 297–334
- 297–323 I. Die Abbildung des kommunalen Cash Poolings in der kommunalen Doppik 297–323
- 1. Die Einzelbuchungen aus Sicht der Kernverwaltung als Cash Pool Betreuer
- 2. Die Einzelbuchungen aus Sicht der Kernverwaltung als angeschlossene Einheit
- 3. Die zusammengeführte Rechnungslegung in der Kernverwaltung
- 323–330 II. Die Abbildung des kommunalen Cash Poolings in der handelsrechtlichen Doppik 323–330
- 330–334 III. Kontenrahmen 330–334
- 334–335 B. Auszug aus Schreiben des BaKred an das Innenministerium Baden-Württemberg vom 07.03.2002 334–335
- 335–338 C. Runderlass des nordrhein-westfälischen Innenministers zum Liquiditätsverbund (Cashpooling) im kommunalen Bereich vom 11.06.2008 335–338
- 338–339 D. Vorgaben im Rahmen der Einbeziehung der städtischen Eigengesellschaften in den Liquiditätsverbund der Landeshauptstadt Dresden gemäß Schreiben der Landesdirektion Dresden vom 18.02.2010 338–339
- 339–340 E. § 4 der Rahmenvereinbarung für einen Liquiditätsverbund 339–340
- 340–344 F. Auszug aus dem Gespräch zum Cash Pooling in der Stadt Leipzig vom 25.01.10; geführt d.V. mit Frau Uta Kraska und Herrn Ansgar Thielecke 340–344
- 345–360 Literaturverzeichnis 345–360
- 361–370 Stichwortverzeichnis 361–370