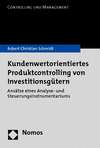Kundenwertorientiertes Produktcontrolling von Investitionsgütern
Ansätze eines Analyse- und Steuerungsinstrumentariums
Zusammenfassung
Der vom Kunden wahrgenommene Kundenwert eines Produkts oder einer Dienstleistung gilt lange schon als eine wesentliche Quelle unternehmensspezifischer Wettbewerbsvorteile. Dieser Gedanke gewinnt inzwischen auch im Bereich der Investitionsgüter zunehmend an Bedeutung. Während bei Konsumgütern bereits eine breite Palette von Instrumenten für die kundenwertorientierte Produktgestaltung existiert, fehlt es bislang an vergleichbaren Instrumenten für die Investitionsgütergestaltung.
Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke. Der Autor zeigt zunächst die Bedeutung des Kundenwerts bei Investitionsgütern auf und erarbeitet einen Vorschlag zur Quantifizierung dieser Größe. Weiterhin wird ein Instrumentarium aufgebaut, das die Analyse und Steuerung des Kundenwerts im Rahmen der Produkt-, Baugruppen- sowie Produktionsprozessgestaltung erlaubt. Ein durchgängiges Fallbeispiel ergänzt die theoretischen Ausführungen und stellt die praktische Relevanz und Anwendbarkeit des Entwickelten heraus. Das Werk schließt mit einer umfassenden Analyse der Chancen und Grenzen des theoretischen Modells sowie dessen fachpraktischer Umsetzung.
- 2–4 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–4
- 5–6 Geleitwort 5–6
- 7–8 Vorwort 7–8
- 9–10 Inhaltsübersicht 9–10
- 11–20 Inhaltsverzeichnis 11–20
- 21–188 Symbolverzeichnis 21–188
- 21–31 1 Kundenwertorientierung als neue Perspektive des Controllings 21–31
- 21–27 1.1 Motivation und Zielsetzung 21–27
- 27–31 1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 27–31
- 31–49 2 Begrifflicher Bezugsrahmen 31–49
- 31–35 2.1 Kundenwert 31–35
- 2.1.1 Konzeptionen des Kundenwerts
- 2.1.2 Abgrenzung zur Kundenzufriedenheit
- 35–47 2.2 Investitionsgüter und Investitionsgütertransaktionen 35–47
- 2.2.1 Investitionsgüter
- 2.2.2 Investitionsgütertransaktionen
- 2.2.2.1 Organisationen als Kunden
- 2.2.2.2 Fokus auf den Grundnutzen
- 2.2.2.3 Derivative Nachfrage
- 2.2.2.4 Bedarfsbeschreibung durch den Kunden
- 2.2.2.5 Leistungsbeschreibung durch den Anbieter
- 2.2.2.6 Phasenorientierung
- 47–49 2.3 Zusammenfassung 47–49
- 49–81 3 Theoretischer Bezugsrahmen 49–81
- 49–50 3.1 Forschungsfrage 49–50
- 50–52 3.2 Forschungsstrategie 50–52
- 52–72 3.3 Modellrahmen einer Investitionsgütertransaktion 52–72
- 3.3.1 Investitionsentscheidung des Kunden
- 3.3.1.1 Entscheidungssituation
- 3.3.1.2 Ermittlung des Kapitalwerts
- 3.3.2 Angebotsentscheidung des Anbieters
- 3.3.2.1 Entscheidungssituation
- 3.3.2.1.1 Nutzenfunktion des Anbieters
- 3.3.2.1.2 Einfluss der Kundenzufriedenheit
- 3.3.2.1.3 Einfluss des Produktgewinns
- 3.3.2.2 Ermittlung des (Kunden-)Kapitalwerts
- 3.3.2.3 Erweiterung der Kapitalwertfunktion um mehrere Produktfaktoren
- 3.3.2.3.1 Notwendigkeit einer Separation mehrerer Produktfaktoren
- 3.3.2.3.2 Das KANO-Modell zur Separation verschiedener Produktfaktoren
- 3.3.2.3.3 Übertragung des KANO-Modells auf den Investitionsgüterbereich
- 3.3.2.3.4 Der Kapitalwert bei mehreren Produktfaktoren
- 72–81 3.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung 72–81
- 81–103 4 Management und Controlling bei Investitionsgütertransaktionen 81–103
- 81–87 4.1 Zugrunde gelegtes Controllingverständnis 81–87
- 4.1.1 Zum Begriff des Controllings
- 4.1.2 Zum Begriff der Rationalität
- 4.1.3 Teilaufgaben des Controllings zur Rationalitätssicherung
- 87–96 4.2 Investitionsmanagement und Investitionscontrolling des Kunden 87–96
- 4.2.1 Investitionsmanagement
- 4.2.2 Investitionscontrolling
- 4.2.2.1 Zum Begriff des Investitionscontrollings
- 4.2.2.2 Ziele und Aufgaben des Investitionscontrollings
- 4.2.2.3 Instrumente des Investitionscontrollings
- 4.2.2.3.1 Allgemeine Instrumente
- 4.2.2.3.2 Investitionsrechnungsverfahren
- 96–102 4.3 Produktmanagement und Produktcontrolling des Anbieters 96–102
- 4.3.1 Produktmanagement
- 4.3.2 Produktcontrolling
- 4.3.2.1 Zum Begriff des Produktcontrollings
- 4.3.2.2 Ziele und Aufgaben des Produktcontrollings
- 4.3.2.3 Instrumente des Produktcontrollings
- 102–103 4.4 Zusammenfassung 102–103
- 103–135 5 Kundenwertorientierte Produktgestaltung 103–135
- 103–106 5.1 Konzeptionelle Einordnung einer kundenwertorientierten Produktgestaltung 103–106
- 106–129 5.2 Ablauf der kundenwertorientierten Produktgestaltung 106–129
- 5.2.1 Identifikation der Produktfaktoren
- 5.2.2 Herleitung der Kosten- und Zahlungsfunktionen
- 5.2.2.1 Formulierung der funktionalen Zusammenhänge
- 5.2.2.2 Basis der Produktkosten und Gewinnaufschlag
- 5.2.2.3 Eigenschaften der Kosten- und Zahlungsfunktionen
- 5.2.3 Bestimmung der optimalen Produktgestalt
- 5.2.3.1 Bestimmung der optimalen Produktgestalt bei einem Leistungsfaktor
- 5.2.3.1.1 Optimierung ohne Nebenbedingungen
- 5.2.3.1.2 Optimierung unter Nebenbedingungen
- 5.2.3.1.3 Beispiel
- 5.2.3.2 Bestimmung der optimalen Produktgestalt bei mehreren Produktfaktoren
- 5.2.3.2.1 Vorüberlegungen
- 5.2.3.2.2 Optimierung ohne Nebenbedingungen
- 5.2.3.2.3 Optimierung unter Nebenbedingungen
- 5.2.3.2.4 Beispiel
- 129–135 5.3 Zusammenfassung und Beurteilung der kundenwertorientierten Produktgestaltung 129–135
- 135–165 6 Kundenwertorientierte Baugruppengestaltung 135–165
- 135–137 6.1 Konzeptionelle Einordnung einer kundenwertorientierten Baugruppengestaltung 135–137
- 137–160 6.2 Ablauf der Baugruppengestaltung 137–160
- 6.2.1 Zielfindung
- 6.2.1.1 Notwendigkeit einer Zielsetzung
- 6.2.1.2 (Kunden-)Kapitalwertrentabilität als Beurteilungsgrundlage
- 6.2.1.3 Ableitung einer Zielrentabilität
- 6.2.2 (Kunden-)Kapitalwertspaltung
- 6.2.2.1 Vorüberlegungen
- 6.2.2.2 (Kunden-)Kapitalwertspaltung bei einem Leistungsfaktor
- 6.2.2.3 Beispiel
- 6.2.2.4 (Kunden-)Kapitalwertspaltung bei mehreren Produktfaktoren
- 6.2.2.5 Beispiel
- 6.2.2.6 Mögliche Erweiterung der (Kunden-) Kapitalwertspaltung
- 6.2.3 (Kunden-)Kapitalwertsteuerung
- 6.2.3.1 KWR-Matrix
- 6.2.3.2 Instrumente zur Steuerung des (Kunden-)Kapitalwerts
- 6.2.3.3 Beispiel
- 160–165 6.3 Zusammenfassung und Beurteilung der kundenwertorientierten Baugruppengestaltung 160–165
- 165–185 7 Kundenwertorientierte Prozessgestaltung 165–185
- 165–168 7.1 Konzeptionelle Einordnung einer kundenwertorientierten Prozessgestaltung 165–168
- 168–182 7.2 Ablauf der kundenwertorientierten Prozessgestaltung 168–182
- 7.2.1 Input-Output-Analyse
- 7.2.2 Integration der Kundenwertorientierung
- 7.2.2.1 Erweiterung der Produktionsstruktur um Leistungsfaktoren
- 7.2.2.2 Dekomposition der Leistungsfaktoren
- 7.2.2.3 Beispiel
- 7.2.3 Beurteilung der Produktionsstellen und Implikationen für die Prozessgestaltung
- 182–185 7.3 Zusammenfassung und Beurteilung der kundenwertorientierten Prozessgestaltung 182–185
- 185–188 8 Erkenntnisgewinn und weitere Forschungsbedarfe 185–188
- 189–190 Anhang 189–190
- A Beispiele für Leistungs-, Basis- und Begeisterungsfaktoren
- 190–190 B Struktur eines Hafenmobilkrans 190–190
- 191–216 Literaturverzeichnis 191–216