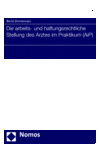Die arbeits- und haftungsrechtliche Stellung des Arztes im Praktikum (AiP)
Zusammenfassung
Die zunehmende Spezialisierung in der modernen Medizin birgt neben Vorteilen auch erhebliche Gefahren. Denn Spezialisierung bedeutet auch Beschränkung und so vermehrten Abstimmungsbedarf für die an der Behandlung beteiligten Personen. Angesprochen ist die Frage der Behandlungsorganisation und der Verantwortlichkeit dafür. Ein wesentlicher Aspekt der Krankenhausorganisation ist die Personalorganisation, hier vor allem der Einsatz ärztlicher Berufsanfänger. Unbestritten steht und fällt die Qualität der Heilbehandlung sei jeher mit den Fähig- und Fertigkeiten des Arztes. Deshalb gab es lange Beschränkungen der Ausübung der Heilkunde am Anfang des ärztlichen Berufslebens; in Deutschland seit mehr als 100 Jahren spezifische Praxisphasen, zuletzt den „Arzt im Praktikum“.
Das Spannungsverhältnis zwischen Ausbildung von (Fach)-Ärzten und Gewährung des geschuldeten Facharztstandards ist auch ein wirtschaftliches, denn für den Stellenplan ist der Berufsanfänger ein normaler Arzt. Berufsanfänger werden deshalb in weitem Umfang ärztlich tätig, was im Verhältnis zum Patienten keine Standardeinbuße zur Folge haben darf.
Die haftungsrechtlichen Risiken des Einsatzes ärztlicher Berufsanfänger werden unter besonderer Beachtung der Organisationshaftung des Trägers und der Einbindung des Berufsanfängers in die Hierarchie des ärztlichen Dienstes in organisatorischer, haftungs- und arbeitsrechtlicher Hinsicht untersucht.
- 2–26 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–26
- 27–30 Abkürzungsverzeichnis 27–30
- 31–36 Teil 1 Einleitung 31–36
- 37–72 Teil 2 Die früheren Praxisphasen und ihre Bedeutung für die Konzeption und Einführung der AiP-Phase 37–72
- 37–62 § 1 Frühere Praxisphasen und die Rechtsstellung ihrer Absolventen 37–62
- 37–59 A. Die früheren Praxisphasen 37–59
- I. Das Praktische Jahr 1901
- 1. Status des Medizinalpraktikanten
- 2. Zulässige Tätigkeiten
- a. Rechtliche Rahmenbedingungen
- b. Tatsächlicher Einsatz der Medizinalpraktikanten
- 3. Reformbestrebungen
- II. Die Pflichtassistentenzeit ab 1939
- 1. Status des Pflichtassistenten
- 2. Umfang der zulässigen Tätigkeiten
- 3. Abschaffung der Pflichtassistentenzeit
- III. Die Medizinalassistentenzeit nach der Bestallungsordnung von 1953
- 1. Status des Medizinalassistenten
- a. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis
- b. Arzt im Sinne des § 81a StPO?
- c. Befugnis zum Führen des Doktortitels
- 2. Zulässiger Tätigkeitsumfang
- a. Rechtliche Rahmenbedingungen und tatsächlicher Einsatz
- b. Zulässigkeit des Einsatzes der Medizinalassistenten
- 3. Vergütung des Medizinalassistenten
- 4. Ergebnis
- 5. Abschaffung der Medizinalassistentenzeit
- IV. Das Praktische Jahr nach 1970 der ÄAppO 1970
- 1. Status der Absolventen des Praktischen Jahres und Anwendung des BBiG
- 2. Umfang der zulässigen Tätigkeiten
- 3. Reformbestrebungen
- a. Das Qualitätsproblem
- b. Das Quantitätsproblem
- c. Der Einfluss des EG-Rechts
- 59–61 B. Auswirkungen auf das Konzept der AiP-Phase 59–61
- I. Die Weiterbildungslösung
- II. Die Zulassungslösung
- III. Die Ausbildungslösung
- 61–62 C. Die Einführung der AiP-Phase 61–62
- 62–72 § 2 Verfassungsrechtliche Fragen der AiP-Phase 62–72
- 62–63 A. Gesetzgebungskompetenz 62–63
- 63–72 B. Verletzung des Grundrechts auf Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG? 63–72
- I. Die AiP-Phase – eine objektive Berufszugangsregelung?
- 1. Die Stellenproblematik
- 2. Art der Berufszugangsregelung
- II. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der AiP-Phase
- 1. Schutzgüter
- 2. Berufslenkende Aspekte der AiP-Phase
- 3. Verhältnismäßigkeit der AiP-Phase
- a. Mangelnde Eignung
- b. Fehlende Erforderlichkeit oder Unzumutbarkeit
- c. Zwischenergebnis
- III. Die Rückwirkung
- 1. Bestehen eines Vertrauenstatbestandes
- 2. Schutzwürdigkeit des Vertrauens
- 72–72 C. Ergebnis 72–72
- 73–150 Teil 3 Die arbeitsrechtliche Stellung der ÄiP 73–150
- 73–83 § 3 Der Status der ÄiP 73–83
- 73–74 A. Abgrenzung des AiP von den Pflicht- bzw. Medizinalassistenten 73–74
- 74–81 B. ÄiP als Ärzte? 74–81
- I. Berufsbild Arzt
- 1. § 10 Abs. 4 und Abs. 6 BÄO 1985
- a. Wortlaut
- b. Systematik
- c. Entstehungsgeschichte
- d. Sinn und Zweck der §§ 10 Abs. 4 und 6 BÄO 1985
- 2. Zwischenergebnis
- II. „Arzt“ im Praktikum
- 81–82 C. Die AiP-Phase als Bestandteil des Medizinstudiums? 81–82
- I. Wortlaut und Systematik der BÄO 1985 und der ÄAppO 1986
- II. Historische Auslegung
- III. Teleologische Auslegung
- IV. Zwischenergebnis
- 82–83 D. Eigenständige Kategorie „AiP“ 82–83
- 83–83 E. Ergebnis 83–83
- 83–89 § 4 Arbeitnehmer oder zur Ausbildung Beschäftigte? 83–89
- 83–87 A. Arbeits- oder Ausbildungsvertrag 83–87
- I. Arbeitsverhältnis
- II. Ausbildungsverhältnis
- 87–89 B. Anwendbarkeit des BBiG? 87–89
- I. Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des BBiG
- II. Anderes Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 BBiG
- 1. Volontärvertrag
- 2. Praktikantenvertrag
- 89–89 C. Ergebnis 89–89
- 89–122 § 5 Umfang und Grenzen der Einsatzmöglichkeiten für ÄiP 89–122
- 89–93 A. Normative Vorgaben und tatsächlicher Einsatz 89–93
- I. Normative Vorgaben
- II. Tatsächlicher Einsatz
- 1. Art der ausgeübten Tätigkeiten
- 2. Tätigkeitsdauer
- a. Normale Dienstzeiten
- b. Bereitschaftsdienste
- 93–121 B. Tätigkeit unter Aufsicht oder Verrichtung zugewiesener Tätigkeiten 93–121
- I. Aufsicht im Sinne des § 34b ÄAppO 1986
- 1. Wortlaut
- 2. Systematik
- a. Vorschriften der BÄO und der ÄAppO
- aa. §§ 10 Abs. 4, 6 BÄO 1985, 34b ÄAppO 1986
- bb. Gesamtregelung der ÄAppO 1986
- cc. Zwischenergebnis
- b. Andere Normen
- aa. Gesetz über den PTA
- (1) Unter Verantwortung
- (2) Unter Aufsicht
- bb. § 42 Abs. 2 StrlSchV 1976
- c. Folgen für die Aufsicht im Sinne der BÄO 1985 und ÄAppO 1986?
- d. Zwischenergebnis
- 3. Historische Auslegung
- 4. Teleologische Auslegung
- a. Ausbildungsziel
- aa. Bestimmung des Ausbildungsziels der AiP-Phase
- bb. Auswirkungen auf den Aufsichtsbegriff
- b. Einsatzort
- 5. Zwischenergebnis
- II. Zugewiesene Tätigkeiten
- 1. Die Therapiefreiheit als bestimmendes Merkmal ärztlicher Tätigkeit
- 2. Begrenzung auf zugewiesene Tätigkeiten
- 3. AiP und „Notdienste“
- a. Terminologie
- b. Einsatz von ÄiP im Notfall- und Rettungsdienst
- aa. Rettungsdienst
- bb. Notfalldienst
- c. Ergebnis
- 4. ÄiP und Bereitschaftsdienste
- a. Allgemeine Fragen des Bereitschaftsdienstes
- aa. Bereitschaftsdienst
- bb. Rufbereitschaft
- b. Der Standard im Bereitschaftsdienst
- aa. Facharztstandard
- bb. Abstufungen des Standards
- (1) Objektive Umstände
- (2) Subjektive Umstände
- cc. Standardabweichungen im Bereitschaftsdienst
- dd. Fachübergreifender Bereitschaftsdienst
- c. Einsetzbarkeit der ÄiP im Bereitschaftsdienst?
- aa. Standardgewährung durch den alleinigen Einsatz von ÄiP?
- bb. Standardgewährung durch Hintergrunddienst/Rufbereitschaft?
- cc. Arbeitszeitrechtliche Zulässigkeit der Rufbereitschaft
- dd. Ausbildungszweck
- ee. Zuweisung von Tätigkeiten
- d. Zwischenergebnis
- 121–122 C. Ergebnis 121–122
- 122–150 § 6 Sonstige arbeitsrechtliche Fragen 122–150
- 122–128 A. Die für ÄiP abgeschlossenen Tarifverträge 122–128
- I. Tarifverträge für ÄiP
- II. Abweichungen der Tarifverträge vom BBiG
- 1. Probezeit
- 2. Kündigung des Ausbildungsvertrages
- 3. Zeugniserteilung
- 4. Vergütungsanspruch
- 5. Zuwendungstarifvertrag für ÄiP
- 128–144 B. ÄiP als Ärzte im Sinne des Tarifrechts? 128–144
- I. Vergütung
- 1. Anspruch auf Bezahlung nach dem für Assistenzärzte geltenden Tarif?
- a. Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz
- aa. Inhalt des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes
- bb. Anwendbarkeit des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes
- b. Allgemeiner Gleichheitssatz Art. 3 Abs. 1 GG
- aa. Geltung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes im Tarifrecht
- bb. Ungleichbehandlung von ÄiP und Assistenzärzten
- cc. Vergleichbarkeit der Sachverhalte
- (1) Tätigkeitsprofil
- (2) Ausbildungsstand
- c. Zwischenergebnis
- 2. Angemessene Vergütung im Sinne der §§ 26, 17 Abs. 1 Satz 1 BBiG
- a. Angemessenheit im Sinne der §§ 26, 17 Abs. 1 Satz 1 BBiG
- aa. Vergütung für die „reguläre“ Arbeitszeit
- (1) Berücksichtigung der Funktionen der Ausbildungsvergütung
- (2) Richtigkeitsgewähr der Tariflöhne für ÄiP?
- (3) Zwischenergebnis
- bb. Bereitschaftsdienstvergütung
- b. Ergebnis
- II. Eingruppierung
- 1. Berücksichtigung der AiP-Zeit bei Eingruppierung von Assistenzärzten
- 2. Die Eingruppierung der ausbildenden Ärzte
- 3. Ergebnis
- 144–150 C. Direktionsrecht des Arbeitgebers 144–150
- I. Inhalt und Reichweite des Direktionsrechts
- 1. Inhalt des Direktionsrechts
- 2. Grenzen des Direktionsrechts und seiner Ausübung
- II. Besondere Grenzen des Direktionsrechts bei Ärzten
- III. Direktionsrecht gegenüber den ÄiP
- 1. Inhalt der Arbeitsleistung
- 2. Arbeitszeit
- 3. Ausübung des Direktionsrechts
- 150–150 D. Ergebnis 150–150
- 151–282 Teil 4 Haftungsrechtliche Stellung der ÄiP 151–282
- 151–198 § 7 Stand der Arzthaftung in Deutschland 151–198
- 151–152 A. Identität des Pflichtenprogramms 151–152
- 152–169 B. Vertragliche Haftung des Arztes 152–169
- I. Rechtsnatur des Arztvertrages
- II. Typische Vertragsgestaltungen
- 1. Totaler Krankenhausaufnahmevertrag
- 2. Gespaltener Arzt-Krankenhaus-Vertrag
- 3. Totaler Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag
- III. Vertragliche Haftung des nachgeordneten ärztlichen Dienstes
- IV. Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes und des Schadensersatzrechtsänderungsgesetzes auf die Arzthaftung
- 1. Ausweitung des Schmerzensgeldanspruchs
- 2. Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
- a. Auswirkungen des § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB
- aa. Beweislastverteilung nach alter Rechtlage
- bb. Anwendbarkeit des § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB bei der vertraglichen Arzthaftung
- (1) Bedeutungslosigkeit des § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB
- (2) Uneingeschränkte Anwendung
- (3) Teleologische Reduktion des § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB
- (4) Abgrenzung von Pflichtverletzung und Verschulden
- (a) Abgrenzung nach Höchst- und Normalmaß der Sorgfalt
- (b) Innere und äußere Sorgfalt
- (5) Ergebnis
- b. Änderungen des Verjährungsrechts
- 169–172 C. Deliktische Haftung 169–172
- I. Grundlagen der deliktischen Arzthaftung
- II. Eigenhaftung des behandelnden Arztes
- III. Haftung des Krankenhausträgers aus Delikt
- 1. Deliktische Eigenhaftung des Krankenhausträgers
- a. Verletzung der Organisationspflichten
- b. Haftung für Verrichtungsgehilfen nach § 831 BGB
- 2. Haftung des Krankenhausträgers für seine Organe
- 172–197 D. Einzelne Pflichtverletzungen 172–197
- I. Unterschreitung des zu gewährenden Behandlungsstandards
- 1. Leitlinien und Standard
- a. Begrifflichkeiten
- b. Relevanz der Leitlinie
- 2. Standard und Wirtschaftlichkeitserwägungen
- II. Aufklärungspflichten
- 1. Allgemeines
- a. Aufklärungsarten
- aa. Die Selbstbestimmungs- oder Eingriffsaufklärung
- (1) Risikoaufklärung
- (2) Diagnoseaufklärung
- (3) Verlaufsaufklärung
- bb. Sicherungsaufklärung
- cc. Wirtschaftliche Aufklärung
- b. Durchführung der Aufklärung
- aa. Aufklärungspflichtiger
- bb. Verständlichkeit der Informationen
- cc. Rechtzeitigkeit der Aufklärung
- 2. Aufklärungspflichten bei Standardabweichungen
- a. Aufklärung über Standardabweichungen
- aa. Objektive Standardabweichungen
- (1) Bandbreite des Standards
- (2) Aufklärungspflicht
- (3) Ergebnis
- bb. Aufklärung über subjektive Standardabweichungen
- (1) Aufklärung über die Person des behandelnden Arztes
- (2) Aufklärung über die Qualifikation des behandelnden Arztes
- b. Unterschreitung des Standards
- 3. Beweislast bei fehlerhafter Aufklärung
- a. Unterscheidung zwischen Sicherungsaufklärung und Risikoaufklärung
- b. Beweislastverlagerung durch § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB?
- 197–198 E. Ergebnis 197–198
- 198–217 § 8 Haftung wegen der Verletzung von Organisationspflichten 198–217
- 198–201 A. Allgemeines 198–201
- 201–214 B. Einzelne Organisationspflichten 201–214
- I. Personalorganisation
- 1. Vorhalten des erforderlichen Personalbestandes
- 2. Einsatz des vorhandenen Personals
- a. Horizontale Arbeitsteilung
- b. Vertikale Arbeitsteilung
- II. Allgemeine Organisationspflichten des Krankenhausträgers
- 1. Medizinische Geräte
- a. Vertrags- und deliktsrechtlich begründete Organisationspflichten
- b. Spezialgesetzliche Regelungen, insbesondere das MPG
- 2. Einhaltung hygienischer Standards
- 3. Organisation der Aufklärung und Dokumentation
- a. Aufklärung
- b. Dokumentation
- 4. Allgemeine Verkehrsicherungspflichten
- 214–215 C. Beweislast bei der Verletzung von Organisationspflichten 214–215
- 215–217 D. Ergebnis 215–217
- 217–259 § 9 Die so genannte Anfängeroperation 217–259
- 217–219 A. Begriff des Anfängers 217–219
- 219–231 B. Voraussetzungen der Übertragung einer Behandlung an einen ärztlichen Berufsanfänger 219–231
- I. Eigenverantwortliche Behandlung durch einen Berufsanfänger
- II. Beaufsichtigte Tätigkeit des ärztlichen Berufsanfängers
- 1. Anforderungen an die Überwachung
- a. Stufenmodelle für die praktische ärztliche Ausbildung
- b. Geltung des Vertrauensgrundsatzes?
- 2. Anforderungen an den überwachenden Arzt
- a. Die so genannten Facharztentscheidungen des BGH
- b. Maßgeblichkeit materieller Kriterien
- III. Ergebnis
- 231–242 C. Haftung bei fehlerhafter Anfängeroperation 231–242
- I. Haftung des Krankenhausträgers
- II. Haftung des ausbildenden Arztes
- III. Eigenhaftung des ärztlichen Berufsanfängers
- 1. Besonderer Haftungsmaßstab für ärztliche Berufsanfänger?
- a. Selbständige Eingriffe des ärztlichen Berufsanfängers
- b. Beaufsichtigte Tätigkeit
- 2. Das Übernahmeverschulden
- a. Übernahmeverschulden des ärztlichen Berufsanfängers
- b. Anforderungen an die Eigenprüfung des ärztlichen Berufsanfängers
- 3. Einschränkung der Haftung durch den Vertrauensgrundsatz
- 4. Freistellungsanspruch des ärztlichen Berufsanfängers
- 242–242 D. Anforderungen an die Dokumentation bei der Anfängeroperation 242–242
- 242–243 E. Beweislastverteilung 242–243
- 243–257 F. Behandlungsfehler versus Aufklärungspflicht? 243–257
- I. Entwicklung der Rechtsprechung
- II. Dogmatische Einordnung einer eventuellen Aufklärungspflicht
- III. Unterscheidung nach der Art des Einsatzes
- 1. Beaufsichtigte Tätigkeit
- 2. Selbständige Behandlungsmaßnahmen
- a. Selbstbestimmungsrecht des Patienten
- b. Aufrechterhaltung des Ausbildungssystems
- c. Arzt-Patienten-Beziehung
- d. Parallelwertung bei sonstigen standardabhängigen Aufklärungspflichten
- aa. Behandlungsalternative
- bb. Aufklärungspflicht des erfahrenen Arztes
- e. Schutzbedürfnis des Patienten
- 3. Zwischenergebnis
- 257–259 G. Ergebnis 257–259
- 259–282 § 10 Haftung der ÄiP 259–282
- 259–264 A. Haftung der ÄiP im Außenverhältnis 259–264
- I. Besonderer Sorgfaltsmaßstab für ÄiP?
- II. Übernahmeverschulden
- III. Ergebnis
- 264–279 B. Haftung der ÄiP im Innenverhältnis 264–279
- I. Grundsätze der beschränkten Arbeitnehmerhaftung
- 1. Dogmatische Grundlagen
- 2. Voraussetzungen der beschränkten Arbeitnehmerhaftung
- a. Begünstigter Personenkreis
- b. Betrieblich veranlasste Tätigkeit
- c. Beweislast
- 3. Haftungsumfang des Arbeitnehmers
- a. Haftung im Außenverhältnis
- b. Verschuldensgrad als maßgebliches Kriterium
- c. Gefahrgeneigte Tätigkeit
- II. Haftungsbeschränkung für ÄiP?
- 1. Begünstigter Personenkreis
- 2. Haftungsumfang der ÄiP
- a. Generelle Haftungsbeschränkung
- b. Schlechterstellung der ÄiP
- c. Gefahrgeneigte Tätigkeit
- d. Mitverschulden des Krankenhausträgers
- aa. Mitwirkendes Organisationsverschulden
- bb. Weisungen
- cc. Einbindung in die hierarchische Struktur des ärztlichen Dienstes
- III. Ergebnis
- 279–281 C. Kündigungsrechte des Arbeitgebers bei Behandlungsfehlern 279–281
- 281–282 D. Ergebnis 281–282
- 283–308 Teil 5 Die Abschaffung der AiP-Phase und ihre Folgen 283–308
- 283–291 § 11 Abschaffung der AiP-Phase 283–291
- 283–288 A. Gesetzgebungsverfahren 283–288
- I. Einführung von Modellstudiengängen
- II. Studienreform durch die ÄAppO 2002
- III. Änderungen der BÄO 1986 und der ÄAppO 2002
- 288–291 B. Abschaffung der AiP-Phase mit der BÄO 2004 288–291
- I. Echte Stichtagsregelung
- 1. Ursprüngliche Konzeption des Gesetzgebers
- 2. Echte Stichtagsregelung
- II. Anspruch auf Erteilung der Approbation
- 291–291 C. Ergebnis 291–291
- 291–305 § 12 Arbeitsrechtliche Folgen der Abschaffung der AiP-Phase 291–305
- 291–294 A. Zulässigkeit der Tätigkeit als AiP und Fortbestand der Erlaubnis nach § 10 Abs. 4 BÄO 291–294
- I. Erlaubnisvorbehalt für die Ausübung des Arztberufs und der Heilkunde
- II. Folgen des Wegfalls der gesetzlichen Grundlagen für die AiP-Erlaubnis
- 1. Widerruf der Erlaubnis?
- 2. Erlöschen der AiP-Erlaubnis
- 294–297 B. Auswirkungen auf bestehende AiP-Verträge? 294–297
- I. Fortsetzung der Ausbildungsverträge?
- II. Kündigung der Ausbildungsverhältnisse
- III. Automatische Beendigung der Ausbildungsverträge
- IV. Ergebnis
- 297–304 C. Weiterbeschäftigungsanspruch der ehemaligen ÄiP? 297–304
- I. Anspruch auf Abschluss eines Arbeitsvertrages
- II. Arbeitsverhältnis durch bloße Weiterbeschäftigung?
- 1. Zustande kommen eines Arbeitsvertrages gemäß § 24 BBiG
- 2. Weiterbeschäftigung ohne vorherige Vereinbarungen
- 3. Weiterbeschäftigung nach Vertragsanpassungen
- a. Anwendbarkeit des § 313 BGB
- b. Einvernehmliche Vertragsanpassung und (Änderungs)-Kündigung
- aa. Kündigung durch die Ausbildungsstelle
- bb. Kündigung durch die ÄiP
- III. Befristung der neuen Arbeitsverhältnisse
- 1. Befristung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 TzBfG
- 2. Befristung nach § 1 Abs. 1 ÄArbVtrG
- IV. Vergütungsanspruch
- 1. Bestehen einer Tarifbindung
- 2. Keine Tarifbindung
- 304–304 D. Status der PJ-ler nach der ÄAppO 2002 304–304
- 304–305 E. Ergebnis 304–305
- 305–308 § 13 Haftungsrechtliche Folgen der Abschaffung der AiP-Phase 305–308
- A. Einsatz und Haftung der PJ-ler
- I. Einsatz der PJ-ler
- II. Anwendung der Grundsätze der vertikalen Arbeitsteilung
- III. Haftungsmaßstab
- 308–308 B. Haftung der ärztlichen Berufsanfänger 308–308
- 309–314 Teil 6 Bewertung der AiP-Phase 309–314
- 315–345 Literaturverzeichnis 315–345
- 346–354 Stellungnahmen von Behörden, Verbänden etc. 346–354