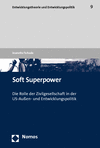Soft Superpower
Die Rolle der Zivilgesellschaft in der US-Außen- und Entwicklungspolitik
Zusammenfassung
Das Buch bietet eine umfassende Analyse der historischen Wurzeln und der institutionellen Einbettung der Zivilgesellschaftsförderung in die US-Außen- und Entwicklungspolitik. Im Zentrum steht das Spannungsfeld zwischen Idee, Funktionalisierung und machtpolitischer Einbindung, das an einer Fülle empirischer Beispiele aus der Demokratie- und Wirtschaftsförderung aufgefächert wird. In Anlehnung an Habermas und Gramsci geht die Autorin der Frage nach, inwieweit die Zivilgesellschaftspolitik der USA darauf ausgerichtet ist, die Handlungspotenziale bedrängter Menschen auszuweiten.
Zur Vielzahl untersuchter Politikprozesse gehören verdeckte Interventionen während des Kalten Krieges ebenso wie die Rolle der Zivilgesellschaft in Initiativen nach 1989, etwa der Community of Democracies, der Middle East Partnership Initiative, dem African Growth and Opportunity Act sowie bei US-Initiativen gegenüber postsowjetischen Staaten. Die Stärke des Buches liegt in der Verbindung reichhaltiger Empirie mit einer umfassenden Aufarbeitung der Theoriedebatte um Zivilgesellschaft und nationale Interessen, sowie des institutionellen Gefüges der US-Zivilgesellschaftspolitik.
- 2–12 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–12
- 13–18 Abkürzungsverzeichnis 13–18
- 19–19 Abbildungsverzeichnis 19–19
- 20–20 Tabellenverzeichnis 20–20
- 21–21 Kastenverzeichnis 21–21
- 22–25 Einleitung 22–25
- 26–51 1 Forschungslandschaft, -frage und -ansatz 26–51
- 26–32 1.1 Literaturüberblick zu Zivilgesellschaft und Zivilgesellschaftsförderung 26–32
- 26–27 1.1.1 Politiktheoretische Betrachtungen zur Zivilgesellschaft 26–27
- 27–28 1.1.2 Organisationssoziologischer Ansatz 27–28
- 28–30 1.1.3 Entwicklungspolitische Debatten zur Zivilgesellschaft 28–30
- 30–31 1.1.4 Zivilgesellschaft in den Internationalen Beziehungen 30–31
- 31–32 1.1.5 Zivilgesellschaftsförderung der USA 31–32
- 32–44 1.2 Fragestellung und Analyserahmen 32–44
- 32–36 1.2.1 Ideologie als Verschmelzung von Idee und Interesse 32–36
- 36–40 1.2.2 Idee und Interesse in der US-Außenpolitik – Scheindebatten und Stereotype 36–40
- 40–44 1.2.3 Analyserahmen für einen ideen- versus interessengeleiteten Umgang mit Zivilgesellschaft 40–44
- 44–51 1.3 Forschungsansatz 44–51
- 44–48 1.3.1 Ansätze der Politikfeld- und außenpolitischen Forschung als Hintergrundtheorien 44–48
- 48–51 1.3.2 Aufbau der Arbeit 48–51
- 52–100 2 Rolle der Zivilgesellschaft in der US-Außen- und Entwicklungspolitik während des Ost-West-Konflikts 52–100
- 52–56 2.1 Democratic internationalism und die Rolle der Zivilgesellschaft 52–56
- 56–95 2.2 Die US-Zivilgesellschaftspolitik während des Ost-West-Konflikts 56–95
- 56–60 2.2.1 Der Ost-West-Konflikt und die Entdeckung der Zivilgesellschaft als Interventionsfeld 56–60
- 60–71 2.2.2 Under cover-Interventionen in die Sphäre der Zivilgesellschaft 60–71
- 2.2.2.1 Gewerkschaften als Lehrmeister und Zielgruppe der Geheimdienste
- 2.2.2.2 Mobilisierung der prowestlichen intellektuellen Eliten
- 2.2.2.3 Organisation von Bauernverbänden
- 71–82 2.2.3 Zivilgesellschaftsförderung als entwicklungspolitisches Konzept 71–82
- 2.2.3.1 Die Alliance for Progress und die Entstehung der USamerikanischen Entwicklungszusammenarbeit
- 2.2.3.2 Die Entwicklung der Zivilgesellschaftsförderung
- 82–86 2.2.4 Die Einführung der Menschenrechtsdimension in die US-Außenpolitik 82–86
- 86–95 2.2.5 Zivilgesellschaftsförderung zur Beendigung des Ost-West-Konflikts 86–95
- 2.2.5.1 Ronald Reagans Campaign for Democracy
- 2.2.5.2 Die Gründung der National Endowment for Democracy zur offenen Förderung demokratieorientierter Zivilgesellschaft
- 95–100 2.3 Charakteristika der Zivilgesellschaftspolitik während des Ost-West-Konflikts 95–100
- 95–96 2.3.1 Das politische Umfeld 95–96
- 96–99 2.3.2 Die institutionelle Entwicklung: von covert zu overt 96–99
- 99–100 2.3.3 Die normative Dimension 99–100
- 101–153 3 Die Zivilgesellschaftsdebatte in den USA gegen Ende des 20. Jahrhunderts und ihre Rolle für die Außen- und Entwicklungspolitik 101–153
- 101–114 3.1 Der Kommunitarismus als prägende Strömung der US-Zivilgesellschaftsdebatte 101–114
- 101–105 3.1.1 Einende Aspekte und unterschiedliche Strömungen im Kommunitarismus 101–105
- 105–113 3.1.2 Alexis de Tocqueville als Bezugspunkt der kommunitaristischen Debatte 105–113
- 3.1.2.1 Zivilgesellschaft als Garant gegen die Übel der Gleichheit
- 3.1.2.2 Der Begriff der associations und das who’s who der Zivilgesellschaft
- 3.1.2.3 Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für den Erhalt der Demokratie
- 113–114 3.1.3 Sind Kommunitaristen „Tocquevillians“? 113–114
- 114–135 3.2 Der wissenschaftliche Diskurs zur Zivilgesellschaft 114–135
- 114–117 3.2.1 Zivilgesellschaft als Teil liberaler Gesellschaftstheorien 114–117
- 117–118 3.2.2 Kommunitarismus als Korrektur des liberalen Gesellschaftsmodells 117–118
- 118–120 3.2.3 Die community und der „Dritte Weg“ 118–120
- 120–122 3.2.4 Der Dritte Sektor zwischen Staat und Markt 120–122
- 122–124 3.2.5 Civic communities und die Effektivität demokratischer Institutionen 122–124
- 124–126 3.2.6 Sozialkapital und die Kunst der Kooperation 124–126
- 126–131 3.2.7 Die Bedeutung de Tocquevilles für die wissenschaftliche Debatte 126–131
- 131–135 3.2.8 Die Haltung ausgewählter Autoren zur Zivilgesellschaftsförderung 131–135
- 135–149 3.3 Zivilgesellschaft und ihre Förderung in Theorieansätzen zur Außen- und Entwicklungspolitik 135–149
- 135–144 3.3.1 Zivilgesellschaft in handlungsrelevanten entwicklungspolitischen Konzepten 135–144
- 144–149 3.3.2 Zivilgesellschaft in handlungsrelevanten außenpolitischen Konzepten 144–149
- 149–153 3.4 Handlungsleitende Dimensionen der US-Zivilgesellschaftspolitik 149–153
- 154–189 4 Nationale Interessen und Zivilgesellschaft nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 154–189
- 154–163 4.1 Probleme der Neudefinition nationaler Interessen 154–163
- 154–156 4.1.1 Nationale Identität und nationale Interessen 154–156
- 156–158 4.1.2 Die ambivalente Rolle privater Akteure für das nationale Interesse 156–158
- 158–161 4.1.3 Das Paradox des Supermachtstatus, Zukunftsszenarien und Handlungsoptionen 158–161
- 161–163 4.1.4 Richtungsstreit um die außen- und sicherheitspolitischen Institutionen 161–163
- 163–173 4.2 Eckpunkte nationalen Interesses 163–173
- 163–167 4.2.1 Demokratisierung 163–167
- 167–170 4.2.2 Wirtschaftliche Globalisierung 167–170
- 170–171 4.2.3 Die sicherheitspolitische Agenda der Terrorismusbekämpfung 170–171
- 171–173 4.2.4 Kritische Betrachtung der Demokratisierungsdoktrin 171–173
- 173–181 4.3 Zivilgesellschaft in nationalen Strategiepapieren 173–181
- 173–177 4.3.1 Aufstieg der civil society zur nationalen Identität 173–177
- 177–179 4.3.2 Zivilgesellschaft, Demokratisierung und Globalisierung 177–179
- 179–181 4.3.3 Zivilgesellschaft, nichtstaatliche Akteure und Terrorismusgefahr 179–181
- 181–186 4.4 Schwerpunkte der Außenpolitik – Die US-Regierungen im Vergleich 181–186
- 181–185 4.4.1 Schwerpunkte der Demokratieförderung 181–185
- 185–186 4.4.2 Geostrategische Schwerpunktsetzungen 185–186
- 186–189 4.5 Zwischenbilanz: Nationales Interesse und Zivilgesellschaft 186–189
- 190–272 5 Wandel institutioneller Rahmenbedingungen für Zivilgesellschaft in der Entwicklungs- und Außenpolitik nach 1989 190–272
- 190–206 5.1 Die Umstrukturierung entwicklungs- und außenpolitischer Institutionen 190–206
- 190–196 5.1.1 Zentralisierung entwicklungspolitischer Kompetenzen im State Department 190–196
- 196–199 5.1.2 Zentralisierung der public diplomacy im State Department 196–199
- 199–201 5.1.3 Zentralisierung der US-Demokratieförderung 199–201
- 201–206 5.1.4 Der Millennium Challenge Act – Armutsbekämpfung durch Wachstum 201–206
- 206–230 5.2 Institutionelle Einbindung von NGOs in die Entwicklungszusammenarbeit 206–230
- 206–208 5.2.1 Frühe Entwicklung der Strukturen staatlich-nichtstaatlicher Kooperation 206–208
- 208–213 5.2.2 PVO, NGO, CDO, FBO – die Welt der zivilgesellschaftlichen Kooperationspartner 208–213
- 213–214 5.2.3 Boom der Integration von NGOs in die staatliche Entwicklungszusammenarbeit 213–214
- 214–217 5.2.4 Einführung der debt swaps: Liberalisierung, Entwicklungsfinanzierung und Zivilgesellschaft 214–217
- 217–230 5.2.5 Ausdehnung der Kooperationsbeziehungen der USAID zu NGOs 217–230
- 5.2.5.1 Institutionelle Einbindung US-amerikanischer NGOs
- 5.2.5.2 Institutionelle Einbindung lokaler NGOs in die Entwicklungszusammenarbeit
- 230–244 5.3 Rechtliche und administrative Bestimmungen zu NGOs in der Entwicklungszusammenarbeit 230–244
- 230–233 5.3.1 NGOs zwischen Teilhabegarantie und Verlust der Eigenständigkeit 230–233
- 233–235 5.3.2 NGOs als Alternative zu direkter bilateraler Hilfe 233–235
- 235–238 5.3.3 NGOs als Werbeträger der Regierung 235–238
- 238–244 5.3.4 Politische Regulierungen und Einschränkungen von NGOs 238–244
- 5.3.4.1 Die Global Gag Rule und der gescheiterte Global Democracy Promotion Act
- 5.3.4.2 Unterbindung von Lobbyaktivitäten gegen US-Politik
- 244–253 5.4 Institutionelle Einbindung von NGOs in die Arbeit des State Department 244–253
- 244–249 5.4.1 Public diplomacy mit Hilfe von NGOs 244–249
- 249–253 5.4.2 (Public) diplomacy zu Gunsten von NGOs 249–253
- 253–266 5.5 „Gleichstellung” religiöser Organisationen in der Entwicklungs- und Außenpolitik 253–266
- 253–261 5.5.1 Boom der FBOs in der Entwicklungszusammenarbeit 253–261
- 261–266 5.5.2 (Public) diplomacy zu Gunsten religiöser Akteure 261–266
- 266–270 5.6 Eine neue Außen- und Entwicklungspolitik: NGOs als Gewinner und Verlierer 266–270
- 270–272 5.7 Abschließender Exkurs: NGOs und die US-Geheimdienste 270–272
- 273–343 6 Programmatik, Umfang und Kooperationspartner staatlicher Zivilgesellschaftsförderung 273–343
- 273–281 6.1 Programmatischer Rahmen der US-Zivilgesellschaftsförderung 273–281
- 281–296 6.2 Demokratie- und Zivilgesellschaftsförderung der USAID 281–296
- 281–288 6.2.1 Strategieentwicklung im Bereich democracy and governance 281–288
- 288–293 6.2.2 Zivilgesellschaftsförderung als Teilstrategie der Demokratieförderung 288–293
- 293–296 6.2.3 Regionale Schwerpunkte der USAID Zivilgesellschaftsförderung 293–296
- 296–309 6.3 Die strategische Neuausrichtung der NED 296–309
- 296–299 6.3.1 Der „neue“ Länderfokus der NED – pre-breakthrough countries 296–299
- 299–304 6.3.2 Die neue globale Agenda der NED – internationale Öffentlichkeit und Vernetzung 299–304
- 6.3.2.1 Das Journal of Democracy
- 6.3.2.2 Das International Forum for Democratic Studies
- 6.3.2.3 Das World Movement for Democracy
- 304–309 6.3.3 Veränderungen im klassischen grant-Programm 304–309
- 309–320 6.4 Der Human Rights and Democracy Fund des State Department 309–320
- 309–316 6.4.1 Mittelallokation des HRDF nach Ländern bzw. Regionen 309–316
- 316–319 6.4.2 Mittelallokation des HRDF nach Inhalten und begünstigten Akteuren 316–319
- 319–320 6.4.3 Internationale Aktivitäten des DRL 319–320
- 320–341 6.5 Zentrale nichtstaatliche Partner der US-Regierung 320–341
- 320–332 6.5.1 Partner der USAID 320–332
- 6.5.1.1 Die einflussreiche US-NGO-community
- 6.5.1.2 Die kleine, ebenfalls einflussreiche CDO-community
- 6.5.1.3 Der Privatwirtschaft nahe stehende Kooperationspartner
- 332–337 6.5.2 NED core grantees 332–337
- 337–341 6.5.3 Partner des State Department 337–341
- 341–343 6.6 Zwischenbilanz: Ein Akteursnetz für empowerment? 341–343
- 344–438 7 Zivilgesellschaft und Demokratieförderung 344–438
- 344–367 7.1 Die Demokratisierungsagenda auf internationaler Ebene 344–367
- 344–348 7.1.1 Das Interesse der USA an der Community of Democracies 344–348
- 348–352 7.1.2 Der Staatenprozess der Community of Democracies 348–352
- 352–366 7.1.3 Der zivilgesellschaftliche Prozess der Community of Democracies 352–366
- 7.1.3.1 Träger und Durchführungsorganisationen von CD-NGO-Foren
- 7.1.3.2 Das Beispiel des CD-NGO-Forums 2005
- 366–367 7.1.4 Zivilgesellschaft und die Community of Democracies – ein Fazit 366–367
- 367–419 7.2 Demokratieförderung auf nationaler und regionaler Ebene 367–419
- 367–381 7.2.1 Zivilgesellschaft und Regimewechsel (pre-breakthrough countries) 367–381
- 7.2.1.1 Beispiele einer offiziellen Politik des Regimewechsels
- 7.2.1.2 Ein Fall von Bewaffnung zivilgesellschaftlicher Akteure: Irak
- 7.2.1.3 Merkmale der Zivilgesellschaftsförderung als Mittel zum Regimewechsel
- 381–419 7.2.2 Zivilgesellschaft und Regimewandel im postsowjetischen Raum 381–419
- 7.2.2.1 Zivilgesellschaftsförderung – vom wirtschaftsnahen zum politischen Fokus
- 7.2.2.2 Politische Gründe der Neuausrichtung der Zivilgesellschaftsförderung
- 7.2.2.3 Profil der Zivilgesellschaftsförderung in den NIS nach dem Strategiewechsel
- 419–437 7.3 Demokratisierung unter dem Vorzeichen der Terrorismusbekämpfung 419–437
- 419–425 7.3.1 Aufbau der Middle East Partnership Initiative 419–425
- 425–430 7.3.2 Die politische Reformagenda der MEPI 425–430
- 430–434 7.3.3 Die ökonomische Reformagenda der MEPI 430–434
- 434–437 7.3.4 Besondere Herausforderungen einer Demokratisierungspolitik im Nahen Osten 434–437
- 437–438 7.4 Ebenen der Zivilgesellschaftsförderung für eine vielschichtige und strategische Demokratisierungsagenda 437–438
- 439–494 8 Zivilgesellschaft und wirtschaftliche Globalisierung 439–494
- 439–459 8.1 Verbreitung liberaler Marktwirtschaft – der Beitrag der Zivilgesellschaft 439–459
- 439–448 8.1.1 Giving business a voice 439–448
- 448–454 8.1.2 Genossenschaften – Business im demokratischen Gewand 448–454
- 454–459 8.1.3 Der Preis der Zivilgesellschaftsförderung: die Monetarisierung von Nahrungsmittelhilfe 454–459
- 459–470 8.2 Schutz vor den Bedrohungen durch die Globalisierung 459–470
- 459–463 8.2.1 Die Verankerung von Arbeits- und Sozialstandards in Handelsabkommen 459–463
- 463–465 8.2.2 „Internationale“ core labor standards zum Schutze amerikanischer Arbeiter 463–465
- 465–468 8.2.3 Rolle der Zivilgesellschaft bei der Förderung von AS-Standards 465–468
- 468–470 8.2.4 Die veränderte Rolle der Gewerkschaften 468–470
- 470–491 8.3 Fallbeispiel: African Growth and Opportunity Act 470–491
- 470–474 8.3.1 Handelspolitische Aspekte des AGOA 470–474
- 474–476 8.3.2 Arbeits- und Sozialstandards im AGOA 474–476
- 476–488 8.3.3 Die Rolle des AGOA Civil Society Forum 476–488
- 488–491 8.3.4 Die Rolle der Gewerkschaftsförderung 488–491
- 491–494 8.4 US-Zivilgesellschaftsförderung, mehr Motor als Stoßdämpfer der Globalisierung 491–494
- 495–522 9 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 495–522
- 495–499 9.1 Nationale Interessen in der US-Außen- und Entwicklungspolitik 495–499
- 495–496 9.1.1 Ideologie und nationale Interessen vor Ende des Ost-West-Konflikts 495–496
- 496–499 9.1.2 Nationale Interessen und außenpolitische Herausforderungen nach dem Ost-West-Konflikt 496–499
- 499–507 9.2 Zivilgesellschaftspolitik und nationale Interessen 499–507
- 499–503 9.2.1 Demokratisierung und Zivilgesellschaft 499–503
- 503–507 9.2.2 Wirtschaftliche Globalisierung und Zivilgesellschaft 503–507
- 507–513 9.3 Handlungsleitende Normen der US-Zivilgesellschaftspolitik 507–513
- 507–509 9.3.1 Die US-amerikanische Idee von der Zivilgesellschaft als Kraft zur Selbstorganisation 507–509
- 509–513 9.3.2 Die US-amerikanische Idee von der Zivilgesellschaft als Teil von Machtpolitik 509–513
- 513–518 9.4 US-Zivilgesellschaftsförderung: Trotz ideologischer Konformität ein Opfer nationaler Interessen 513–518
- 518–522 9.5 Die Rolle der Zivilgesellschaft im Lichte von Idee und Interesse 518–522
- 523–578 Literatur und Datenquellen 523–578