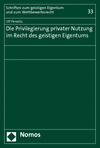Die Privilegierung privater Nutzung im Recht des geistigen Eigentums
Zusammenfassung
Wann und warum ist die private Nutzung geistigen Eigentums vom Verbotsrecht des Rechtsinhabers frei? Diese Frage beantwortet das vorliegende Werk. Es stellt Reichweite und Begründung der Privilegierung privater Nutzung umfassend dar. Die Untersuchung umfasst die viel diskutierte Frage der Zulässigkeit der Privatkopie im Urheberrecht de lege lata und de lege ferenda, unter besonderer Berücksichtigung des Dreistufentests des internationalen Urheberrechts. Dabei zeigt der Autor auf, dass die Erlaubnisfreiheit der Privatkopie auch schutzwürdigen Interessen der Nutzer Rechnung trägt. Daneben werden die Rechtslage im Bereich der übrigen Schutzrechte sowie Parallelen und Unterschiede erläutert.
- 2–18 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–18
- 19–30 Kapitel 1: Einleitung 19–30
- 19–19 A) Gegenstand und Ziel der Untersuchung 19–19
- 19–28 B) Der Begriff des geistigen Eigentums 19–28
- 19–23 I. Die historischen Wurzeln des Begriffs: Die Lehre vom geistigen Eigentum 19–23
- 23–27 II. Die Einwände gegen den Begriff des geistigen Eigentums und ihre Berechtigung 23–27
- 1. Die Einwände
- 2. Die (fehlende) Berechtigung dieser Einwände aus heutiger Sicht
- 27–28 III. Funktion und Inhalt des Begriffs aus heutiger Sicht und in dieser Arbeit 27–28
- 28–30 C) Gliederung und Gang der Untersuchung 28–30
- 31–138 Kapitel 2: Die Privilegierung privater Nutzung im Urheberrecht 31–138
- 31–82 A) Die Privilegierungstatbestände und ihre Reichweite 31–82
- 31–32 I. Die Freiheit des rezeptiven Werkgenusses 31–32
- 32–59 II. Die Privilegierung privater Nutzung im Recht der öffentlichen Wiedergabe 32–59
- 1. Die Legeldefinition in § 15 Abs. 3 UrhG
- a) Entwicklung und Kodifizierung des Öffentlichkeitsbegriffs
- aa) Öffentlichkeitsbegriff unter Geltung des LUG
- bb) Kodifikation im UrhG 1965
- cc) Änderung durch die Urheberrechtsnovelle 2003
- b) Probleme bei der Anwendung der Legaldefinition
- 2. Alternativer Ansatz: Privatheit der Wiedergabe
- a) Entsprechende Ansätze in Literatur und Rechtsprechung
- b) Konkretisierung des Kriteriums der Privatheit
- aa) Der Begriff des „privaten Charakters“ bzw. der „Privatsphäre“
- (1) Der „private Charakter“ der Werkwiedergabe
- (2) Die „private Sphäre“ bzw. Privatsphäre
- bb) Die Heranziehung der Privatsphäre in der Rechtsprechung zum Öffentlichkeitsbegriff
- cc) Das Verhältnis zwischen Privatsphäre und Nichtöffentlichkeit i.S.d. § 15 Abs. 3 UrhG
- dd) Andere Definition des Begriffs der Privatsphäre?
- 3. Unstimmigkeiten in der Rechtsprechung des BGH zum Öffentlichkeitsbegriff
- a) Die Kriterien der Rechtsprechung
- b) Beispiele aus der Rechtsprechung
- c) Das „Tanzstundenurteil“ des BGH
- d) Würdigung des Urteils vor dem Hintergrund der sonstigen Rechtsprechung
- 4. Modifizierung der Kriterien zur Abgrenzung von öffentlicher und privater Wiedergabe
- a) Gemeinsame Interessen
- b) Keine Verbundenheit zwischen allen Teilnehmern erforderlich?
- aa) Mittelbare Beziehungen?
- bb) Eigener Ansatz
- c) Verbundenheit durch persönliche Beziehungen mit dem Verwerter
- aa) Das Verhältnis zwischen Verbundenheit mit dem Verwerter und Verbundenheit mit den anderen Teilnehmern
- bb) Art der persönlichen Beziehungen zum Verwerter
- cc) Relevanz eines abgegrenzten Personenkreises sowie der Zahl der Personen?
- 5. Zwischenergebnis
- 6. Weitere (ungeschriebene) Voraussetzungen des Öffentlichkeitsbegriffs?
- 7. Geltung der Legaldefinition für alle Verwertungsrechte des § 15 Abs. 2 UrhG?
- a) Zusätzliche Voraussetzungen bei einzelnen Verwertungsrechten
- b) Engerer Begriff der Öffentlichkeit in § 20 UrhG?
- 8. Ergebnis
- 59–68 III. Die Privilegierung privater Nutzung im Verbreitungs- und Ausstellungsrecht 59–68
- 1. Privilegierung privater Nutzung im Verbreitungsrecht, § 17 UrhG
- a) Erste Tatbestandalternative: Angebot an die Öffentlichkeit
- aa) Grundsätzliche Geltung des Öffentlichkeitsbegriffs des § 15 Abs. 3 UrhG
- bb) Einzelangebot ausreichend?
- (1) BGH und herrschende Literaturansicht
- (2) Gegenansicht
- (3) Stellungnahme
- cc) Relevanz einer Verbundenheit der Angebotsempfänger untereinander?
- b) Zweite Tatbestandsalternative: Inverkehrbringen
- aa) H. M.: Auch hier Öffentlichkeit erforderlich
- bb) Gegenansicht: Keine Öffentlichkeit erforderlich
- cc) Stellungsnahme
- c) Vermiet- und Verleihrecht
- 2. Privilegierung privater Nutzung im Ausstellungsrecht
- 68–82 IV. Die Privilegierung privater Nutzung im Vervielfältigungsrecht 68–82
- 1. Die Vorschrift des § 53 UrhG
- 2. Entstehungsgeschichte
- 3. Dogmatische Einordnung
- 4. Reichweite des § 53 Abs. 1 UrhG in der heutigen Fassung
- a) Begriff des „privaten Gebrauchs“
- b) Vergleich des „privaten Gebrauchs“ mit der privaten Nutzung in den übrigen Verwertungsrechten
- aa) Vergleich mit den Rechten der öffentlichen Wiedergabe
- bb) Vergleich mit dem Verbreitungsrecht
- (1) Keine Weitergabe an Dritte?
- (2) Vergleich mit § 53 Abs. 6 UrhG
- (3) Vergleich mit dem „Herstellen lassen“
- cc) Ergebnis
- c) Übrige Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 UrhG
- 5. Die digitale Privatkopie
- a) Die tatsächliche Problematik und die sich daraus ergebende Diskussion
- b) EG-Multimediarichtlinie
- c) Gegenwärtige Regelung im deutschen UrhG
- 82–104 B) Mögliche Gründe für die Privilegierung privater Nutzung 82–104
- 82–84 I. Die Privatsphäre – Grundsatz der Urheberrechtsfreiheit der Privatsphäre? 82–84
- 1. Tauglichkeit eines solchen Grundsatzes als Begründung
- 2. Bestehen eines solchen Grundsatzes
- 84–86 II. Freiheit des Werkgenusses als Grund für die Privilegierung privater Wiedergaben? 84–86
- 86–104 III. Schutzwürdige Interessen von Rechtsinhabern und Nutzern 86–104
- 1. Interessen der Urheber
- a) Grundsatz der „tunlichst angemessenen Beteiligung“
- b) Umsetzung dieses Grundsatz
- aa) Unkörperliche Verwertung sowie Verbreitung: „Stufensystem zur mittelbaren Erfassung des Endverbrauchers“
- bb) Vervielfältigungsrecht: Mangelnde Durchsetzbarkeit des Verbotsrechts; „Marktversagen“
- c) Zwischenergebnis
- 2. Interessen der Verwerter
- 3. Daneben schutzwürdige Interessen der Nutzer?
- a) Besondere bzw. stärkere Sozialbindung des Urheberrechts?
- b) Der „soziale Bezug“ des Urheberrechts
- c) Schutzwürdige Interessen der Nutzer als (Mit-)Begründung der Privilegierung privater Nutzung
- aa) Schutzwürdigkeit von Konsuminteressen im Hinblick auf die Informationsfreiheit
- bb) Der Ansatz Senftlebens – Interesse der Allgemeinheit an der Verbreitung von Informationen
- (1) Verbreitung von Informationen
- (2) Gleichbehandlung heutiger und künftiger Urheber
- (3) Stellungnahme
- cc) Weitere Argumente für die Schutzwürdigkeit von Nutzerinteressen, einschließlich des reinen Konsuminteresses
- (1) Der Ansatz von Gaita und Christie
- (2) Stellungnahme
- (3) Entsprechende Stimmen in Literatur und Rechtsprechung
- dd) Zwischenergebnis
- 104–135 C) Beurteilung der gesetzlichen Regelung der digitalen Privatkopie 104–135
- 104–132 I. Der „Dreistufentest“ als Maßstab der gesetzgeberischen Entscheidung 104–132
- 1. Funktion und Systematik des Dreistufentests
- a) Funktion
- b) Systematik
- 2. Erste Teststufe – Bestimmte Sonderfälle
- a) Relevanz der ersten Teststufe für die Prüfung
- b) Die gesetzliche Lizenz zugunsten der (digitalen) Privatkopie im Lichte der ersten Teststufe
- aa) Bestimmtheit
- bb) Sonderfall
- (1) Quantitatives oder qualitatives Verständnis des Kriteriums „Sonderfall“?
- (2) Die digitale Privatkopie als bestimmter Sonderfall
- 3. Zweite Teststufe – Keine Beeinträchtigung der normalen Verwertung
- a) Auslegung der zweiten Teststufe
- aa) Konsequenzen einer weiten Auslegung des Begriffs der normalen Verwertung
- bb) Argumente gegen eine weite Auslegung
- cc) Empirisches oder normatives Verständnis?
- dd) Stellungnahme und vorzugswürdige Auslegung der zweiten Teststufe
- b) Die gesetzliche Lizenz zugunsten der digitalen Privatkopie im Licht der zweiten Teststufe
- aa) Marktbetrachtung
- bb) Beeinträchtigung der normalen Verwertung?
- (1) Keine Beeinträchtigung der normalen Verwertung durch die gegenwärtige Regelung
- (2) Beeinträchtigung der normalen Auswertung bei durchsetzungsstarker digitaler Privatkopie
- c) Ergebnis
- 4. Dritte Teststufe – Keine ungebührliche Verletzung berechtigter Interessen des Rechtsinhabers
- a) Bedeutung und Funktion der dritten Teststufe
- b) Berechtigte Interessen des Rechtsinhabers
- aa) Berücksichtigung auch von Interessen der Verwerter
- bb) Mögliche Unterschiede zwischen den Interessen von Verwertern und Urhebern
- c) Ungebührliche Verletzung dieser Interessen
- aa) Durchsetzbare digitale Privatkopie
- bb) Nicht durchsetzbare digitale Privatkopie
- cc) Vergütungshöhe
- (1) Gegenwärtige Höhe der Vergütungssätze und Notwendigkeit einer deutlichen Erhöhung
- (2) Gegenwärtige gesetzliche Regelung zur Festlegung der Vergütungshöhe
- (3) Pflicht des Gesetzgebers, für angemessene Vergütungssätze zu sorgen
- 5. Ergebnis
- 132–133 II. Verbot der digitalen Privatkopie durch den Gesetzgeber? 132–133
- 133–134 III. Ergebnis 133–134
- 134–135 IV. Ausblick 134–135
- 135–138 D) Zusammenfassung 135–138
- 139–250 Kapitel 3: Privilegierung privater Nutzung in den gewerblichen Schutzrechten 139–250
- 139–185 A) Reichweite der Privilegierung im Patent- und Gebrauchsmusterrecht 139–185
- 139–145 I. Die Reichweite des Ausschließlichkeitsrechts des Patent- und Gebrauchsmusterinhabers 139–145
- 1. Allgemeines
- 2. Anbieten – Anbieten an die Öffentlichkeit erforderlich?
- a) Vereinbarkeit mit Rechtsprechung und Literatur?
- b) Vorzugswürdige Auslegung
- 3. Öffentlichkeit im Rahmen des Inverkehrbringens erforderlich?
- 145–183 II. Die Schranke der §§ 11 Nr. 1 PatG und 12 Nr. 1 GebrMG 145–183
- 1. Entstehungsgeschichte
- 2. Reichweite der Regelung in § 11 Nr. 1 PatG und § 12 Nr. 1 GebrMG
- a) Auslegung anhand des GPÜ?
- b) Aktuelle Rechtsprechung?
- c) Heranziehung der Rechtsprechung zum Begriff der „Gewerbsmäßigkeit“?
- d) Methodik: Trennung zwischen „privatem Bereich“ und „nichtgewerblichem Zweck“
- e) Entstehungsgeschichtliche Einordnung des Verhältnisses beider Kriterien
- f) Schlussfolgerungen für die Methodik
- g) Der „private Bereich“ in der Rechtsprechung zur „Gewerbsmäßigkeit“
- h) Beispiele aus der Literatur
- i) Zwischenergebnis
- 3. Mögliche Konkretisierung, insbesondere durch Parallelen zum Urheberrecht?
- a) Inhärente Beschränkungen und Methodik einer vergleichenden Untersuchung
- b) „Privat“ im Sinne von § 11 Nr. 1 PatG und § 12 Nr. 1 GebrMG gleich „nicht öffentlich“?
- c) Parallelen zum Urheberrecht hinsichtlich des Anbietens und Inverkehrbringens
- aa) Ansatzpunkt
- bb) Räumliches oder personenbezogenes Verständnis des „privaten Bereichs“?
- (1) Anhaltspunkte für ein räumliches Verständnis?
- (2) Ein räumliches Verständnis im Lichte der Interessen der Beteiligten
- (3) Ein personenbezogenes Verständnis im Lichte der Interessen der Beteiligten
- cc) Heranziehung des § 15 Abs. 3 S. 2 UrhG?
- (1) Berücksichtigung von Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen
- (2) Berücksichtigung des Willens des Gesetzgebers
- (3) Berücksichtigung von Rechtsprechung und Literatur zur „Gewerbsmäßigkeit“
- dd) Ergebnis
- d) Parallelen zum Urheberrecht hinsichtlich des Herstellens
- aa) Kein Personenbezug beim Herstellen
- bb) Vergleich Herstellen – Vervielfältigen: Abstellen auf den Zweck des Herstellens?
- cc) Unterschiedliche Auslegung des „privaten Bereichs“ als Gegenargument?
- dd) Möglichkeit einer auf den Herstellungszweck abstellenden Auslegung
- (1) Teleologische Argumente für eine solche Auslegung
- (2) Wortlaut und Systematik als Gegenargumente?
- ee) Ergebnis
- e) Privilegierung privater Nutzung im Rahmen des Gebrauchens
- aa) Parallelen zum Urheberrecht?
- bb) Anderweitige Konkretisierung?
- f) Privilegierung privater Nutzung im Rahmen des Einführens und Besitzens
- aa) Privilegierung dann, wenn bezweckte Benutzung ihrerseits privilegiert ist
- bb) Darüber hinaus direkte Anwendung der Privilegierung auf Einfuhr und Besitz?
- g) Privilegierung privater Nutzung in Bezug auf Verfahrenspatente
- aa) Anbieten des Verfahrens
- (1) Auch hier personenbezogene Auslegung sinnvoll
- (2) Relevanz einer Privilegierung des Angebotsempfängers nach § 11 Nr. 1 PatG?
- (3) Abstellen auf Privilegierung der angebotenen Anwendung durch den Anbietenden?
- (4) Ergebnis
- bb) Anwenden des Verfahrens
- (1) Grundsätzliche Entsprechung zum „Gebrauchen“ beim Erzeugnispatent
- (2) Sonderfall: Herstellungsverfahren
- 183–185 III. Gesamtergebnis 183–185
- 185–197 B) Reichweite der Privilegierung privater Nutzung im Geschmacksmusterrecht 185–197
- 185–187 I. Privilegierung durch beschränkte Reichweite des Ausschließlichkeitsrechts? 185–187
- 187–197 II. Die Schranke des § 40 Nr. 1 GeschmMG 187–197
- 1. Gemeinschaftsrechtlicher Ursprung der Regelung und Konsequenzen für die Auslegung
- 2. Auslegung anhand des Gemeinschaftsrechts?
- 3. Auslegung entsprechend § 11 Nr. 1 PatG und § 12 Nr. 1 GebrMG?
- a) Gründe für eine Auslegung entsprechend § 11 Nr. 1 PatG und § 12 Nr. 1 GebrMG
- b) Der „private Bereich“ im Hinblick auf die Benutzungshandlungen des § 38 Abs. 1 GeschmMG
- aa) Verbreitung, Herstellung, Gebrauch und Besitz
- bb) Ein- und Ausfuhr
- (1) Gesetzeswortlaut: Keine Bezugnahme auf den verfolgten Zweck
- (2) Dennoch auf bezweckte weitere Nutzungshandlungen abstellen?
- (3) Historische Auslegung
- (4) Anhaltspunkte in der geschmacksmusterrechtlichen Literatur
- (5) Ausfuhr
- cc) Wiedergabe
- 197–197 III. Ergebnis 197–197
- 197–201 C) Reichweite der Privilegierung privater Nutzung im Sorten- und Halbleiterschutzrecht 197–201
- 197–198 I. Privilegierungstatbestände 197–198
- 198–199 II. Auslegung entsprechend den patent- und musterrechtlichen Vorschriften 198–199
- 199–201 III. Differenzierung nach Benutzungshandlungen 199–201
- 1. Sortenschutzrecht
- 2. Halbleiterschutzrecht
- 201–230 D) Reichweite der Privilegierung privater Nutzung im Markenrecht 201–230
- 201–217 I. Handeln „im geschäftlichen Verkehr“ – Grundsätze 201–217
- 1. Übliche Definition des „geschäftlichen Verkehrs“
- a) Definition(en) in Rechtsprechung und Literatur
- b) Maßgeblichkeit der Teilnahme am Wirtschafts- bzw. Erwerbsleben
- c) Folge für Begriff und Reichweite der „privaten“ Nutzung
- 2. Relevanz des angesprochenen Personenkreises?
- a) Relevanz des angesprochenen Personenkreises in der Rechtsprechung
- aa) Die „Handtuch-“ und „Seifenspender“-Entscheidungen des BGH
- bb) Sonstige Entscheidungen
- cc) Mögliche Konsequenz für den Bereich privilegierter privater Nutzung
- b) Argumente gegen die Relevanz des angesprochenen Personenkreises
- aa) OLG Köln – „lotto-privat.de“
- bb) Nutzung von Kennzeichen für private Websites
- cc) Private Internetversteigerungen
- c) Konsequenzen für die (abweichende) Rechtsprechung?
- d) Ergebnis
- 3. Relevanz eines Handelns innerhalb der Privatsphäre?
- 4. Ergebnis
- 217–230 II. Teilnahme am Erwerbsleben – Kriterien im Einzelfall 217–230
- 1. Internetversteigerungen
- a) Gewinnerzielungsabsicht
- b) Anzahl der Angebote
- c) Abwägung der Umstände des Einzelfalls
- aa) Übrige (Auktions-)Tätigkeit des Anbieters
- bb) Konkreter Einzel- bzw. Verletzungsfall
- cc) Darlegungs- und Beweislast
- dd) Erkennbarkeit der maßgeblichen Umstände
- 2. Private Websites
- 3. Private Einfuhren
- 230–250 E) Die Gründe der Privilegierung privater Nutzung in den gewerblichen Schutzrechten 230–250
- 230–236 I. Die Schranke der „Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken“ 230–236
- 1. Stellungnahmen in Gesetzgebung und Literatur
- 2. Rechtfertigung des Patentrechts
- a) Patentrechtstheorien
- b) Implikationen für die Reichweite des Schutzes und von Beschränkungen
- 3. Interessenabwägung
- 4. Übertragung auf die übrigen gewerblichen Schutzrechte
- 236–250 II. Die Beschränkung des Marken- und Kennzeichenrechts auf den „geschäftlichen Verkehr“ 236–250
- 1. Auch hier Ergebnis einer Interessenabwägung?
- 2. Immanente Beschränkung auf Handlungen im geschäftlichen Verkehr?
- a) Vergleich mit dem Wettbewerbsrecht
- b) Entsprechende Grundsätze des Marken- und Kennzeichenrechts
- c) Heranziehung der Funktion(en) von Marke und Markenrecht
- aa) Herkunfts(unterscheidungs)funktion
- (1) „Klassisches Verständnis“: Herkunftsfunktion als Hauptfunktion
- (2) Herkunftsfunktion als Herkunftsunterscheidungsfunktion
- (3) Bedeutung für die Beschränkung des Markenrechts auf den „geschäftlichen Verkehr“
- bb) Weitere Funktionen der Marke nach „klassischem“ Verständnis
- (1) Werbe- und Vertrauensfunktion
- (2) Bedeutung für die Beschränkung des Markenrechts auf den „geschäftlichen Verkehr“
- (3) Heranziehung dieser Funktionen im vorliegenden Zusammenhang?
- cc) Neueres Verständnis der Funktion(en) der Marke
- (1) Umfassende Kommunikationsfunktion der Marke
- (2) Bedeutung für die Beschränkung des Markenrechts auf den „geschäftlichen Verkehr“
- d) Übertragung der dargestellten Grundsätze auf geschäftliche Bezeichnungen
- e) Ergebnis
- 250–250 F) Zusammenfassung 250–250
- 251–260 Kapitel 4: Vergleichende Betrachtungen 251–260
- 251–257 A) Reichweite der Privilegierungen – einheitlicher Begriff privater Nutzung? 251–257
- 251–253 I. Ausmaß der Vergleichbarkeit 251–253
- 253–255 II. „Sonderstellung“ des Marken- und Kennzeichenrechts 253–255
- 255–256 III. Anbieten und Inverkehrbringen 255–256
- 256–257 IV. Herstellen bzw. Vervielfältigen etc. 256–257
- 257–260 B) Gründe der Privilegierungen und Erklärung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in deren Reichweite 257–260
- 257–258 I. Vergleich der Gründe für die Privilegierung privater Nutzung 257–258
- 258–260 II. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Privilegierungen im Lichte ihrer jeweiligen Gründe 258–260
- 1. „Sonderstellung“ des Marken- und Kennzeichenrechts
- 2. Übrige gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
- 260–260 III. Ergebnis 260–260
- 261–264 Kapitel 5: Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesenform 261–264
- 265–280 Literaturverzeichnis 265–280