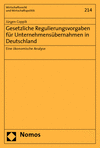Gesetzliche Regulierungsvorgaben für Unternehmensübernahmen in Deutschland
Eine ökonomische Analyse
Zusammenfassung
Unternehmensübernahmen betreffen Wirtschaftssysteme in besonderem Maße, da eine Vielzahl von Märkten betroffen ist: Es geht gleichermaßen um die Allokation von Produktionsmitteln und Arbeitskräften, aber auch um die Versorgung mit Gütern. Seit dem 1.1.2002 ist das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) in Kraft, welches diesen ökonomisch bedeutsamen Bereich regelt. Es wurde durch die am 14.7.2006 umgesetzte europäische Übernahmerichtlinie novelliert.
Die Arbeit analysiert die Regulierungsvorgaben des WpÜG hinsichtlich ihrer Wirkungen auf den Markt für Unternehmensübernahmen. Hierfür wird der folgenorientierte Blickwinkel der Ökonomischen Theorie des Rechts eingenommen, in deren Analyseinstrumentarium vorab kurz eingeführt wird.
Die Analyse ergibt, dass die von den Regulierungsvorgaben ausgehenden Wirkungen nicht im Einklang mit ökonomischen Grundsätzen stehen. Insbesondere wird die Attraktivität von Übernahmen durch einen überdimensionierten Schutz der Aktionäre der Zielgesellschaft deutlich eingeschränkt. Positive gesamtwirtschaftliche Effekte gehen hierdurch verloren.
Abschließend werden die einzelnen Analyseergebnisse in eine Reihe konkreter Handlungsvorschläge für den Gesetzgeber umgesetzt.
- 2–18 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–18
- 19–22 Einleitung 19–22
- 23–89 Kapitel 1: Grundlagen der Ökonomischen Theorie des Rechts im Überblick 23–89
- 23–26 A. Der Wertbeitrag der Ökonomischen Theorie zur Rechtswissenschaft 23–26
- 26–32 B. Zur historischen Entwicklung der Ökonomischen Theorie des Rechts 26–32
- 26–30 I. Ursprung und Forschungsrichtungen 26–30
- 1. Die »Chicago School« als Ursprung der heutigen Ökonomischen Theorie des Rechts
- 2. Public Choice
- 3. Constitutional Economics
- 4. Neue Institutionenökonomik
- 30–31 II. Die Entwicklung der Ökonomischen Theorie des Rechts in Deutschland 30–31
- 31–32 III. Kapitalgesellschaftsrecht in der Ökonomischen Theorie des Rechts 31–32
- 32–55 C. Das mikroökonomische Analyseinstrumentarium der Wohlfahrtsökonomik und seine Modifikationen durch die Neue Institutionenökonomik 32–55
- 32–42 I. Das ökonomische Verhaltensmodell 32–42
- 1. Der homo oeconomicus der Wohlfahrtsökonomik
- 2. Der Methodologische Individualismus der Neuen Institutionenökonomik
- a. Unvollständige Information
- b. Eingeschränkte Rationalität
- c. Opportunistisches Verhalten
- d. Konsequenzen für das Normverständnis
- e. Konsequenzen für die Betrachtung des Staates
- aa. Der Staat als wohlwollender Diktator in der Wohlfahrtsökonomik
- aaa. Staatsversagen
- bbb. Regierungsversagen
- bb. Der Staat als Leviathan in der Neuen Institutionen-ökonomik
- 42–45 II. Nutzen als Ausdruck individueller Präferenzen 42–45
- 45–46 III. Die Behandlung von Transaktionskosten 45–46
- 46–53 IV. Das ökonomische Effizienzziel 46–53
- 1. Das wohlfahrtsökonomische Allokationsziel
- a. Pareto-Effizienz
- aa. Das Pareto-Kriterium
- bb. Zugrunde liegende Werturteile
- b. Das Kompensationskriterium von Kaldor und Hicks
- 2. Der konsenstheoretische Ansatz der Neuen Institutionenökonomik
- 3. Vergleich der Effizienzkriterien
- 53–55 V. Zusammenfassende Stellungnahme 53–55
- 1. Wohlfahrtsökonomik
- 2. Neue Institutionenökonomik
- 55–73 D. Untersuchungsschwerpunkte der Neuen Institutionenökonomik 55–73
- 55–61 I. Coase-Theorem als Ausgangspunkt 55–61
- 1. Das Coase-Theorem
- 2. In der Literatur geäußerte Kritik
- 3. Konsequenzen für gesetzliche Regulierungsvorgaben
- 61–64 II. Transaktionskostenanalyse 61–64
- 1. Markttransaktionskosten
- 2. Unternehmensinterne Transaktionskosten
- 3. Politische Transaktionskosten
- 64–67 III. Verfügungsrechtsanalyse 64–67
- 67–71 IV. Ökonomische Vertragstheorie 67–71
- 1. Unvollständige Verträge
- 2. Prinzipal-Agenten-Theorie
- 71–73 V. Zusammenfassung der abgeleiteten Anforderungen an das Recht 71–73
- 73–86 E. Zur Kritik an der Ökonomischen Theorie des Rechts 73–86
- 73–76 I. Mangelnde Leistungsfähigkeit 73–76
- 76–84 II. Kritik an den Annahmen 76–84
- 1. Methodologischer Individualismus und Menschenbild
- 2. Kritik an der ökonomischen Effizienz als Rechtsprinzip
- a. Effizienz und subjektive Rechte
- b. Effizienz und Gerechtigkeit
- c. Kosten staatlicher Interventionen
- d. Konzeptionelle Schwächen
- 84–85 III. Mangelnde Praktikabilität 84–85
- 85–86 IV. Zusammenfassende Stellungnahme 85–86
- 86–89 F. Zwischenergebnis 86–89
- 90–154 Kapitel 2: Der Markt für Unternehmensübernahmen – Funktionen und ökonomische Problematik 90–154
- 90–108 A. Überblick über den Markt für Unternehmensübernahmen 90–108
- 90–98 I. Begriffliche Bestimmung und thematische Abgrenzung 90–98
- 1. Mergers
- 2. Acquisitions
- a. Asset Deal
- b. Share Deal
- c. Proxy Contest
- 3. Thematische Abgrenzung
- 98–103 II. Entwicklung des Marktes für Unternehmensübernahmen 98–103
- 103–108 III. Verfolgte Ziele und Erfolgsquoten von Unternehmensübernahmen 103–108
- 1. Mit Unternehmensübernahmen verfolgte Ziele
- 2. Erfolgsquote von Mergers und Acquisitions
- 108–123 B. Ökonomische Funktionen des Marktes für Unternehmensübernahmen 108–123
- 108–111 I. Allokationsfunktionen 108–111
- 111–113 II. Disziplinierungsfunktion 111–113
- 113–123 III. Einwände gegen Unternehmensübernahmen 113–123
- 1. Keine Verbesserung allokativer Effizienz?
- 2. Konzentrationsfördernde Wirkung?
- 3. Ordnungspolitisch bedenkliche Motive?
- 4. Gefahr der Ausbeutung von Minderheitsaktionären
- 5. Fazit
- 123–149 C. Ökonomische Problematik des Marktes für Unternehmensübernahmen 123–149
- 123–125 I. Ursachen von Marktversagen im Überblick 123–125
- 125–133 II. Transaktionskostenintensität 125–133
- 1. Der Akquisitionsprozess
- 2. Transaktionskostenanalyse (ohne Regulierungsvorgaben)
- 133–143 III. Informationsasymmetrien und Anreizprobleme 133–143
- 1. Marktversagen bei Unternehmensübernahmen infolge Moral Hazard
- a. Moral Hazard: ein Beispiel
- b. Moral Hazard bei Unternehmensübernahmen (Corporate Governance)
- c. Collective Action Problem
- 2. Private Lösungsansätze für Moral Hazard bei Unternehmensübernahmen
- 3. Informationsdefizite auf Bieterseite
- 4. Konsequenzen für gesetzliche Regulierungsvorgaben
- 143–148 IV. Externe Effekte 143–148
- 148–149 V. Zusammenfassung der wichtigsten Ursachen von Marktversagen 148–149
- 149–151 D. Ableitung allgemeiner Grundsätze für die Regulierung von Unternehmensübernahmen 149–151
- 151–154 E. Zwischenergebnis 151–154
- 155–286 Kapitel 3: Analyse gesetzlicher Regulierungsvorgaben für Unternehmensübernahmen in Deutschland 155–286
- 155–160 A. Historische Entwicklung des Übernahmerechts 155–160
- 160–177 B. Allgemeine Grundsätze des WpÜG 160–177
- 160–166 I. Gleichbehandlungsgrundsatz, § 3 Abs. 1 WpÜG 160–166
- 1. Ökonomisch irrelevante Verteilungserwägungen
- 2. Fallenproblematik
- 3. Fazit
- 166–172 II. Informationsanspruch der Aktionäre der Zielgesellschaft, § 3 Abs. 2 WpÜG 166–172
- 1. Information als Gut
- 2. Enteignungsaspekt und Trittbrettfahrerproblematik
- 3. Reichweite einer Informationspflicht
- 4. Auslegung von § 3 Abs. 2 WpÜG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 WpÜG
- 172–173 III. Verpflichtung auf das Unternehmensinteresse der Zielgesellschaft, § 3 Abs. 3 WpÜG 172–173
- 173–174 IV. Schutz der Zielgesellschaft, § 3 Abs. 4 WpÜG 173–174
- 174–175 V. Verhinderung von Marktverzerrungen, § 3 Abs. 5 WpÜG 174–175
- 175–176 VI. Zwischenergebnis 175–176
- 176–177 VII. Gesamtbetrachtung von § 3 WpÜG 176–177
- 177–230 C. Gesetzliche Regulierungsvorgaben für den Bieter 177–230
- 177–183 I. Das Angebotsverfahren des WpÜG 177–183
- 1. Ablauf
- 2. Erste Einschätzung des Angebotsverfahrens
- a. Perspektive der Aktionäre der Zielgesellschaft
- b. Perspektive des Bieters
- 183–193 II. Informationspflichten des Bieters 183–193
- 1. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebotes, § 10 WpÜG
- 2. Veröffentlichung der Angebotsunterlage, § 11 Abs. 1 S. 1 WpÜG
- a. Inhalt des Angebotes, § 11 Abs. 2 S. 2 WpÜG (essentialia negotii)
- b. Ergänzende Angaben, § 11 Abs. 2 S. 3 WpÜG
- aa. Angaben zur Finanzierung, § 11 Abs. 2 S. 3 Nrn. 1 und 4 i.V.m. § 13 Abs. 1 S. 2 WpÜG
- bb. Angaben über die künftige Geschäftstätigkeit der Zielgesellschaft, § 11 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 WpÜG
- 3. »Wasserstandsmeldungen«, § 23 WpÜG
- 4. Zwischenergebnis
- 193–207 III. Vollangebotspflicht, § 32 WpÜG 193–207
- 1. Unregulierte Situation als Vergleichsmaßstab
- 2. Wirkungsweise einer Vollangebotspflicht
- 3. Rechtfertigung durch Korrektur von Marktversagen
- a. Fallenproblematik
- b. Ausbeutungsgefahr
- aa. Kalkül der Ertragsziehung des Kontrollaktionärs
- aaa. Soziale und private Erträge
- bbb. Entscheidungskalkül der privaten Ertragsziehung
- bb. Auswirkungen einer Vollangebotspflicht
- cc. Beurteilung alternativer Regelungsoptionen
- dd. Handlungsempfehlung
- 207–225 IV. Bestimmung der Gegenleistung, § 31 WpÜG 207–225
- 1. Mögliche Defekte in der Marktpreisbildung
- a. Theorie der konzentrationsfördernden Wirkung von Übernahmen infolge eines zu geringen Preises
- b. Corporate Asset Theorie
- c. Theorie des objektiven Gegenwertes
- d. Einschränkungen in der Entscheidungsfreiheit
- e. Informationsprobleme
- f. Fazit
- 2. Analyse der Vorgaben von § 31 WpÜG
- a. Bestimmung der angemessenen Gegenleistung, § 31 Abs. 1 S. 2, Abs. 7 WpÜG i.V.m. WpÜG-AngebotsVO
- aa. Bedeutung von Vorerwerben des Bieters, § 4 S. 1 WpÜG-AngebotsVO
- aaa. Regelung des § 4 S. 1 WpÜG-AngebotsVO
- bbb. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu §§ 305, 320b AktG
- ccc. Ökonomische Beurteilung
- bb. Rolle und Ermittlung des Referenzkurses, § 5 WpÜG-AngebotsVO
- b. Ergänzende »Höchstpreisregeln«, § 31 Abs. 4, 5 WpÜG
- c. Einschränkungen bezüglich der Art der Gegenleistung, § 31 Abs. 2, 3 WpÜG
- 3. Gesamteffekt von Preisregel und Vollangebotspflicht
- 225–228 V. Zwischenergebnis 225–228
- 228–230 VI. Gesamtbeurteilung der Auflagen für den Bieter 228–230
- 230–269 D. Gesetzliche Regulierungsvorgaben für die Zielgesellschaft 230–269
- 230–266 I. Beschränkungen bei der Abwehr feindlicher Übernahmeversuche 230–266
- 1. Verteidigungsmöglichkeiten im Überblick
- 2. Verhaltenspflichten für den Vorstand der Zielgesellschaft
- a. Die Regelungsproblematik im Überblick
- aa. Corporate Governance
- aaa. Prinzipal-Agenten-Problematik
- bbb. Perspektivenwechsel
- bb. Marktverzerrungen
- cc. Konflikt zwischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
- b. Richtlinienkompatible Regelungsalternativen für Verhaltenspflichten des Vorstandes der Zielgesellschaft
- aa. Das Optionsmodell der Übernahmerichtlinie
- bb. Das Spektrum der richtlinienkompatiblen Regelungsalternativen
- aaa. Auslegung Art. 9, 12 ÜRL
- bbb. Das Spektrum der Regelungsalternativen im Überblick
- cc. Einordnung von §§ 33 und 33a WpÜG
- c. Komparative Wirkungsanalyse wichtiger Regelungsalternativen
- aa. § 33a WpÜG
- aaa. Auswirkungen auf die Corporate Governance der Zielgesellschaft
- bbb. Auswirkungen auf den Markt für Unternehmensübernahmen
- ccc. Zwischenergebnis
- bb. § 33 WpÜG
- aaa. Auswirkungen auf die Corporate Governance der Zielgesellschaft
- (1) § 33 Abs. 1 S. 2 WpÜG
- (2) § 33 Abs. 2 WpÜG
- (3) Ad-hoc-Hauptversammlungen
- bbb. Auswirkungen auf den Markt für Unternehmensübernahmen
- ccc. Konflikt zwischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
- ddd. Zwischenergebnis
- cc. Delegation auf Satzungsebene
- aaa. Auswirkungen auf die Corporate Governance der Zielgesellschaft
- bbb. Auswirkungen auf den Markt für Unternehmensübernahmen
- ccc. Zwischenergebnis
- dd. Vergleich der Regelungsalternativen
- ee. Handlungsempfehlung
- 3. Offenlegung von Übernahmehindernissen, § 289 Abs. 4 HGB
- 266–267 II. Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrates der Zielgesellschaft, § 27 WpÜG 266–267
- 267–269 III. Zwischenergebnis 267–269
- 269–278 E. Gesetzliche Regulierungsvorgaben nach erfolgter Übernahme 269–278
- 269–276 I. Squeeze-out 269–276
- 1. Aktienrechtlicher Squeeze-out, §§ 327a ff. AktG
- a. Verhinderung opportunistischer Anfechtungsklagen
- b. Kompensation der ausscheidenden Aktionäre
- c. Zwischenergebnis
- 2. Übernahmespezifischer Squeeze-out, § 39a WpÜG
- 276–278 II. Sell-out, § 39c WpÜG 276–278
- 278–286 F. Gesamtbeurteilung der gesetzlichen Regulierungsvorgaben für Unternehmensübernahmen 278–286
- 278–284 I. Gesamtbetrachtung der Regulierungsvorgaben des WpÜG 278–284
- 1. Gesamtwirkung der untersuchten Regelungskomplexe
- 2. Vergleich mit den abgeleiteten ökonomischen Grundsätzen für eine Regulierung von Unternehmensübernahmen
- 3. Vergleich mit den vom Gesetzgeber genannten Zielen
- 284–285 II. Gesamtbetrachtung der Umsetzung der Übernahmerichtlinie 284–285
- 285–286 III. Handlungsempfehlungen 285–286
- 287–290 Ergebnis 287–290
- 291–297 Anhang I: Marktversagen infolge Moral Hazard (formaler Nachweis) 291–297
- 291–294 I. Situation bei vollständiger Infomation 291–294
- 294–297 II. Situation bei asymmetrischer Information (Moral Hazard) 294–297
- 298–318 Anhang II: Spieltheoretische Betrachtung von Fallenproblematik und zwingenden Geboten 298–318
- 298–300 I. Das spieltheoretische Gefangenendilemma 298–300
- 300–300 II. Entscheidungssituation in der Fallenproblematik 300–300
- 300–318 III. Entscheidungssituation bei zwingenden Geboten 300–318