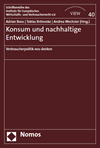Konsum und nachhaltige Entwicklung
Verbraucherpolitik neu denken
Zusammenfassung
Was genau verstehen wir unter nachhaltigem Konsum und wie kann dieser realisiert werden? Im vorliegen-den Band fragen sich die Autor*innen, ob Nachhaltigkeit in einer Konsumgesellschaft überhaupt möglich ist und sind sich einig, dass es ein weiter so nicht geben kann. Mehr als zwanzig Artikel diskutieren unterschiedliche Gesichtspunkte, aufgeteilt in die vier Oberthemen des aktuellen Diskussionsstands, der freien Wahl der Konsumierenden, der Verbraucherkompetenzen und der praktischen Umsetzung bzw. möglicher Anreize zur Verhaltensänderung. Die Autor*innen sind sich einig, dass weitere Forschung auf Verbraucherebene vonnöten ist, um die Hintergründe nachhaltigen Konsums besser zu verstehen. Der vorliegende Band gibt aber einen umfangreichen Überblick über den Stand verschiedener Diskussionsstränge wie bspw. dem Zusammenspiel von Effizienz und Suffizienz und versammelt spannende Beiträge von Autor*innen der unterschiedlichsten Disziplinen zum Thema „Konsum und Nachhaltige Entwicklung: Verbraucherpolitik neu denken“. Mit Beiträgen von Tobias Brönneke, Mario Schmidt, Angelika Zahrnt, Hubertus Primus, Jürgen Stellpflug, Stephan Lorenz, Angela Häußler, u.v.m.
Schlagworte
Keywords
- 17–82 Kapitel 1: Konsum und Nachhaltige Entwicklung – die aktuelle Diskussion 17–82
- 17–26 Nachhaltiger Konsum – Ein Spannungsfeld zwischen individuellen Verbraucherinteressen und Sustainibility-Anforderungen 17–26
- 1. Konsum als Ausdruck grundrechtlich geschützter freier Selbstbestimmung
- 2. Gemeinschaftsgebundenheit individueller Rechte als Ausgangspunkt für Verbraucherschutzregeln
- 3. Der Schutz der natürlichen Commons begrenzt die individuelle (Konsum-)Freiheit
- 4. Mangelnde Transparenz behindert verantwortliche Konsumentscheidungen
- 5. Kategorischer Imperativ des nachhaltigen Konsums
- Literaturverzeichnis
- 27–44 Effizienz als Grundvoraussetzung für nachhaltigen Konsum 27–44
- 1. Einleitung
- 2. Effizienz: eine Definition
- 3. Der schwierige Begriff des Nutzens
- 4. Der Reboundeffekt
- 5. Beispiel IT und Industrie 4.0
- 6. Das Beispiel Lebensmittelverschwendung
- 7. Die Notwendigkeit von Effizienzmaßnahmen
- 8. Blick auf das Langfristziel
- 9. Fazit
- Literaturverzeichnis
- 45–56 Nachhaltiger Konsum fordert Suffizienz 45–56
- 1. Effizienz und Suffizienz
- 2. Warum brauchen wir neben der Effizienz auch die Suffizienz?
- 3. Warum brauchen wir Suffizienzpolitik?
- 4. Orientierung am rechten Maß
- 5. Handlungsfeld „Ermöglichen“
- Bildungspolitik
- Arbeitszeitpolitik
- Gesundheitspolitik
- 6. Verbraucherpolitik
- 7. Zur Umsetzung von Suffizienzpolitik
- 8. Der BUND und die Suffizienzpolitik
- Literaturhinweise
- 57–68 Nachhaltiger Konsum – eine Aufgabe für vergleichende Warentests? 57–68
- 1. Die Möglichkeiten und die Grenzen
- 2. Reise zu den Ursprüngen der Produkte – CSR-Tests
- 3. Informationen zur Nachhaltigkeit aus dem klassischen Warentest
- 4. Reparieren oder Wegwerfen?
- So sind wir vorgegangen
- 4.1 Staubsauger: Reparieren lohnt sich selten
- 4.2 Kaffeeautomaten: Reparieren lohnt sich
- 4.3 Waschmaschinen: Reparieren der Umwelt zuliebe
- 69–82 Was bedeutet nachhaltiger Konsum für Finanzdienstleistungen? 69–82
- 1. Einleitung
- 2. Was ist nachhaltiger Konsum?
- 3. Gibt es nachhaltigen Konsum in relevanter Größenordnung?
- 4. Was sind nachhaltige Finanzdienstleistungen?
- 5. Sind nachhaltige Finanzdienstleistungen verfügbar?
- 6. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- 83–152 Kapitel 2: Die freie Wahl der Konsumierenden 83–152
- 83–94 Essay - Wahlfreiheit und nachhaltiger Konsum Gestaltungsoptionen zwischen Konsumalternativen, Konsumismus und sozialer Ausgrenzung 83–94
- 1. Zur Bedeutung von Wahlfreiheit in der Überflussgesellschaft
- 2. Nachhaltige Alternativen wählen
- 3. Konsumdynamiken – oder nachhaltige Entwicklung durch Begrenzung der Wahlfreiheit?
- 4. Ausgrenzungen – oder erweiterte Wahlmöglichkeiten in der sozialen Nachhaltigkeitsdimension?
- 5. Fazit
- Literaturverzeichnis
- 95–106 Die Welt verändern mit dem Einkaufskorb? – Verbraucherverantwortung für nachhaltigen Konsum 95–106
- 1. Ausgangssituation
- 2. Verbraucherinnen und Verbraucher im Rahmen der Alltagsversorgung
- 3. Verbraucherinnen und Verbraucher als Marktteilnehmer*innen
- 4. Verbraucherinnen und Verbraucher als soziale Akteur*innen
- 5. Verbraucherinnen und Verbraucher als Bürger*innen
- 6. Fazit
- Literaturverzeichnis
- 107–120 Insights zum nachhaltigen Konsum von Körperpflegeprodukten 107–120
- Zusammenfassung
- 1. Einführung
- 2. Nachhaltigeren Konsum aus Konsument*innensicht verstehen, ein qualitativer Forschungsansatz
- 3. Insights zum Konsum nachhaltigerer Körperpflegeprodukte
- 4. Diskussion und Implikationen
- 5. Schlussfolgerungen
- Literaturverzeichnis
- 121–136 Essay - Nachhaltigkeitslabel im Textilbereich unter der Lupe 121–136
- 1. Einsturz einer Textilfabrik – Soziale Missstände werden offenkundig
- 2. Was sagen Textillabel aus? Und wie können sie nachhaltigen Konsum unterstützen?
- 3. Vertrauenswürdige Textillabel konkret
- 4. Ein konstruktiv-kritischer Blick auf aktuelle Entwicklungen in Politik und Wirtschaft
- 5. Fazit
- Literaturverzeichnis
- 137–152 Essay - Nicht-nachhaltiges Konsumverhalten Eine Frage der Leistungsfähigkeit von Konsumierenden und Allgemeinheit? 137–152
- 1. Einleitung
- 2. Problembeschreibung und Rahmenbedingungen
- 2.1. Ökonomische Rahmenbedingungen
- 2.1.1. Der Kaufpreis ist nicht die ganze Wahrheit
- 2.1.2. Die Verzerrung der Wirklichkeit
- 2.1.3. Geld - ist immer da
- 2.1.4. Angebot, Nachfrage und Wirtschaftswachstum – Produzieren für die Müllhalde?
- 2.2. Gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen
- 2.2.1. Lebensstil und Lebensstandard
- 2.2.2. Markenqualität und Wertschätzung
- 2.2.3. Funktionen von Konsum; Rolle der Werbung
- 2.2.4. Stellenwert von Eigentum
- 2.2.5. Schützt das Gesetz die jugendlichen Käufer?
- 2.3. Irreversibilität der Folgen
- 2.3.1. Grundsatz der Naturalrestitution
- 2.3.2. Kompensationsmöglichkeiten
- 2.3.3. Zuschreibung von Verantwortlichkeiten
- 3. Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
- 153–248 Kapitel 3: Verbraucherkompetenzen in der Entwicklung 153–248
- 153–172 Funktionsfähigkeitsgarantie als Herstellergarantieaussagepflicht: wirksames Instrument gegen vorzeitigen Verschleiß 153–172
- 1. Einleitung und Hinführung zum Thema
- 2. Die Funktionsfähigkeit des Produktes als Ausgangspunkt für den Garantiefall
- 3. Einschränkbarkeit der Funktionsfähigkeitsgarantie
- 3.1 Keine Einschränkbarkeit der Garantie vor Auslauf der Mängelgewährleistungsfrist
- 3.2 Einschränkbarkeit der Garantie ab Ende der Mängelgewährleistungsfrist
- 4. Garantieaussagen neben der gesetzlich typisierten Funktionsgarantie?
- 5. Ein konkreter Regelungsvorschlag
- Literaturverzeichnis
- 173–184 Financial Literacy und Verbraucherkompetenz: Ein unzertrennliches Begriffspaar? 173–184
- 1. Einleitung
- 2. Methode: Ein Experiment zu Verbraucherentscheidungen im Bereich Finanzen
- 2.1. Messung der Financial Literacy
- 2.2. Entscheidungsprobleme aus dem Bereich Verbraucherfinanzen
- 2.2.1. Basisdesign
- 2.2.2. Verbraucherinformationen
- Treatment 1: Begriffserläuterungen
- Treatment 2: Begriffserläuterungen und Produktempfehlungen
- 2.3. Durchführung
- 3. Ergebnisse
- 3.1. Financial Literacy und die Nachfrage nach Verbraucherinformationen
- 3.2. Financial Literacy und der Umgang mit Produktempfehlungen
- 4. Diskussion und Fazit
- Literaturverzeichnis
- 185–202 Essay - Davids gegen Goliath – Der Diesel- Skandal, die Möglichkeit von Sammelklagen und der Marktkontrolle 185–202
- 1. Obsoleszenz und Rechtsdurchsetzung
- 2. „Diesel-Gate“
- 3. EU-Richtlinien-Vorschlag
- 4. Gesamtvergleich und Verbandsklage in den Niederlanden
- 5. Aus Österreich nichts Neues
- 6. Musterfeststellungsklage in Deutschland
- 7. Fazit zur Rechtsdurchsetzung bei Massenschäden
- Literaturverzeichnis
- 203–226 Geplante Obsoleszenz bei Lebensmitteln – ein Korrektiv der Verantwortung von Verbrauchern für Lebensmittelabfälle? 203–226
- 1. Einleitung und Hinführung zum Thema
- 2. Besonderheiten von Lebensmitteln
- 3. Ursachen für Lebensmittelabfälle
- 4. Verantwortliche Akteure für Lebensmittelabfälle
- 5. Obsoleszenz bei Lebensmittel – Ergebnisse der Expertenbefragung
- 5.1. Relevanz des Themas
- 5.2. Verantwortung für Obsoleszenz bei Lebensmitteln
- 5.3. Divergenz der Verbraucherrolle in Einzelstatement
- 6. Divergenz der Verbraucherrolle in Einzelstatement
- Literaturverzeichnis
- 227–234 Überprüfung der Echtheit von Lebensmitteln anhand genetischer Untersuchungen 227–234
- 1. Abstract
- 2. Einleitung
- 3. Materialien & Methoden
- 4. Ergebnisse
- 5. Diskussion
- Literaturverzeichnis
- 235–248 Arzneimittelrückstände im Wasser und Entsorgung von Arzneimitteln für Verbraucherinnen und Verbraucher – Herausforderungen und Aufgaben 235–248
- 1. Zusammenfassung
- 2. Empfehlungen der Verbraucherkommission
- I. Schaffung von Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher durch:
- II. Zukunftsorientierte Entwicklung der Trinkwasserreinigung und -aufbereitung:
- 3. Zur Situation und zur Begründung der Forderungen
- Vor welcher Situation stehen Verbraucherinnen und Verbraucher?
- Regulierung der Entsorgung von Altmedikamenten im privaten Bereich
- Deklaration auf Beipackzetteln
- Entsorgung von Altmedikamenten und Arzneimitteln über Apotheken
- Entsorgung von Altmedikamenten und Arzneimitteln über Abfallunternehmen
- Bestehende Abwasser-Reinigungsstufen hinterfragen
- 4. Empfehlungen der Verbraucherkommission
- I. Schaffung von Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher durch:
- II. Zukunftsorientierte Entwicklung der Trinkwasserreinigung und -aufbereitung
- Literaturverzeichnis
- 249–348 Kapitel 4: Nudges und Reallabore für Verbraucherpolitik 249–348
- 249–268 Nudges für eine Nachhaltige Ernährung in Kommunen: Ein Praxis-Werkzeug 249–268
- 1. Nudging for Good Food: nachhaltige Ernährung in Kommunen
- 2. Verhaltensbasierte Ernährungspolitik: Konzepte und Erkenntnisse
- 3. Ein Praxiswerkzeug für die KERNiG Kommunen
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- 269–290 Wie „automatisch grün“ ist der deutsche Energiemarkt? Grüne Defaults revisited 269–290
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Hintergründe
- A. Verhaltensökonomik
- B. Verhaltenspolitik und Nudging
- C. Förderung von nachhaltigem Konsum durch „grüne Nudges“
- D. Grüne Defaults und aktive Wahl
- 3. Systematischer Literaturreview zu grünen Defaults und aktiver Wahl
- A. Grüne Defaults im Energiebereich
- B. Defaults vs. aktive Wahl
- 4. Erhebung des Status Quo bei Energieanbietern
- A. Grundversorgung
- B. Grüner Default in der Grundversorgung
- 5. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- 291–316 Kann man Nudging trauen? – Wie man in Baden-Württemberg über verhaltensbasierte Stimuli denkt 291–316
- 1. Verhaltenspolitik und Nudges
- 2. Eine Frage der Empirie
- 3. Die Studie
- Sample und Erhebungsinstrument
- Datenanalyse
- Ergebnisse
- 4. Implikationen für die Politik
- Literaturverzeichnis
- 317–338 Vielleicht ist es ganz anders! – Nachhaltigkeit und Konsum systemisch aufgestellt 317–338
- 1. Erkenntnisinteresse
- 2. Methode der Systemaufstellung
- 3. Steckbrief der Aufstellung des Konsumsystems
- 4. Elemente
- 5. Ablauf der Aufstellung
- 6. Strukturbilder
- Phase 1: Das System entsteht
- Phase 2: Blaue Bewusstseinsstufe
- Phase 3: Orange Bewusstseinsstufe
- Phase 4: Grüne Bewusstseinsstufe
- Phase 5: Gelbe Bewusstseinsstufe
- 7. Schlussbetrachtung und erkenntnisleitende Hypothesen
- Literaturverzeichnis
- 339–344 Projektbericht Reallabor Space Sharing - Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Raum 339–344
- 1. Flächen teilen – Space Sharing zur Nutzungsintensivierung des Gebäudebestandes
- 2. Das Reallabor Space Sharing, Stuttgart
- 3. Das Potential von Space Sharing
- 4. Space Sharing-Report: Handbuch und Erfahrungsbericht
- 345–348 Schlusswort: Konsum und nachhaltige Entwicklung als Forschungsfeld der Verbraucherwissenschaften 345–348
- Literaturverzeichnis