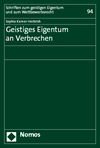Geistiges Eigentum an Verbrechen
Zusammenfassung
Gibt es geistiges Eigentum an Verbrechen? Darf ein Straftäter die von ihm verübte Tat öffentlichkeitswirksam vermarkten? Zur interessengerechten Auflösung des daraus folgenden Konflikts mit den persönlichkeitsrechtlichen Interessen des Opfers entwickelt die Autorin ein praxisgerechtes Prüfungskonzept für die rechtliche Beurteilung. Neben einer umfangreichen Auswertung der Rechtsprechung zur Vermarktung von Sachverhalten mit Realitätsbezug findet eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Rechtsfolgen einer Verletzung des Opferpersönlichkeitsrechts durch Straftatvermarktungen statt. Die für die deutsche Rechtslage gewonnenen Erkenntnisse werden durch eine rechtsvergleichende Betrachtung des U.S.-amerikanischen Rechts ergänzt.Die Autorin war als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht der Technischen Universität Dresden beschäftigt und ist nun im Bereich der Vollzugsleitung einer Justizvollzugsanstalt tätig.
Schlagworte
- 27–32 Einleitung und Gang der Untersuchung 27–32
- 33–76 1. Kapitel Rechtslage und Forschungsstand 33–76
- I. Ausgangspunkt
- 1. Geiselnahme von Gladbeck
- 2. Fall Böttcher
- 3. Fall Meiwes
- 4. Fall Gäfgen
- II. Gesetzeslage
- 1. Das Opferanspruchssicherungsgesetz
- a) Verfassungsmäßigkeit
- b) Problemkonstellationen innerhalb einzelner Normen
- c) Zusammenfassung
- 2. Das Kunsturhebergesetz
- a) Persönlichkeitsbild als Bildnis i.S.d. § 22 KUG?
- b) Zusammenfassung
- 3. Das Namensrecht
- 4. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
- a) Schutzinhalt
- (1) Sphärentheorie
- (2) Schutzbereichstheorie
- (3) Abgestuftes Schutzkonzept
- (4) Rahmendefinition und Interessenabwägung
- (5) Zusammenfassung
- b) Einschränkungen
- (1) Meinungsäußerungsfreiheit
- (2) Rundfunkfreiheit
- (3) Filmfreiheit
- (4) Kunstfreiheit
- c) Postmortaler Persönlichkeitsschutz
- III. Meinungsstand in der Literatur
- 1. Sittenwidrigkeit der Vermarktungsverträge
- 2. Ablehnung der zeitgeschichtlichen Bedeutung des Opfers
- 3. Gemeinfreiheit abstrakter Ereignisse
- 4. Fehlender Opferschutz als Folge unzureichender Beachtung des Täterpersönlichkeitsrechts
- 5. Verwertungsmonopol des Staates
- 6. Rückbesinnung auf Standesrecht
- 7. Kritische Würdigung
- IV. Rechtsprechung
- 77–124 2. Kapitel Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Literatur 77–124
- I. Verfälschung des Lebensbilds Verstorbener
- 1. Relevante Entscheidungen
- a) »Mephisto – Roman einer Karriere«
- (1) Entscheidung des BVerfG
- (2) Sondervoten
- b) »Ende einer Nacht«
- 2. Zusammenfassung
- II. Unerwünschte Verarbeitung zu einer literarischen Figur
- 1. Relevante Literaturverbotsverfahren vor »Esra«
- a) »Barfuß im Sand«
- b) »Wilsberg und der tote Professor«
- c) »Meere«
- 2. »Esra«
- a) Entscheidung des BVerfG
- b) Sondervoten
- 3. Zusammenfassung
- a) Erkennbarkeit
- b) Interessenabwägung
- (1) Nahegelegter Wirklichkeitsbezug
- (2) Intensität der Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung
- III. Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Biografien
- 1. Relevante Entscheidungen
- a) »Ein ganz gewöhnliches Leben«
- b) »Havemann«
- 2. Zusammenfassung
- IV. Persönlichkeitsrecht und Meinungsäußerung durch Literatur
- 1. Entscheidungen des BGH
- a) »Moritat auf Helmut Hortens Angst und Ende«
- b) »Hexenjagd: Mein Schuldienst in Berlin«
- 2. Relevante obergerichtliche Entscheidungen
- a) »Unsere Siemens-Welt«
- b) »Die Hexenjagd«
- c) »Pestalozzis Erben«
- 3. Zusammenfassung
- V. Systematisierende Betrachtung unter Berücksichtigung der Straftatvermarktung
- 1. Ausgangslage
- 2. Prüfungsmodell
- a) Tatbestand: Erkennbarkeit
- b) Rechtswidrigkeit: Interessenabwägung
- (1) Nahegelegter Wirklichkeitsbezug
- (a) Dokumentation und Biografie
- (b) Dokufiktion
- (c) Fiktion
- (2) Risikoabwägung
- (a) Risikosetzung
- (b) Risikobewertung
- 3. Anwendung auf die Straftatvermarktung
- 125–166 3. Kapitel Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Filme 125–166
- I. Darstellung zeitgeschichtlicher Ereignisse
- 1. Relevante Entscheidungen
- a) »Der Fall Angelika – Ein Schicksal im Schatten der deutschen Teilung«
- b) »Das Mädchen Olivia«
- c) »Contergan«
- (1) Entscheidung des BVerfG
- (2) Entscheidung des OLG Hamburg
- d) »Der Baader-Meinhof-Komplex«
- (1) Verfahren der Tochter Meinhof
- (2) Verfahren der Witwe Ponto
- 2. Zusammenfassung
- II. Darstellung von Verbrechen
- 1. »Lebach«
- a) »Der Soldatenmord von Lebach«
- b) »Verbrechen, die Geschichte machten – Der Fall Lebach (1969)«
- 2. »Rohtenburg«
- a) Entscheidung des BGH
- b) Entscheidung des BVerfG
- 3. Weitere Entscheidungen
- a) »Aus nichtigem Anlass?«
- b) »Kommissarin Lucas – Das Verhör«
- 4. Zusammenfassung
- III. Systematisierende Betrachtung unter Berücksichtigung der Straftatvermarktung
- 1. Gemeinfreiheit abstrakter Ereignisse
- 2. Prüfungsmodell
- a) Erkennbare Darstellung des äußeren Erscheiungsbilds einer Person
- (1) Bildnis im Sinne des § 22 S. 1 KUG
- (2) Einschränkungen gemäß § 23 Abs. 1 KUG
- (a) § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG
- (b) § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG
- (3) Berechtigte Interessen des Abgebildeten gemäß § 23 Abs. 2 KUG
- (a) Film als Kunstwerk im Sinne des Art. 5 Abs. 3 GG
- (b) Genretypische Eingriffstiefe
- (c) Weitere Kriterien
- b) Erkennbarkeit aus den Umständen, Darstellung eines Persönlichkeitsbilds
- (1) Tatbestand: Erkennbarkeit
- (2) Rechtswidrigkeit: Interessenabwägung
- (a) Nahegelegter Wirklichkeitsbezug
- (b) Medienspezifische Wirkungsintensität
- (c) Risikoabwägung
- 3. Anwendung auf die Straftatvermarktung
- 167–182 4. Kapitel Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Theaterstücke 167–182
- I. »Ehrensache«
- 1. Entscheidung des BVerfG
- 2. Entscheidung des BGH
- 3. Zusammenfassung
- II. Systematisierende Betrachtung unter Berücksichtigung der Straftatvermarktung
- 1. Erkennbare Darstellung des äußeren Erscheinungsbilds einer Person
- a) Theaterstück als Kunstwerk im Sinne des Art. 5 Abs. 3 GG
- b) Genrespezifische Eingriffstiefe
- c) Weitere Kriterien
- 2. Erkennbarkeit aus den Umständen, Darstellung eines Persönlichkeitsbilds
- a) Tatbestand: Erkennbarkeit
- b) Rechtswidrigkeit: Interessenabwägung
- (1) Nahegelegter Wirklichkeitsbezug
- (2) Medienspezifische Wirkungsintensität
- (3) Risikoabwägung
- 3. Anwendung auf die Straftatvermarktung
- 183–198 5. Kapitel Persönlichkeitsrecht und Exklusivvermarktung 183–198
- I. Relevante Entscheidungen
- 1. »Lengede«
- 2. »Exklusivinterview nach Haftentlassung«
- 3. Interviews mit Inhaftierten
- a) »Interview in Auslieferungshaft«
- b) »Interview mit Untersuchungsgefangenem bei Verdunkelungsgefahr«
- c) »Fernsehinterview mit inhaftierter Mörderin«
- II. Systematisierende Betrachtung unter Berücksichtigung der Straftatvermarktung
- 1. Vertragsgegenstand
- a) Schuldrechtlicher Ansatz
- b) Verfügungsrechtlicher Ansatz
- 2. Wirksamkeit des Vertrages
- a) Verschließen einer Informationsquelle
- b) Kollision mit Persönlichkeitsrechten Dritter
- 3. Besonderheiten bei Interviews mit Inhaftierten
- a) Interviews mit Untersuchungshäftlingen
- b) Interviews mit Strafgefangenen
- 199–246 6. Kapitel Isolierte Betrachtung der Vermarktung von Straftaten 199–246
- I. Konfliktlage
- 1. Kommerzialisierbarkeit von Einzelheiten aus der Privatsphäre
- a) Traditionelle Auffassung
- b) Dualistischer Ansatz
- c) Monistischer Ansatz
- d) Kritische Würdigung
- 2. Betroffene Rechtspositionen
- a) Das Verfügungsrecht über die Darstellung der eigenen Person
- b) Weiterentwicklungen in der Literatur
- c) Zusammenfassung
- II. Lösungsweg
- 1. Das »Ob« der Straftatvermarktung
- a) Grundsatz
- b) Ausnahmen
- (1) Straftat als Ereignis der Zeitgeschichte
- (2) Figur als Beiwerk einer Gesamtdarstellung
- (3) Vermarktungsergebnis als Kunstwerk
- c) Zusammenfassung
- 2. Das »Wie« der Straftatvermarktung
- a) Akzessorietät der Persönlichkeitsrechte von Täter und Opfer
- (1) Berichterstattung über Straftaten
- (a) Berichterstattung über verurteilte Straftäter
- (b) Verdachtsberichterstattung
- (2) Online-Archive und »Recht auf Vergessenwerden«
- (a) Zulässigkeit des Bereithaltens identifizierender Altmeldungen in Online-Archiven
- (b) Vereinbarkeit mit einem »Recht auf Vergessenwerden«
- (3) Ergebnis
- b) »Fair Use« geschützter Informationen
- (1) Bestimmung von »Fair Use« zugunsten der Medien
- (2) Übertragbarkeit auf die Straftatvermarktung
- c) Verzichtstheorie
- (1) Begriff
- (2) Anwendung auf die Straftatvermarktung
- d) Hilfskriterien im Rahmen der Abwägung
- (1) Modellhaftigkeit der Darstellung
- (2) Anerkennenswerte Zielsetzung des Täters
- (3) Weitere Kriterien
- 3. Ergebnis
- 247–306 7. Kapitel Rechtsfolgen 247–306
- I. Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu Lebzeiten
- 1. Anspruch auf Unterlassung
- 2. Anspruch auf Gegendarstellung, Berichtigung und Widerruf
- 3. Anspruch auf Ersatz materiellen Schadens
- a) Anspruchsvoraussetzungen
- b) Schadensermittlung
- (1) Entwicklung der Rechtsprechung
- (2) Anwendbarkeit auf die Vermarktung der Privatsphäre Unbekannter
- c) Anspruchshöhe
- 4. Anspruch auf Bereicherungsausgleich
- a) Anspruchsvoraussetzungen
- b) Anwendbarkeit auf die Vermarktung der Privatsphäre Unbekannter
- c) Anspruchshöhe
- 5. Anspruch auf Gewinnherausgabe
- 6. Anspruch auf Geldentschädigung
- a) Dogmatische Grundlage und Funktion
- b) Anspruchsvoraussetzungen
- c) Anspruchshöhe
- 7. Verhältnis der Ansprüche zueinander
- 8. Sicherung der Ansprüche durch § 1 OASG
- II. Postmortaler Persönlichkeitsschutz
- 1. Ansprüche auf Unterlassung, Gegendarstellung, Beseitigung und Widerruf
- 2. Ausgleichsansprüche wegen postmortaler Verletzung vermögenswerter Persönlichkeitsrechtsbestandteile
- a) Ansprüche auf Ersatz materiellen Schadens und Bereicherungsausgleich
- (1) Voraussetzungen des Anspruchs auf Ersatz materiellen Schadens
- (2) Voraussetzungen des Anspruchs auf Bereicherungsausgleich
- (3) Zuerkennung der Ansprüche im Falle der Vermarktung vermögenswerter Persönlichkeitsrechtsbestandteile verstorbener Privatpersonen
- (a) »Postmortaler Persönlichkeitsschutz«
- (b) »Unfalltote«
- (c) Kritische Würdigung
- (d) Ergebnis
- b) Anspruch auf Gewinnherausgabe
- c) Schutzdauer
- 3. Verhältnis der Ansprüche zueinander
- 4. Ausgleichsansprüche wegen postmortaler Verletzung ideeller Persönlichkeitsinteressen
- a) Geldentschädigungsanspruch des Verstorbenen
- b) Geldentschädigungsanspruch der Hinterbliebenen
- (1) Vererblichkeit des Geldentschädigungsanspruchs
- (2) Andenkenschutzlehre
- c) Ansprüche der Hinterbliebenen auf Bereicherungsausgleich oder Gewinnherausgabe
- (1) Anspruchsvoraussetzungen
- (2) Anspruchsberechtigung
- d) Schutzdauer
- 5. Sicherung der Ansprüche durch § 1 OASG
- III. Rechtsverfolgung und Prozesspublizität
- 1. Beschränkung der Prozesspublizität
- 2. Zulässigkeit der Publikation von Gerichtsentscheidungen
- 307–404 8. Kapitel Überblick über die Rechtslage in den USA 307–404
- I. Ausgangspunkt
- II. Rechtslage
- 1. Das First Amendment
- 2. Verfassungsrechtlicher Privatsphärenschutz
- 3. Das Right of Privacy
- a) Entstehung
- b) Die Fallgruppenbildung nach Prosser
- c) Grenzen
- d) Rechtsnatur
- 4. Das Right of Publicity
- a) Entstehung
- b) Inhalt
- (1) »Personal Names«
- (2) »Images of People«
- (3) »Personal Voice« und »Objects associated with a Person«
- c) Rechtsinhaber
- d) Grenzen
- e) Rechtsnatur
- 5. Verhältnis von Right of Privacy und Right of Publicity
- 6. Die Anti-Profit Statutes
- a) Entstehung
- b) Inhalt
- c) Verfassungsmäßigkeit
- III. »Speech-versus-Privacy-Conflicts«
- 1. »Autobiographical Speech and Information Privacy«
- a) Widerstreitende Rechtspositionen
- b) Lösungsansätze
- (1) »Property Right in Personal Information«
- (2) »Implied Contract or Duty of Confidentiality«
- (3) »Justified Disclosure«
- (a) »Legitimate Concern to the Public«
- (b) »Offensiveness«
- 2. »Fiction and Docudrama«
- a) Konfliktkonstellationen
- b) Lösungsansätze
- (1) Der New Yorker Sonderweg
- (2) Rechtsprechung in anderen Bundesstaaten
- (3) Der »Transformative Balancing Test«
- 3. »A Right to Be Forgotten?«
- a) Grundsatz
- (1) »Public Records«
- (2) »Information of Legitimate Concern to the Public«
- b) Ausnahmen
- (1) »Administrative Data Collections«
- (2) »Expansion of Privacy Rights Through the Use of Publicity Rights«
- IV. Postmortaler Persönlichkeitsschutz
- 1. »Anti-Postmortem Rule for Rights of Privacy«
- 2. »Postmortem Right of Publicity«
- V. Rechtsfolgen
- 1. Anspruch auf Unterlassung
- a) Anspruchsvoraussetzungen
- b) Grenzen
- 2. Anspruch auf Schadensersatz
- a) Schadensersatzanspruch wegen Verletzung des Right of Privacy
- b) Schadensersatzanspruch wegen Verletzung des Right of Publicity
- c) »Punitive Damages«
- 3. Rechtsverfolgung und Prozesspublizität
- VI. Rechtsvergleichendes Resümee
- 1. Grundprinzipien
- a) Prinzip Würde versus Prinzip Freiheit
- b) Einzelfallabwägung versus Regelorientierung
- c) Rechtsbehelfsvielfalt versus Vorrang repressiven Rechtsschutzes
- 2. Mediale Vermarktung von Straftaten
- a) Kommerzielle Verwertung von Einzelheiten aus der Privatsphäre Dritter
- b) Zulässigkeit der Vermarktung
- c) Inhalt und Umfang der Vermarktung
- 405–414 Zusammenfassung der Ergebnisse 405–414
- I. Normativer Rahmen und Meinungsstand in der Literatur
- II. Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Literatur
- III. Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Filme
- IV. Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Theaterstücke
- V. Persönlichkeitsrecht und Exklusivvermarktung
- VI. Prüfungskonzept für die Vermarktung von Straftaten
- VII. Rechtsfolgen
- VIII. Rechtslage in den USA
- IX. Rechtsvergleich
- 415–434 Literaturverzeichnis 415–434