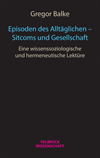Episoden des Alltäglichen - Sitcoms und Gesellschaft
Eine wissenssoziologische und hermeneutische Lektüre
Zusammenfassung
Die Populärkultur hat mit der Sitcom ein eigentümliches Genre im Fernsehen etabliert. Während Fernsehserien oft hinausblicken in jene Bereiche, die sich zum Teil drastisch von der Lebenswelt des Zuschauers unterscheiden, widersetzt sich die Sitcom seit über einem halben Jahrhundert dieser Blickrichtung. Stattdessen lenkt sie die populärkulturelle Aufmerksamkeit auf Themen, die diesseits unseres lebensweltlichen Horizonts verortet sind und liefert Alltagsbeschreibungen in pointierter Form. Damit bündelt sie eine Fülle von gesellschaftlichen Relevanzen und situiert sie dort, wo sie zugleich ihr Publikum findet: zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Situation Comedies erweisen sich nicht nur deswegen als soziologische Erkenntnismittel, die – gerade weil es sich bei ihnen um Wirklichkeitskonstruktionen zweiter Ordnung handelt – normativ aufgeladene Bilder des Alltags zeigen. Im Genre der Sitcom wird dem Alltag als Sujet gleichsam ein medialer Ort innerhalb der Populärkultur zugewiesen.
Die damit einhergehenden soziologischen und medialen Facetten ergründet die vorliegende Studie – als erste deutschsprachige Monografie zu dem Thema – im Hinblick auf verschiedene Topoi wissenssoziologisch und hermeneutisch am Beispiel ausgewählter Sitcoms der zurückliegenden 20 Jahre. Als beeindruckend erweisen sich hierbei die tiefgreifenden und bildhaften Analysen der Sitcoms und ihre Rückbindungen an wissens-, kultur- und allgemeinsoziologische Erkenntnisse. Die Sitcom erscheint als Unterhaltungsformat, das nicht nur Alltagsgeschichten erzählt, sondern die Produktions- und Rezeptionsbedingungen dieser Geschichten immer auch mit erzählt. Es handelt sich mithin um mediale Artefakte, die gleichsam als unterhaltsame Mittel gesellschaftlicher Wahrnehmung und medialer Selbstwahrnehmung auftreten. Angelegt als qualitative Studie an der Schnittstelle von Medien- und Sozialwissenschaften, fügt das Buch dem gegenwärtigen Diskurs um Populärkultur, Fernsehserien und Kulturwissenschaften eine soziologisch fundierte Perspektive hinzu, die für Sozial- und Medienwissenschaftler ebenso anregend ist wie für jene, die mit besonderem Augenmerk auf die gegenwärtige akademische Rezeption von TV-Serien schauen – kenntnisreich dargelegt in einer klaren und zugänglichen Sprache.
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–136 TEIL A Vorbetrachtungen zur Unterhaltungskultur 9–136
- 9–38 I. Einleitung 9–38
- 1) Von der Wesentlichkeit des Beiläufigen oder: eine Soziologie der medialen Zwischentöne
- 2) Populärkultur als Untersuchungsgegenstand
- 3) Schwerpunktsetzungen und Herangehensweise
- 4) Aufbau der Arbeit
- 39–86 II. Unterhaltung, Fernsehserien und Gesellschaft 39–86
- 1) Unterhaltung und Kulturindustrie
- 2) Fernsehen – Anmerkungen zur gegenwärtigen Fabrikation von Unterhaltung
- 3) Die Fernsehkultur in den USA
- 4) Fernsehserien – Allgemeine Annäherungen an eine Kultur der seriellen Narrative
- 5) Serien als narrative Kultur
- 6) Populärkultur als gesellschaftlicher Gradmesser
- 87–136 III. Die Sitcom – Methode, Geschichte, Definition 87–136
- 1) Methodische Anmerkungen
- 2) Eine kurze Geschichte der Sitcom – Von den historischen Vorläufern bis zur Etablierung als eigenständiges Unterhaltungsformat
- 3) Die Sitcom – Eine Definition
- 4) Exkurs: Quality-Television
- 137–294 TEIL B Sitcoms – Erzählungen von Alltag, Liebe und Fernsehen 137–294
- 137–202 I. Situation Comedy – Konturen zum Auftakt der weiteren Betrachtung 137–202
- 1) Die Sitcom als Narrativ von Ordnung und Ambivalenz
- 2) Inszenierte Lebensweisen – Der Alltag in der Sitcom
- a) Wohnen – Zur Differenz von Innen und Außen
- b) Fernsehen – Zur Alltäglichkeit von Unterhaltung
- 203–282 II. Sitcoms als populärkulturelle Diskurse über das Zusammenleben zu zweit 203–282
- 1) Einleitung
- 2) Die Zweierbeziehung als normativer Lebensentwurf
- 3) Zweierbeziehungen im Kontext publikumswirksamer Sitcoms
- a) Figurenkonstellationen – Elternschaft, Ehe und Zweierbeziehungen
- b) Sex im Alltag – Sitcoms als Erzählungen intimer Begegnungen
- c) Die Zweierbeziehung als Verhandlungsort
- d) Das Wir als übergeordneter Bezugspunkt für die Zweierbeziehung
- e) Der Konsum der Romantik in der Sitcom
- 4) Fazit: Die alltägliche Ordnung des Glücks
- 283–294 III. Die Sitcom als Narrativ über das Glück im Alltag – Ein Zwischenfazit 283–294
- 295–612 Teil C Zwischen fragwürdiger Alltäglichkeit und medialer Selbstbetrachtung – Reflexivität als Unterhaltungsmittel in Seinfeld, Curb your Enthusiasm und 30 Rock 295–612
- 295–302 I. Einleitung 295–302
- 303–306 II. Ironie und Reflexivität 303–306
- 307–312 III. Reflexivität in der Gesellschaft 307–312
- 313–322 IV. Reflexivität in Film und Fernsehen 313–322
- 323–482 V. Seinfeld – Humoristische Konturen des alltäglichen Zusammenlebens 323–482
- 1) Jerry Seinfeld ist Jerry Seinfeld in der Sitcom Seinfeld – Eine Einleitung
- 2) Exkurs: Judentum, Moderne und die Großstadt
- a) Einleitung
- b) Die Juden als gesellschaftliche Außenseiter
- c) Die Großstadt – Kulminationspunkt von Fremdheit, Urbanität und jüdischer Identität
- d) Jüdischer Humor und amerikanische Lebenswelten
- 3) Die soziale Verankerung der Protagonisten
- 4) Seinfeld und die Dekonstruktion intimer Beziehungen
- 5) Gesellschaft als Problem – Alltag, Normen und die Frage: »What’s the deal with …«
- a) Einleitung
- b) Ambivalenz in Serie – Die Mehrdeutigkeit von sozialer Ordnung
- c) Das gesellschaftliche Normengefüge als Quelle von Ungewissheit und Mehrdeutigkeit
- d) Seinfeld als Phänomenologie des Alltags
- 6) Ungewissheit und Ausweglosigkeit als gesellschaftliche Topoi in Seinfeld
- 7) Der »Horror of Seinfeld« – Eine Sitcom im Kontext zeitgenössischer Kommentare
- 8) Exkurs: Ein Blick auf Seinfeld mit Charles Taylor
- 9) Jerry: »What is this? What are we doing? What in god’s name are we doing?« (7.1 »The Engagement«) – Reflexivität als konstitutive Form der Unterhaltung
- a) Einleitung
- b) Jerry – Die Sitcom in der Sitcom
- c) Das Ende von Seinfeld
- 483–516 VI. Curb your Enthusiasm – Larry David und die Abgründe des Alltags 483–516
- 1) Einleitung
- 2) Produktionshintergrund der Serie
- 3) Larry David in der Gesellschaft
- a) Einleitung
- b) Larry David und die Frage danach, was wir hier eigentlich machen
- c) Fazit
- 4) Curb your Enthusiasm und die Transformationen von medialer Realität und gesellschaftlicher Fiktion
- 517–562 VII. 30 Rock – Einblicke in das Zentrum der amerikanischen Unterhaltungsbranche 517–562
- 1) Einleitung
- 2) 30 Rock – Mediale Hinterbühnen als Unterhaltungsmittel
- 3) Liz Lemon – Alltägliche Weiblichkeit und das Problem des Sexus
- 4) Reality-TV als Folie einer ausufernden medialen Gegenwart
- 5) Fazit
- 563–568 VIII. Reflexiv-ironisches Fernsehen – Ein Fazit 563–568
- 569–586 IX. Schlussbetrachtungen 569–586
- 587–612 X. Anhang 587–612
- 1) Literaturverzeichnis
- 2) Internetseiten
- 3) Abbildungsnachweis
- 613–616 Dank 613–616