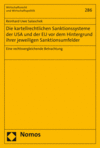Die kartellrechtlichen Sanktionssysteme der USA und der EU vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Sanktionsumfelder
Eine rechtsvergleichende Betrachtung
Zusammenfassung
Zur Sanktionierung von Kartellrechtsverstößen bedienen sich die USA und die EU zum Teil gemeinsamer, zum Teil unterschiedlicher Methoden. Die Sanktionierungspraxis wird dabei nicht nur von den Sanktionsmitteln als solchen, sondern auch von den zwischen diesen bestehenden Wechselwirkungen und der Einbettung in das sanktionsrechtliche Gesamtgefüge geprägt.
Die Arbeit stellt die beiden Sanktionssysteme unter Berücksichtigung der Entscheidungspraxis und der Bedeutung der jeweiligen Normenkonstrukte dar und vergleicht diese funktional. Sie deutet auf die teils erheblichen Unterschiede hin und zeigt auf, dass auch scheinbar gleiche Sanktionsmittel innerhalb des jeweiligen Gesamtsystems voneinander abweichende Auswirkungen haben können.
- 1–26 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–26
- 27–34 Einleitung 27–34
- 35–138 Teil 1: Das Kartellsanktionssystem der USA 35–138
- A. Das kartellrechtliche Sanktionssystem der USA
- I. Rechtliche Grundlagen
- 1. Kurzdarstellung § 1 Sherman Act
- 2. Kurzdarstellung § 4 Clayton Act
- 3. Kompetenzverteilung der Kartellrechtsdurchsetzung
- a. Die Federal Trade Commission
- b. Die Antitrust Division des Department of Justice
- c. Zuständigkeit der Gerichte für privatrechtliche Klagen
- II. Einführung in die Anwendung des kartellrechtlichen Sanktionsverfahrens der USA
- III. Strafrechtliche Verfahren bis zur Mitte der 1970er Jahre
- 1. Strafrechtliche Kartellrechtsdurchsetzung ab 1890
- 2. United States v. Alexander & Reid Co. (1922)
- 3. Protective Fur Dressers Corp. (1933)
- 4. Electrical-Equipment-Fälle (1960)
- 5. Kurzüberblick über die Sanktionierungspraxis bis 1974
- IV. Guidelines der Antitrust Division des DoJ vom 24. Februar 1977
- 1. Einleitung
- 2. Freiheitsstrafen für natürliche Personen
- a. Standardstrafmaß: 18 Monate
- b. Erschwerende und mildernde Umstände
- c. Stellungnahme: Die Auswirkungen der Bewährungsvorschriften auf Freiheitsstrafen
- 3. Geldstrafen für natürliche Personen
- 4. Geldstrafen für Unternehmen
- 5. Zusammenfassung: Guidelines 1977
- V. Die Federal Sentencing Guidelines (USSG) von 1987
- 1. Die Einsetzung der United States Sentencing Commission
- 2. Rechtscharakter und Bindungswirkung der USSG
- 3. Einführung in die USSG, das Punktsystem der USSG
- 4. Kartellrechtliche Strafen nach den USSG
- a. Unterscheidung zwischen Sanktionen für natürliche und juristische Personen
- b. Sanktionierung von natürlichen Personen
- i. Einführung in das Berechnungsschema
- ii. Der Ausgangswert (base offense level)
- iii. Tatspezifische Anpassungen (specific offense characteristics)
- iv. Generelle, insbesondere täterspezifische Anpassungen nach § 3 der USSG
- α. Rolle des Täters (§ 3B USSG)
- β. Behinderung der Justiz (§ 3C USSG)
- γ. Berücksichtigung mehrerer Anklagepunkte (§ 3D USSG)
- δ. Schuldeingeständnis
- v. Besonderheiten der Strafzumessung im Hinblick auf Freiheitsstrafen
- vi. Besonderheiten der Strafzumessung im Hinblick auf Geldstrafen
- c. Sanktionierung von juristischen Personen
- i. Einleitung und Übersicht
- ii. Festlegung des Grundbetrags
- iii. Anpassung des Grundbetrags
- iv. Strafbarkeitswert, Minimal- und Maximalmultiplikatoren und Festlegung der Geldstrafe
- v. Hohe Geldstrafen und das Alternative Fine Statute
- vi. Leistungsfähigkeit des Unternehmens (inability to pay)
- 5. Zusammenfassung: Kartellstrafen nach den USSG
- VI. Zusammenfassung: Das kartellrechtliche Sanktionssystem der USA
- B. Weitere Bestandteile des Sanktionsumfelds
- I. Verständigungsverfahren (plea agreements)
- 1. Kurzdarstellung des Verfahrens
- 2. Abweichungen von der Berechnung nach den USSG
- 3. Stellungnahme: Die Bedeutung der plea agreements für das US-Kartellsanktionssystem
- II. Die Leniency Notices des DoJ
- 1. Sinn und Zweck
- 2. Regelungsgehalt
- 3. Weiterentwicklungen der Kronzeugenprogramme: Amnesty Plus, Penalty Plus und die Eingrenzung möglicher Schadensersatzansprüche
- 4. Stellungnahme: Die Bedeutung des Kronzeugenprogramms für das US-Kartellsanktionssystem
- III. Private Kartellrechtsdurchsetzung
- 1. § 4 Clayton Act als Anspruchsgrundlage
- 2. Anreize für Privatkläger
- a. Dreifacher Schadensersatz (treble damages)
- b. Erstattung von Gerichts- und Anwaltsgebühren, Anwaltliche Erfolgshonorare
- c. Keine passing on defense (Klagen nachgelagerter Käufer)
- d. Verfahrenserleichterungen durch discovery, class actions und die Anscheinsbeweisregel für follow-on-Klagen
- 3. Stellungnahme: Die Bedeutung der privaten Kartellrechtsdurchsetzung für das US-Kartellsanktionsrecht
- a. Erhöhte Durchsetzungsdichte durch Privatkläger
- b. Verhältnis von privatrechtlichen zu öffentlichrechtlichen Sanktionen
- c. Stellungnahme
- IV. Zusammenfassung: Weitere Bestandteile des Sanktionsumfelds
- 139–268 Teil 2: Das Kartellsanktionssystem der EU 139–268
- A. Das kartellrechtliche Sanktionssystem der EU: Die Bußgeldpraxis der Kommission und der europäischen Gerichte
- I. Rechtliche Grundlagen
- 1. Kurzdarstellung Art. 101 AEUV
- 2. Artikel 103 Abs. 1 AEUV und Artikel 23 VO 1/2003 als Rechtsgrundlage
- a. Grundkonzeption
- b. Unternehmen bzw. juristische Personen als Sanktionsadressaten
- c. Geldbußen als nicht-strafrechtliche Sanktion
- d. Sinn und Zweck von Art. 23 Abs. 2 VO 1/2003 und Art. 15 Abs. VO 17/1962
- II. Einführung in die Anwendung des kartellrechtlichen Sanktionsverfahrens – das weite Ermessen der Kommission: Problemaufriss
- III. Kommissionspraxis und gerichtliche Überprüfbarkeit vor Erlass der Bußgeldleitlinien 1998
- 1. Internationales Chininkartell (1969)
- 2. Europäische Zuckerindustrie (1973)
- 3. Chiquita (1975)
- 4. Miller International Schallplatten (1978)
- 5. Pioneer / Musique Diffusion Française (1979)
- 6. Soda Ash (1990)
- 7. Karton (1994)
- 8. Zement (1994)
- 9. Tréfilunion (1995)
- 10. Stellungnahme: Die Bußgeldpraxis vor Erlass der Bußgeldleitlinien 1998
- IV. Die Bußgeld-Leitlinien der Europäischen Kommission aus dem Jahr 1998
- 1. Rechtscharakter und Überprüfbarkeit der Bußgeldleitlinien 1998 und 2006
- a. Bindungswirkung für die Europäische Kommission
- b. Überprüfbarkeit von Kommissionsentscheidungen durch die europäischen Gerichte
- 2. Geldbußenberechnung nach den Bußgeldleitlinien 1998 – Überblick
- 3. Die einzelnen Bestandteile der Bußgeldleitlinien 1998
- a. Grundbetrag
- i. Schwere des Verstoßes
- ii. Dauer des Verstoßes
- iii. Berechnungsmethode des Grundbetrags
- b. Erschwerende/Mildernde Umstände
- c. Anwendung der Kronzeugenregelung
- d. Abschließende Erwägungen
- e. Zusammenfassung: Die Berechnungsmethode der Bußgeldleitlinien 1998
- 4. Stellungnahme: Die Bußgeldleitlinien 1998
- V. Die Bußgeld-Leitlinien der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2006
- 1. Geldbußenberechnung nach den Bußgeldleitlinien 2006 – Überblick
- 2. Analyse der einzelnen Bestandteile der Bußgeldleitlinien 2006
- a. Grundbetrag (erste Stufe der Geldbußenberechnung nach den Bußgeldleitlinien 2006)
- i. Schwere des Verstoßes
- ii. Dauer des Verstoßes
- iii. Eintrittsgebühr
- iv. Berechnungsmethode des Grundbetrags
- b. Anpassung des Grundbetrags (zweite Stufe)
- i. Erschwerende Umstände
- ii. Mildernde Umstände
- iii. Aufschlag zur Gewährleistung einer abschreckenden Wirkung und Gewinnabschöpfung
- iv. Rechtliche Obergrenze
- v. Mitteilung über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen
- vi. Leistungsfähigkeit der Unternehmen
- c. Abschließende Erwägungen
- 3. Stellungnahme: Die Bußgeldpraxis der Kommission und der europäischen Gerichte nach den Bußgeldleitlinien 2006
- VI. Zusammenfassung
- B. Weitere Bestandteile des Sanktionsumfelds
- I. Das Vergleichsverfahren der Kommission in Kartellfällen
- 1. Sinn und Zweck
- 2. Regelungsgehalt
- 3. Stellungnahme: Die Bedeutung des Vergleichsverfahrens für das EU-Kartellsanktionssystem
- II. Das Kronzeugenprogramm der Kommission
- 1. Sinn und Zweck
- 2. Regelungsgehalt
- 3. Stellungnahme: Die Bedeutung des Kronzeugenprogramms für das EU-Kartellsanktionssystem
- III. Private Geltendmachung von kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen
- 1. Kurzdarstellung der Ausgangslage
- 2. Die Schaffung eines effektiven Systems privater Geltendmachung von kartellbedingten Schäden in der EU – Die EuGH-Urteile Courage und Manfredi und Maßnahmen der Kommission zur Schaffung einer effektive...
- 3. Die Richtlinie über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Unio...
- a. Recht auf vollständigen Schadensersatz
- b. Wechselwirkungen der Richtlinie mit dem Sanktionssystem im engeren Sinne und weiteren Bestandteilen des Sanktionsgefüges – Anreize für Privatkläger?
- i. Gesamtschuldnerische Haftung der an einem Wettbewerbsrechtsverstoß beteiligten Unternehmen
- ii. Die Behandlung der passing-on-defense
- iii. Wirkung einzelstaatlicher Entscheidungen
- iv. Verjährung
- v. Einvernehmliche Streitbeilegung
- vi. Keine Verrechnung von Schadensersatzzahlungen mit Geldbußen
- 4. Bedeutung der privaten Geltendmachung von kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen für das EU-Kartellsanktionssystem
- IV. Zusammenarbeit im Europäischen Wettbewerbsnetz und Sanktionen der Mitgliedstaaten
- 1. Die Zusammenarbeit im ECN
- 2. Sanktionsumfeld in den Mitgliedstaaten
- 3. Stellungnahme: Die Bedeutung der Sanktionen in den Mitgliedstaaten und der Zusammenarbeit im ECN für das EU-Kartellsanktionssystem
- V. Zusammenfassung: Weitere Bestandteile des Sanktionsumfelds
- 269–320 Teil 3: Rechtsvergleich 269–320
- A. Grundsätzliche Vergleichbarkeit des kartellrechtlichen Sanktionsrechts der EU und der USA
- B. Vergleichung der untersuchten Parameter
- I. Vergleichung der rechtlichen Grundlagen und der Verankerung der Sanktionssysteme
- II. Vergleichung der kartellrechtlichen Sanktionssysteme (im engeren Sinne) der USA und der EU
- 1. Übersicht und Einleitung
- 2. Geldbußen bzw. Geldstrafen für Unternehmen/juristische Personen
- 3. Sanktionen für natürliche Personen
- III. Vergleichung der Einbettung der Sanktionssysteme im engeren Sinne in das weitere Sanktionsumfeld
- 1. Übersicht
- 2. Plea bargainingund Vergleichsverfahren
- 3. Kronzeugenprogramme
- 4. Private Geltendmachung von kartellbedingten Schäden
- 5. Auswirkungen weiterer Faktoren
- C. Ergebnis der Vergleichung und Ausblick
- 321–326 Zusammenfassung in Thesenform 321–326
- 327–328 Anhang: Die Straftabelle (sentencing table) der USSG 327–328
- 329–348 Literaturverzeichnis 329–348