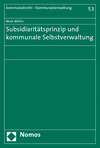Subsidiaritätsprinzip und kommunale Selbstverwaltung
Zusammenfassung
Angesichts einer immer weiter fortschreitenden europäischen Integration müssen sich die Kommunen nicht mehr nur gegenüber nationalrechtlichen Einwirkungen erwehren, sondern sehen sich in zunehmendem Maße europarechtlich induzierten Beschränkungen und Bedrohungen ausgesetzt. Im Rahmen der Überlegungen, wie ein wirksamer Schutz der kommunalen Selbstverwaltung entweder durch Gemeinschaftsrecht oder aber auf Grundlage des deutschen Verfassungsrechts erreicht werden kann, gewinnt vor allem der Subsidiaritätsgrundsatz an Bedeutung.
Der Autor verfolgt das Ziel, die Verfassungsimmanenz des Subsidiaritätsprinzips nachzuweisen, um es als Regulativ der Kompetenzabgrenzung sowohl auf nationaler als auch auf supranationaler Ebene fruchtbar zu machen. Dabei erfährt die Subsidiaritätsdiskussion eine neue Dynamik in Anbetracht einer bevorstehenden europäischen Vertragsrevision.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–16 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–16
- 17–20 Abkürzungsverzeichnis 17–20
- 21–21 Einleitung 21–21
- 22–56 Erstes Kapitel: Begriff, Ursprung und Inhalt des Subsidiaritätsprinzips 22–56
- 22–23 A. Begriff 22–23
- 23–25 B. Anwendungsbereich und Sinn des Subsidiaritätsprinzips 23–25
- 25–40 C. Ursprünge des Subsidiaritätsverständnisses 25–40
- 25–30 I. Sozialphilosophische Ursprünge 25–30
- 1. Aristoteles
- 2. Thomas von Aquin
- 3. Althusius
- 30–36 II. Das Subsidiaritätsprinzip in der liberalistischen Staatstheorie 30–36
- 1. Vorbemerkung
- 2. Akzentuierung des Prinzips im Frühliberalismus
- 3. Akzentuierung des Prinzips in späteren liberalistischen Staatslehren
- a) Aufbrechen des strengen Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft
- b) Die Stufenlehre des Robert von Mohl
- c) Die Staatszwecklehre Georg Jellineks
- 4. Zusammenfassung
- 36–40 III. Das Subsidiaritätsprinzip in der katholischen Soziallehre 36–40
- 40–48 D. Die Einzelaussagen des Subsidiaritätsprinzips 40–48
- 40–42 I. Der personalistische Ansatz 40–42
- 42–44 II. Delegation der Kompetenzen „von unten nach oben“ 42–44
- 44–45 III. Subsidiarität als Optimierungsprinzip 44–45
- 45–48 IV. Die rechtliche Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzips 45–48
- 1. Rechtsprinzip und Rechtssatz
- 2. Das Subsidiaritätsprinzip als Rechtsprinzip
- 48–53 E. Das Tertium Comparationis von Subsidiarität und anderen Grundsätzen und Prinzipien 48–53
- 48–50 I. Subsidiarität und Übermaßverbot 48–50
- 50–51 II. Subsidiarität und Dezentralisation 50–51
- 51–52 III. Subsidiarität und Gewaltenteilung 51–52
- 52–53 IV. Subsidiarität und Demokratieprinzip 52–53
- 53–55 F. Subsidiarität in der föderalistischen Gesellschaftslehre 53–55
- 55–56 G. Zusammenfassung und Ergebnis 55–56
- 57–205 Zweites Kapitel: Subsidiarität und kommunale Selbstverwaltung im Grundgesetz 57–205
- 57–81 Erster Abschnitt: Die kommunale Selbstverwaltung im Gefüge von „Staat“ und „Gesellschaft“ 57–81
- 57–68 A. Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung 57–68
- I. Dorf- und Stadtentwicklung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
- II. Die Entwicklungen bis 1918
- 1. Die Reformideen des Reichsfreiherrn vom Stein
- 2. Die Verbreitung der liberalen Idee bis 1848
- 3. Reaktionszeit nach 1848
- III. Die Selbstverwaltung in der Weimarer Zeit und im Nationalsozialismus
- 1. Ablösung des Spannungsverhältnisses von Kommune und Staat infolge der Demokratisierung
- 2. Das neue Spannungsverhältnis von Demokratie und Selbstverwaltung
- 3. Die Zersetzung der kommunalen Selbstverwaltung durch den Nationalsozialismus
- IV. Die Entwicklung nach 1945
- 1. Die Bedeutung der Gemeinden während des Wiederaufbaus
- 2. Die kommunale Selbstverwaltung auf dem Weg ins Grundgesetz
- 68–71 B. Tradierte Selbstverwaltungskonzeptionen 68–71
- I. Die Konzeption Rudolf von Gneists
- II. „Politische“ und „juristische“ Selbstverwaltung
- 71–73 C. Die Erosion der kommunalen Selbstverwaltung in der Weimarer Zeit 71–73
- I. Die veränderten Rahmenbedingungen kommunaler Selbstverwaltung
- II. Der behauptete Funktionsverlust der kommunalen Selbstverwaltung
- 73–81 D. Kommunale Selbstverwaltung und Staatsverwaltung im Verfassungsstaat der Gegenwart 73–81
- I. Kommunale Selbstverwaltung und Staatsverwaltung
- 1. Die Implementierung der Gemeinden in den Staatsaufbau
- 2. Eigene demokratische Legitimation
- 3. Das „Recht“ auf kommunale Selbstverwaltung
- II. Erste Hinweise auf die Relevanz des Subsidiaritätsprinzips im Bereich des Kommunalwesens
- 1. Der Selbstverwaltungsbegriff
- 2. Freiheitlichkeit, Demokratie und Teilung der Staatsgewalt
- III. Grundvoraussetzungen für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
- 81–134 Zweiter Abschnitt: Das Subsidiaritätsprinzip als Ordnungselement des Grundgesetzes 81–134
- 81–85 A. Überblick über die Subsidiaritätsdiskussion 81–85
- I. Gegenstand der Subsidiaritätsdiskussion
- II. Die Subsidiaritätsdiskussion in Deutschland
- 85–91 B. Kritik an der Subsidiaritätskonzeption des Grundgesetzes 85–91
- I. Das Menschenbild des Grundgesetzes
- II. Die Souveränität und Allzuständigkeit des Staates
- III. Das Demokratieprinzip
- IV. Die Sozialstaatlichkeit
- 91–102 C. Das Subsidiaritätsprinzip im Verhältnis von „Staat“ und „Gesellschaft“ 91–102
- I. Die Unterscheidung von „Staat“ und „Gesellschaft“
- II. Grundrechtlicher Freiheitsschutz als Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips
- 1. Die Individualfreiheit als wichtigste Wertentscheidung des Grundgesetzes
- 2. Übermaßverbot und Subsidiaritätsprinzip als Elemente der Grundrechtsgewährleistung
- 3. Inhalt und Funktion von Übermaßverbot und Subsidiaritätsprinzip
- 4. Verfassungsrechtliche Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzips im Verhältnis von Staat und Gesellschaft
- III. Kommunale Selbstverwaltung und Grundrechtsschutz
- 1. Grundrechtsschutz Privater gegenüber der Kommunalverwaltung
- 2. Grundrechtssicherung durch kommunale Selbstverwaltung
- 3. Hinweise auf die Geltung des Subsidiaritätsprinzips im kommunalrelevanten Bereich
- IV. Zusammenfassung
- 102–134 D. Das Subsidiaritätsprinzip im Bereich der Staatsorganisation 102–134
- I. Das Wertesystem des Grundgesetzes
- II. Die kommunale Selbstverwaltung als Teil der Staatsorganisation
- III. Bedeutung der Analyse des Bundesstaates für die Geltung des Subsidiaritätsprinzips im kommunalen Bereich
- 1. Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung im Grundgesetz
- 2. Vergleichbare Gefährdungslage von Kommunen und Ländern
- IV. Die Entwicklungen im Bund-Länder-Verhältnis seit 1945
- 1. Bedeutung der Länder für den Wiederaufbau nach 1945
- a) Historischer Überblick über den Stellenwert der Länder im Vorfeld der Grundgesetzausarbeitung
- b) Die Ausarbeitung des Grundgesetzes
- c) Die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips im Grundgesetz
- 2. Die Unitarisierung im Bund-Länder-Verhältnis
- a) Paradigmenwechsel im Bundesstaat
- b) Kompetenzverteilung auf dem Gebiet der Gesetzgebung
- c) Kompetenzverteilung auf dem Gebiet der Verwaltung
- d) Bewertung der Unitarisierung unter Subsidiaritätsgesichtspunkten
- 3. Das Bund-Länder-Verhältnis im wiedervereinigten Deutschland
- a) Der Beratungsverlauf in der Gemeinsamen Verfassungskommission
- b) Ersetzung der Bedürfnisklausel durch die Erforderlichkeitsklausel
- c) Veränderungen im Bereich der Rahmengesetzgebung
- d) Reaktionen des Bundesverfassungsgerichts
- 4. Das Bund-Länder-Verhältnis nach der Föderalismusnovelle
- a) Der Weg zur Reform
- b) Neukonzeptionierung der Gesetzgebungskompetenzen
- aa) Rahmengesetzgebung
- bb) Konkurrierende Gesetzgebung
- (1) Veränderungen im Kompetenzkatalog des Art. 74 GG
- (2) Kern- und Bedarfskompetenzen, Kompetenzkontrollverfahren in Art. 93 Abs. 2 GG n.F.
- (3) Abweichungskompetenzen
- cc) Reduzierung der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen
- c) Weitere Veränderungen im Bund-Länder Verhältnis
- d) Bewertung aus Sicht des Subsidiaritätsprinzips
- aa) Realisierung des Subsidiaritätsprinzips in der Föderalismusnovelle
- bb) Das Subsidiaritätsprinzip als Kompetenzregulativ des Art. 72 Abs. 2 GG
- V. Umgekehrte Subsidiarität im Bund-Länder-Verhältnis
- VI. Zusammenfassung
- 134–205 Dritter Abschnitt: Die Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung als Gegenstand des Subsidiaritätsprinzips 134–205
- 134–156 A. Art. 28 Abs. 2 GG als institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung 134–156
- I. Traditionelles Verständnis
- 1. Die Weimarer Lehre von der institutionellen Garantie
- 2. Die Rezeption und Fortentwicklung dieser Lehre unter dem GG
- a) Die drei Garantieebenen der institutionellen Garantie
- b) Die Relativierung der Kernbereichs-Rechtsprechung
- II. Der „Rastede-Beschluss“ des Bundesverfassungsgericht
- 1. Das institutionelle Verständnis als dogmatischer Ausgangspunkt
- 2. Kernbereich
- a) Der Kernbereichsschutz als absolute Grenze
- b) Die Unzulänglichkeiten des Kernbereichsschutzes
- 3. Randbereich
- 4. Nachfolgende Entscheidungen
- III. Stellungnahmen in der Literatur
- 1. Vertreter einer die institutionelle Sichtweise befürwortenden Position
- 2. Vertreter einer die institutionelle Sichtweise ablehnenden Position
- a) Rechtshistorischer Vergleich mit Art. 127 WRV und teleologische Auslegung des Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG
- b) Art. 28 Abs. 2 GG als subjektives Recht und Grundrechtsähnlichkeit
- 3. Eigene Stellungnahme
- a) Kritische Analyse der die institutionelle Sichtweise negierenden Position
- b) Kritische Analyse der die institutionelle Sichtweise befürwortenden Position
- c) Würdigung
- 156–204 B. Eigener dogmatischer Ansatz auf Grundlage des Subsidiaritätsprinzips 156–204
- I. Bestand der Selbstverwaltungsträger
- II. Das Subsidiaritätsprinzip als Maßstab der Zuständigkeitsabgrenzung im kommunalen Aufgabenbereich
- 1. Der Aufgabenbereich der Gemeinden
- a) Die traditionelle Unterscheidung zweier Wirkungskreise und die Ansätze zur Überwindung des sog. Aufgabendualismus
- b) Die Eigenverantwortlichkeit als Grundlage der Aufgabenabgrenzung
- c) Die Einordnung der Aufgabe als Selbstverwaltungs- oder Auftragsangelegenheit
- d) Das Subsidiaritätsprinzip als Regulativ einer eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung
- e) Die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft als Selbstverwaltungsaufgabe
- aa) Die Allzuständigkeit der Gemeinden und die Zuständigkeitsvermutung auf Grundlage des Subsidiaritätsprinzips
- bb) Ablehnende Haltung des Bundesverfassungsgerichts gegenüber Neukonzeptionierungsversuchen
- cc) Das materielle Aufgabenverteilungsprinzip als Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzips
- dd) Einschätzungsprärogative und reduzierte gerichtliche Kontrolldichte
- 2. Der Aufgabenbereich der Gemeindeverbände insbesondere der Landkreise
- 3. Die interkommunale Geltung des Subsidiaritätsprinzips
- a) Unzulässigkeit der Ergänzung- und Ausgleichsaufgaben?
- aa) Kritik an den Ergänzungsaufgaben des Kreises
- bb) Kritik an den Ausgleichsaufgaben des Kreises
- b) Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
- c) Das Subsidiaritätsprinzip als Sicherungsinstrument gemeindlicher Zuständigkeit
- 4. Das Verhältnis der kommunalen Selbstverwaltung zum Bereich gesellschaftlicher Freiheit
- a) Art. 28 Abs. 2 GG als Kompetenznorm im Verhältnis zu Privaten?
- b) Zulässigkeit und Grenzen der Kommunalwirtschaft als ein „Problem des Verfassungsrechts“
- c) Die Aufgabenprivatisierung
- 5. Schlussfolgerung für die Anwendbarkeit des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
- a) Beschränkung des Verhältnismäßigkeitsprinzips auf den Bereich der Grundrechtsgewährleistung?
- b) Die Befürworter einer Verhältnismäßigkeitsprüfung
- c) Abgrenzung auf Grundlage der dogmatischen Unterschiede zwischen Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
- III. Die Bestimmung der Modalitäten der Aufgabenausübung – Die Eigenverantwortlichkeit
- 204–205 C. Ergebnis 204–205
- 206–290 Drittes Kapitel: Das Subsidiaritätsprinzip in der Struktursicherungsklausel des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG und die Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung in Europa 206–290
- 206–220 Erster Abschnitt: Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG als Beleg der Verfassungsimmanenz eines allgemeinen Subsidiaritätsprinzips 206–220
- 206–208 A. Allgemeines 206–208
- 208–212 B. Die Struktursicherungsklausel als Selbstbild des deutschen Verfassungsstaates 208–212
- I. Adressaten der Staatszielbestimmung
- II. Inhalt und Normativität der Struktursicherungsklausel – Abgrenzung zur Verfassungsbestandsklausel
- 212–220 C. Das Subsidiaritätsprinzip als binnenstaatliches Verfassungsprinzip? 212–220
- I. Die vorgebliche gemeinschaftsrechtliche Determiniertheit des nationalen Subsidiaritätsbegriffs
- II. Systematisches Argument
- III. „Subsidiarität“ als autonomer Begriff des nationalen Verfassungsrechts
- 1. Der deutsche Ursprung der europäischen Subsidiaritätsbewegung
- 2. Gesetzeszweck des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG
- 3. Kriterien der Subsidiarität
- 4. Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung
- IV. Ergebnis
- 220–290 Zweiter Abschnitt: Die kommunale Selbstverwaltung in Europa 220–290
- 220–238 A. Verfassungsrechtlicher Schutz der kommunalen Selbstverwaltung gegenüber Einwirkungen des Gemeinschaftsrechts 220–238
- I. Der Grundsatz der offenen Staatlichkeit und die Grenzen der Vorrangwirkung des Gemeinschaftsrechts
- II. Die kommunale Selbstverwaltung als grundgesetzliche Übertragungsschranke
- 1. Die Verfassungsposition der Kommunen vor der Einführung des Art. 23 GG n.F.
- 2. Art. 23 Abs. 1 GG n.F.
- III. Normative Auswirkungen des Grundsatzes der Subsidiarität in Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG auf die Verfassungsposition der Kommunen in Deutschland
- 1. Der reduzierte Schutzumfang nach Meinung der Literatur
- 2. Kritik an der Verfassungskonkretisierung nach Maßgabe des § 10 EuZBLG
- 3. Eigener Ansatz
- a) Die Kommunen als „Subjekt des Subsidiaritätsprinzips“
- b) Die Gewährleistung des Bestandes der Selbstverwaltungsträger und der kommunalen Eigenverantwortlichkeit
- c) Verfassungsprozessuale Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung
- 238–277 B. Europarechtlicher Schutzgehalt zugunsten kommunaler Selbstverwaltung 238–277
- I. Allgemeiner Rechtsgrundsatz der kommunalen Selbstverwaltung
- 1. Die Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung als ein den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsamer Rechtsgrundsatz
- 2. Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung
- 3. Ergebnis
- II. Absicherung durch das Demokratieprinzip
- III. Das Prinzip der Bürgernähe
- IV. Der Grundsatz der Gemeinschaftstreue und der Schutz der nationalen Identität
- V. Das gemeinschaftsrechtliche Subsidiaritätsprinzip
- 1. Entwicklung
- a) Die Entwicklung im Vorfeld des Maastrichter Vertrages
- b) Die Entwicklung nach der Einführung des Subsidiaritätsprinzips durch den Vertrag von Maastricht
- 2. Systematische Einordnung und Abgrenzung
- 3. Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Subsidiaritätsprinzips
- a) Das gemeinschaftsrechtliche Subsidiaritätsprinzip als Kompetenzausübungsregel
- b) Materielle Anforderungen des Subsidiaritätsprinzips
- 4. Subsidiaritätsprinzip und kommunale Selbstverwaltung
- a) Die Anwendbarkeit des Subsidiaritätsprinzip auf mitgliedstaatliche Untergliederungen
- b) Die deutsche Verhandlungsposition
- c) Die Art der Schutzwirkung
- 5. Justiziabilität
- a) Fehlende rechtliche Bestimmtheit des Art. 5 Abs. 2 EG
- b) Anknüpfungspunkte für eine Rechtmäßigkeitsprüfung in formeller und materieller Hinsicht
- c) Die Rechtsprechung des EuGH
- d) Die Rechtsposition der Kommunen
- VI. Schutz der Kommunalwirtschaft durch Art. 86 Abs. 2, Art. 16 EG
- 1. Tatbestandsmerkmale des Art. 86 Abs. 2 EG
- 2. Beeinflussung der Auslegung durch Art. 16 EG
- 277–288 C. Reformperspektiven: Der „Vertrag von Lissabon“ 277–288
- I. Primärrechtliche Anerkennung der kommunalen Selbstverwaltung
- II. Einbeziehung der lokalen Selbstverwaltung in das Subsidiaritätsprinzip
- 1. Materiellrechtliche Änderungen
- a) Abschließende Katalogisierung der ausschließlichen Gemeinschaftskompetenzen
- b) Klarstellende Formulierungen des Subsidiaritätsprinzips
- 2. Prozedurale und Prozessuale Neuerungen im Hinblick auf die Subsidiaritätskontrolle
- a) Prozedurale Kontrolle: Frühwarnsystem
- b) Prozessuale Kontrolle: Erweiterung des Klagerechts
- III. Perspektivwechsel im Bereich der Daseinsvorsorge?
- 288–290 D. Ergebnis 288–290
- 291–292 Thesen 291–292
- 293–320 Literaturverzeichnis 293–320