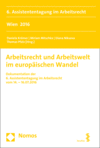Arbeitsrecht und Arbeitswelt im europäischen Wandel
Dokumentation der 6. Assistent/innentagung Arbeitsrecht vom 14.-16.07.2016
Zusammenfassung
Der wachsende unionsrechtliche Einfluss stellt die nationalen Arbeitsrechtsordnungen regelmäßig vor neue Herausforderungen. Sowohl die europäische Rechtsetzung als auch die Judikatur des EuGH und des EGMR haben bedeutende Auswirkungen auf das nationale Arbeitsrecht, die nicht mehr sinnvoll in einem rein innerstaatlichen Kontext geregelt werden können.
Der Band steht im Zeichen des europäischen Wandels von Arbeitsrecht und Arbeitswelt. Er dokumentiert die Beiträge und Ergebnisse der 6. Assistent/innentagung im Arbeitsrecht, die vom 14. bis zum 16 Juli in Wien stattfand.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–7 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–7
- 9–22 Arbeitsrecht und Arbeitswelt im europäischen Wandel – Reflexionen zum Thema 9–22
- A. Vorweg: Assistent – ein vorübergehender Status
- B. Arbeitsrecht und Arbeitswelt
- I. Herausforderungen von heute
- II. Schlaglichter aus der Geschichte
- III. Regulierungsansätze
- C. Spannungsverhältnisse
- I. Arbeitsrecht und Sozialrecht
- II. Rechtsdogmatik und Sozialwissenschaften
- III. Auslegung und Politik
- IV. Stabilität und Innovation
- V. Rechts und links: Das Menschenbild
- D. Drei Wünsche
- 23–36 Herausforderungen an die junge Arbeitsrechtswissenschaft in Europa 23–36
- A. Arbeitsrecht
- B. Arbeitsrecht in der Union
- C. Arbeitsrechtswissenschaft
- 37–70 Zu den Zwecken und zur Durchsetzung des europäischen Arbeitsrechts 37–70
- A. Einleitung
- B. Zwecke des europäischen Arbeitsrechts
- I. Grundsatz gleichen Entgelts für Männer und Frauen
- II. Europäisches Gleichbehandlungsrecht
- III. Europäisches Arbeitszeit- und Urlaubsrecht
- C. Verfassungsrechtlicher Status des europäischen Arbeitsrechts
- I. Ultra vires-Kontrolle
- II. Grundgesetzlicher Grundrechtsschutz
- III. Bindung der Gerichte an das Unionsrecht
- D. Durchsetzung des europäischen Arbeitsrechts
- I. Vertragsverletzungsverfahren
- II. Vorabentscheidungsverfahren
- 1. Materiell-rechtliche Bindung
- a) Zweiteilung des Arbeitsrechts
- b) Handhabung in der Praxis
- 2. Prozessrechtliche Bindung des BAG
- a) Entscheidungserheblichkeit des Unionsrechts
- b) Ausnahme: Gefestigte Rechtsprechung des EuGH
- c) Ausnahme: acte clair
- d) Nachträgliche Korrekturen durch den EuGH
- e) Verfassungsverstöße
- f) Vorlagestatistik
- 3. Dezentrale Vorlagenkontrolle
- E. Fazit
- 71–96 Meine Zeit steht in deinen Händen – Was darf und kann der Arbeitgeber arbeitszeitrechtlich regeln? 71–96
- A. Was ist Arbeitszeit? – Ein Überblick
- I. Die Rechtsprechung des EuGH zum Arbeitszeitrecht
- II. Weitere Arbeitszeitbegriffe
- B. Verteilung der Arbeitszeit durch Direktionsrecht des Arbeitgebers
- C. „Definition“ der Arbeitszeit durch Arbeitgeber
- I. Fahrtzeiten
- II. Umkleidezeiten
- 1. Allgemeines
- 2. Einflussnahme durch Arbeitgeber
- 3. Grenzen der Gestaltbarkeit
- 4. Folgeprobleme
- D. Regelung der Folgen der Arbeitszeit
- I. Zwingende Vergütung von Arbeitszeit
- 1. Vergütungsanspruch aus § 611 BGB
- 2. Vergütungsanspruch aus § 612 BGB
- 3. Vergütungsanspruch aus dem MiLoG
- II. Notwendigkeit der Regelung der Vergütung
- E. Résumé
- 97–118 Der Wandel der Voraussetzungen des Urlaubsanspruchs unter dem Einfluss europäischer Vorgaben 97–118
- A. Einleitung und These
- I. Europäische Vorschriften
- II. Betrachtung des Urlaubszwecks
- III. Vorgaben des EuGH
- 1. Teilzeit- und Kurzarbeitskonstellationen
- a) Landeskrankenhäuser Tirols-, Brandes- und Greenfield-Urteile
- b) Heimann-Toltschin-Urteil
- c) Zwischenergebnis
- 2. Krankheitskonstellationen
- IV. Regel-Ausnahme-Verhältnis
- 1. Regel der Voraussetzung der Erarbeitung
- 2. Ausnahme als Aufhebung des Gegenleistungsgefüges aufgrund von Arbeitnehmerschutzgedanken
- B. Folgen für das nationale Recht in Deutschland und Österreich
- I. Günstigkeit der nationalen Regelungen
- II. Konsequenzen für Deutschland und Österreich
- C. Ergebnis
- 119–142 Der antidiskriminierungsrechtliche Behinderungsbegriff 119–142
- A. Einleitung – Immer wieder die Behinderung
- I. Behinderung im antidiskriminierungsrechtlichen Kontext
- II. Vom medizinischen zum sozialen Behinderungsbegriff
- B. Die unions- und völkerrechtlichen Vorgaben an den Begriff der Behinderung
- I. Der menschenrechtliche Ansatz der UN-BRK
- II. Unionsrechtlicher Behinderungsbegriff
- 1. Chacón Navas – medizinisch orientiertes Verständnis von Behinderung
- 2. Skouboe-Werge/Ring: Der Paradigmenwechsel
- 3. Divergenz zwischen unions- und völkerrechtlichem Verständnis: Anknüpfungspunkt des Berufslebens
- III. Nationale Begriffsbestimmung – Ansatz des BAG
- C. Anwendungsprobleme bei der Operationalisierung eines sozialen Modells?
- I. Dualismus von juristischer Definition und sozialem Modell von Behinderung
- II. Angelpunkt: Antidiskriminierungsrecht nur für „echte“ Behinderte?
- 1. Unterstellte Behinderung
- 2. Vergangene Behinderung
- 3. Assoziierte Diskriminierung
- 4. „Geringfügige“ Behinderung - Abgrenzung zur Krankheit
- III. Rechtliche Operationalisierung eines sozialen Modells von Behinderung durch postkategoriales Antidiskriminierungsrecht?
- D. Ausblick
- 143–170 Vordienstzeiten- und Vorrückungsregelungen – Diskriminierung aufgrund des Alters und/oder des Geschlechts 143–170
- A. Einleitung
- B. Verlängerung des ersten Vorrückungszeitraumes
- I. Unterschied zu Starjakob und Schmitzer
- II. Ungleichbehandlung jüngerer Arbeitnehmer
- III. Rechtfertigung
- C. (Nicht-)Anrechnung des Präsenz- bzw. Zivildienstes auf die Entgelteinstufung
- I. Ungleichbehandlung wegen des Alters
- II. Rechtfertigung der Ungleichbehandlung wegen des Alters
- 1. Gleichbehandlung der Geschlechter
- 2. Gleichbehandlung in Hinblick auf den Ruhestand
- 3. Förderung der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen
- 4. Honorierung der Erfahrung älterer Arbeitnehmer
- 5. Ergebnis eines Sozialpartnerkompromisses
- III. Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts
- IV. Rechtfertigung der Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts
- 1. Betriebliches Interesse
- 2. Positive Maßnahme
- V. Vorlagepflicht?
- D. Zusammenfassung
- 171–192 Tendenzschutz im Diskriminierungsrecht? 171–192
- A. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und der Tendenzschutz
- B. Diskriminierungsschutz im AGG
- C. Berufliche Anforderung im Sinne des § 8 Abs. 1 AGG
- I. Gegenstand der beruflichen Anforderung
- II. Bestimmungskriterium der beruflichen Anforderung
- 1. Art der Tätigkeit
- 2. Bedingung der Tätigkeitsausübung
- a) Ziel und Zweck der Tätigkeit und die auf die Tätigkeit einwirkenden Rechtsnormen
- b) Grundrechtlich besonders geschützter Belang
- c) Exkurs: Anwendbare(s) Grundrechtsregime
- III. Wesentliche, entscheidende und angemessene berufliche Anforderung
- D. Tendenzschutz
- I. Abgrenzung zu Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- II. Tendenzträger
- III. Tendenzunternehmen
- 1. Keine überwiegende Tendenzverfolgung nötig
- 2. Schützenswerte Tendenzen
- IV. Tendenzbezogene Maßnahme
- V. Ergebnis
- E. Blick ins österreichische Gleichbehandlungsrecht
- F. Konklusion
- 193–216 Strukturfragen zum Zusammenspiel von Aufsichts- und Arbeitsrecht im europäischen Pensionsfondsgeschäft gemäß IORP II 193–216
- A. Einleitung
- B. Quantitative Bedeutung
- C. Funktionsweise des internationalen Pensionsfondsgeschäfts
- D. Kompetenzrechtliche Analyse der Pensionsfonds-RL
- E. Strukturfragen: Was ist Arbeitsrecht iSd Pensionsfonds-RL?
- I. Ausgangspunkt 1: Aufsichtsrecht
- II. Ausgangpunkt 2: Arbeitsrecht
- F. Arbeitsrecht auch im Verhältnis zum Pensionsfonds?
- G. Beispiel Versicherungsmechanismus
- I. Versicherung als sozialpolitisches Element
- II. Versicherungsmechanismus als Aufsichtsgegenstand
- H. Ergebnisse
- 217–240 Alles beim Alten? Beschäftigtendatenschutz nach der EU-Datenschutzreform 217–240
- A. Voll-Harmonisierung des Datenschutz oder der Grundrechte?
- I. Unvollständiger Regelungsansatz der DSRL
- II. Partielle Vervollständigung durch die DSGVO
- III. Exkurs: DSGVO als „Mangold II“?
- IV. Zwischenfazit
- B. Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis
- I. Kann er oder kann er nicht?
- II. Koppelungsverbot und Freiwilligkeit
- III. Zwischenfazit
- C. "Spezifischere Vorschriften" für den Beschäftigtendatenschutz
- I. Sachlicher Anwendungsbereich
- II. „Spezifischere Vorschriften“
- III. Rolle der Tarif- und Betriebsparteien
- IV. Was geschieht am 25.05.2018?
- D. Summa
- 241–264 Der Betriebsübergang im europäischen Wandel 241–264
- A. Einführung
- B. Die Entwicklung der Rechtsgrundlagen
- C. Die Anwendung des Betriebsübergangsrechts im europäischen Wandel
- I. Betrieb und Betriebsteil
- 1. Traditionelles Verständnis in Deutschland
- 2. Die Rechtsprechung des EuGH und ihre Umsetzung durch das BAG
- 3. Kritische Würdigung
- II. Identitätswahrender Übergang
- 1. Die Bedeutung der Arbeitnehmer
- a) Frühere Rechtsprechung des BAG
- b) Die Rechtsprechung des EuGH und ihre Umsetzung durch das BAG
- c) Kritische Würdigung
- 2. Die Bedeutung der materiellen Aktiva
- a) Frühere Rechtsprechung des BAG
- b) Die Rechtsprechung des EuGH und ihre Umsetzung durch das BAG
- c) Kritische Würdigung
- 3. Identitätszerstörende Eingliederung
- a) Frühere Rechtsprechung des BAG
- b) Die Rechtsprechung des EuGH und ihre Umsetzung durch das BAG
- c) Kritische Würdigung
- D. Übergreifende Analyse
- I. Bestandsaufnahme
- II. Lösungsvorschlag
- E. Fazit