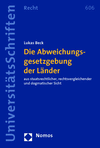Die Abweichungsgesetzgebung der Länder
aus staatsrechtlicher, rechtsvergleichender und dogmatischer Sicht
Zusammenfassung
Seit der 2006 in Kraft getretenen „Föderalismusreform I“ ist es den Ländern im Rahmen der Abweichungsgesetzgebung möglich, Regelungen zu erlassen, die Bundesgesetzen widersprechen. Neben den Fragen die durch diese Neuerungen aufgeworfen werden, analysiert der Autor die Möglichkeiten und Grenzen des Modells sowie mit einem Blick ins Ausland ähnliche Konzepte. Er gelangt unter anderem zu dem Ergebnis, dass der bundesdeutschen Kompetenzsystematik durch die erhöhte Bewegungsfreiheit der Länder, Elemente eines lernenden Föderalismus hinzugefügt werden und leistet hiermit einen Beitrag zu der Diskussion um das Abweichungsmodell, die sich bisher noch auf keinen reichhaltigen Erfahrungsschatz beziehen kann.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–10 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–10
- 11–14 Abkürzungsverzeichnis 11–14
- 15–19 Kapitel 1: Einführung 15–19
- 15–18 A. Problemstellung 15–18
- 18–19 B. Konzeption und Vorgehensweise der Arbeit 18–19
- 20–124 Kapitel 2: Die Abweichungsgesetzgebung nach dem Grundgesetz 20–124
- 20–23 A. Begriffsfestlegungen 20–23
- 20–21 I. Der Begriff der konkurrierenden Gesetzgebung bis 2006 20–21
- 21–23 II. Begrifflichkeiten um den Art. 72 Abs. 3 GG 21–23
- 23–48 B. Geschichte des Modells 23–48
- 23–24 I. Überlegungen bezüglich einer „subsidiären Bundesgesetzgebung“ für die Weimarer Reichsverfassung 23–24
- 24–27 II. Heinsens Sondervotum im Rahmen der Enquete Kommission 1976 24–27
- 27–28 III. Van Nes Ziegler Kommission 27–28
- 28–29 IV. Hessens Vorschlag während der Gemeinsamen Verfassungskommission 1994 28–29
- 29–30 V. Bertelsmann-Kommission „Verfassungspolitik & Regierungsfähigkeit“ 2000 29–30
- 30–31 VI. Nordrhein-westfälischer Vorschlag 2001 30–31
- 31–31 VII. Saarländischer Vorschlag 2001 31–31
- 31–32 VIII. Vorschlag der Enquete-Kommission des Bayerischen Landtags 2002 31–32
- 32–33 IX. Lübecker Erklärung der deutschen Landtage 2003 32–33
- 33–33 X. Ministerpräsidentenkonferenz 2003 33–33
- 33–44 XI. Gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung 2004 33–44
- 1. Der Auftrag der Kommission
- 2. Vorschlag Stünker-Röttgen
- 3. Vorschlag der Länder
- 4. Vorschlag Steenblock
- 5. Weitere Einzelpositionen innerhalb der Kommission
- 6. Würdigung
- 44–45 XII. Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD Ende 2005 44–45
- 45–46 XIII. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD im März 2006 45–46
- 46–48 XIV. Zusammenfassung 46–48
- 48–87 C. Verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Abweichungsgesetzgebung nach Art. 72 Abs. 3 GG 48–87
- 48–52 I. Die Einbettung in die legislative Kompetenzordnung 48–52
- 52–63 II. Der Tatbestand des Art. 72 Abs. 3 GG 52–63
- 1. Übersicht
- 2. Die Rechtsnatur der abweichenden Norm
- 3. Das „spätere“ Gesetz
- 4. Anforderungen an den Norminhalt
- 5. Die sechsmonatige Karenzzeit für Bundesrecht
- 63–70 III. Die Rechtsfolgenanordnung des Art. 72 Abs. 3 S. 3 GG 63–70
- 1. Der Anwendungsbereich
- 2. Der Anwendungsvorrang des späteren Gesetzes
- 3. Partielles Bundesrecht
- 70–80 IV. Systematische Einordnung des Art. 72 Abs. 3 S. 3 GG 70–80
- 1. Kollisionsvermeidung oder Kollisionsbereinigung
- 2. Das Verhältnis zu Art. 31 GG
- 3. Das Verhältnis zum Satz „lex posterior derogat legi priori“
- 80–84 V. Exkurs: Suspension auch durch verfassungswidriges Recht? 80–84
- 84–86 VI. Lückenauslegung 84–86
- 86–87 VII. Zusammenfassung 86–87
- 87–103 D. Schranken der Abweichungsgesetzgebung 87–103
- 87–93 I. Abweichungsfeste Sektoren. Insbesondere die Grundsätze des Naturschutzes 87–93
- 93–94 II. Die Übergangsregelung des Art. 125b Abs. 1 S. 3 GG 93–94
- 94–98 III. Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens 94–98
- 98–100 IV. Vertrauensschutz und Kontinuitätsgewähr 98–100
- 100–101 V. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 100–101
- 101–101 VI. Höherrangiges Recht 101–101
- 101–103 VII. Zusammenfassung 101–103
- 103–123 E. Die Abweichungsoption innerhalb der Verwaltungskompetenzen 103–123
- 103–105 I. Normsetzung gemäß Art. 84 Abs. 1 GG nach der Reform 2006 103–105
- 105–110 II. Die formelle Abweichungsgesetzgebung im System der Gesetzgebung 105–110
- 110–115 III. Der Regelungsvorbehalt nach Art. 84 Abs. 1 S. 5 – 6 GG als Grenze der Abweichung 110–115
- 115–122 IV. Verhältnis von materiellen und formellen Normen 115–122
- 1. Der Durchgriff des materiellen Abweichungsrechts
- 2. Fortbestand der Einheitsthese
- 3. Die Hinfälligkeit des Begriffs der „doppelgesichtigen Norm“
- 122–123 V. Zusammenfassung 122–123
- 123–124 F. Zusammenfassung 123–124
- 125–162 Kapitel 3: Parallelen in anderen Bundesstaaten 125–162
- 125–127 A. Vorbemerkungen 125–127
- 125–126 I. Ziel der Untersuchung 125–126
- 126–127 II. Methode der Untersuchung 126–127
- 127–145 B. Kanada 127–145
- 127–132 I. Die Legislative in der kanadischen Verfassung 127–132
- 1. Historisch-kultureller Hintergrund
- 2. Überblick über die Kompetenzverteilung
- 3. Felder überlappender Gesetzgebung und Normenkollisionen
- 132–143 II. Legislative Sonderwege der Provinzen 132–143
- 1. Opting out im Rahmen des amending-Verfahrens
- 2. Opting out in mischfinanzierten Gesetzgebungsprogrammen
- 3. Override power in der kanadischen Charter of Rights and Freedoms
- 143–145 III. Zusammenfassung und Bewertung 143–145
- 145–157 C. Österreich 145–157
- 145–148 I. Die Legislative in der österreichischen Verfassung 145–148
- 1. Die bundesstaatliche Verfassung
- 2. Überblick über die Gesetzgebungszuständigkeiten
- 148–151 II. Konkurrierende Zuständigkeiten und Normenkollisionen 148–151
- 151–154 III. Die Anwendung des lex-posterior-Grundsatzes 151–154
- 154–155 IV. Das Schicksal der älteren Norm 154–155
- 155–157 V. Zusammenfassung und Bewertung 155–157
- 157–162 D. Gesamtbetrachtung und Vergleich der Systeme 157–162
- 163–207 Kapitel 4: Bundesstaatsdogmatische Aspekte 163–207
- 163–163 A. Einleitung 163–163
- 163–171 B. Aspekte des Demokratieprinzips 163–171
- 163–165 I. Verhältnis von Bundesstaatlichkeit und Demokratie 163–165
- 1. Zur Verwandtschaft der Prinzipien
- 2. Die Nähe der Entscheidungen
- 165–171 II. Der Beitrag der Abweichungsgesetzgebung 165–171
- 1. Partielle Abkehr vom Exekutivföderalismus
- 2. Zur integrativen Wirkung der nahen Entscheidungen
- 171–175 C. Aspekte der Rechtsstaatlichkeit 171–175
- 171–173 I. Verändertes Gesicht der vertikalen Gewaltenteilung 171–173
- 173–175 II. Drei Quellen der Rechtsunsicherheit 173–175
- 175–184 D. Aspekte der Staatsorganisation 175–184
- 175–179 I. Bundesstaatlichkeit im Lichte der Staatsorganisation 175–179
- 1. Einheit in Vielfalt
- 2. Konflikt, Kompromiss und Experiment
- 179–184 II. Berührungspunkte mit der Abweichungsgesetzgebung 179–184
- 1. Der Primat der unteren Ebenen – eine verfassungshistorische Note
- 2. Der lernende Föderalismus
- 184–188 E. Die Abweichungsgesetzgebung als Element eines asymmetrischen Bundesstaates 184–188
- 188–197 F. Europarechtliche Gesichtspunkte 188–197
- 188–193 I. Nachhaltigkeit der länderseitigen Abweichungsbefugnis 188–193
- 193–197 II. Reduzierbarkeit der Vertragsverletzungsverfahren 193–197
- 197–207 G. Die Abweichungsgesetzgebung im Lichte des unitarischen Bundesstaates 197–207
- 197–198 I. Begriff der Unitarisierung 197–198
- 198–204 II. Exkurs: Die Unitarisierung des deutschen Bundesstaates bis 2006 198–204
- 204–207 III. Das Verhältnis der Abweichungsgesetzgebung zur Unitarisierung 204–207
- 208–210 Kapitel 5: Zusammenfassung und Thesen 208–210
- 211–221 Literaturverzeichnis 211–221