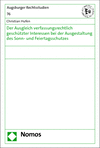Der Ausgleich verfassungsrechtlich geschützter Interessen bei der Ausgestaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes
Zusammenfassung
In der deutschen Rechtsordnung existieren zahlreiche Rechtsvorschriften zum Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe. Vor dem Hintergrund der sich vollziehenden gesellschaftlichen Veränderungen, vor allem der voranschreitenden Säkularisierung einerseits und dem Zuwachs des nichtchristlichen Bevölkerungsteils andererseits, stellt sich die Frage, ob der gegenwärtige Bestand der gesetzlich geschützten Feiertage sowie die Gesetze zu dessen Schutz noch geboten erscheinen.
Diese gleichsam politischen Fragen, der sich die Gesetzgeber des Bundes und der Länder gegenüber sehen, befinden sich in einem verfassungsrechtlichen Spannungsfeld, das diese Arbeit analysiert. Der grundsätzlich vorhandene gesetzgeberische Spielraum beim Sonn- und Feiertagsschutz wird zu beiden Seiten begrenzt. Der jeweilige Gesetzgeber darf den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe nicht restlos aufgeben, andererseits darf er aber auch nicht mit zu weitgehenden Verboten die Rechte der Bürger unverhältnismäßig einschränken. Die verfassungsrechtlichen Grenzen und Spielräume werden im Hinblick auf die gegenwärtigen Reformdiskussionen dargestellt.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–22 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–22
- 23–26 Abkürzungsverzeichnis 23–26
- 27–28 Einleitung 27–28
- 29–89 1. Teil: Schutz religiöser Feiertage durch formelle Gesetze 29–89
- 29–63 I. Feiertagsgesetze der Länder 29–63
- 29–35 1. Religiöse Feiertage als staatlich anerkannte Feiertage - Feiertagsfestsetzung 29–35
- a) Historische Entwicklung
- b) Feiertage nach geltender Rechtslage
- aa) Staatlich anerkannte Feiertage
- bb) »Kirchliche Feiertage«
- cc) »Geschützte Tage«
- dd) »Stille Tage«
- 35–36 2. Der Sonntag als staatlich geschützter Ruhetag 35–36
- 36–63 3. Umfang des Feiertagsschutzes 36–63
- a) Untersagte Handlungen an gesetzlichen Feiertagen und Sonntagen – Allgemeine Handlungsverbote
- aa) Begriffe der Störung sowie der Sonn- und Feiertagsruhe
- aaa) Auf das Schutzgut bezogener Störungsbegriff
- bbb) Merkmal der Eignung zur Störung
- bb) Kasuistik
- aaa) Nach außen hin indifferente Tätigkeiten
- bbb) Automatisierte Betriebe
- cc) Bewertung der Rechtsprechung
- aaa) Vergleichbarkeit unterschiedlich beurteilter Gewerbe
- bbb) Auslegung des Merkmals öffentliche Bemerkbarkeit
- ccc) Auslegung des Merkmals der Geeignetheit zur Störung
- dd) Ausnahmen von Handlungsverboten
- b) Gottesdienstschutz
- aa) Versammlungs- und Veranstaltungsverbote
- bb) Räumliche und zeitliche Komponente der Verbote
- cc) Sonstige Verbote
- c) Schutz der »kirchlichen Feiertage«
- d) Besonderer Schutz stiller Feiertage
- e) Schutz der Kategorie der »geschützten Tage«
- f) Schutz jüdischer Feiertage
- g) Bewehrung von Verstößen gegen Tätigkeitsverbote
- 63–69 II. Ladenschlussgesetze als Ausprägung staatlichen Feiertagsschutzes 63–69
- 63–64 1. Grundsatz des sonn- und feiertäglichen Öffnungsverbots 63–64
- 64–65 2. Ausnahmeregelungen der Landesgesetze 64–65
- 65–66 3. Bäderregelungen 65–66
- 66–68 4. Zusammenfassung 66–68
- 68–69 5. Rechtliche Bewertung 68–69
- 69–83 III. Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 69–83
- 69–70 1. Schutz der Feiertagsruhe 69–70
- 70–82 2. Ausnahmen vom Schutz der Feiertagsruhe 70–82
- a) Katalogtatbestände des § 10 Abs. 1 ArbZG
- aa) Ausnahmen aus Gründen der Daseinsvorsorge
- bb) Ausnahmen aus betriebswirtschaftlichem Interesse
- cc) Ausnahmen zur »Arbeit für den Sonntag« - Freizeitgestaltung
- dd) Sonstige Ausnahmen
- b) Ausnahmen nach § 10 Abs. 2, 3 und 4 ArbZG
- c) Ausnahmen nach §§ 13 und 14 ArbZG
- aa) Rechtsverordnungen nach § 13 Abs. 1 ArbZG
- bb) Rechtsverordnungen nach § 13 Abs. 2 bis 5 ArbZG
- cc) Abweichungen in außergewöhnlichen Fällen nach § 14 ArbZG
- 82–83 3. Verhältnis zu den Landesfeiertagsgesetzen 82–83
- 83–86 IV. § 30 Straßenverkehrsordnung 83–86
- 83–84 1. Gesetzliches Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen 83–84
- 84–85 2. Gesetzesmotive 84–85
- 85–86 3. Ausnahmen vom sonn- und feiertäglichen Fahrverbot 85–86
- 86–88 V. Sonstige arbeitsrechtliche Regelungen 86–88
- 86–87 1. Entgeltfortzahlung 86–87
- 87–87 2. Mutterschutz 87–87
- 87–88 3. Jugendarbeitsschutz 87–88
- 88–89 VI. Strafrechtliche und zivilverfahrensrechtliche Regelungen 88–89
- 88–88 1. Strafrecht 88–88
- 2. Zivilrecht und Prozessrecht
- 89–89 VII. Rundfunkrechtliche Regelungen 89–89
- 90–90 VIII.Rechtsvergleichende Betrachtung 90–90
- 90–90 1. Europäisches Ausland 90–90
- 91–91 2. Vereinigte Staaten und Israel 91–91
- 92–92 3. Bewertung 92–92
- 93–93 2. Teil: Verfassungsrechtliche Anforderungen an Feiertagsschutz 93–93
- I. Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139 WRV
- 94–140 1. Gewährleistungsinhalt 94–140
- 94–100 a) Normzwecke 94–100
- 94–95 aa) Sozialpolitisches Motiv 94–95
- 95–96 bb) Kirchenpolitisches Motiv 95–96
- 96–98 cc) Verhältnis der Normzwecke zueinander 96–98
- 98–100 dd) Funktion des kulturellen Identitätsmerkmals 98–100
- 100–100 ee) Fazit 100–100
- 100–121 b) Institutionelle Garantie 100–121
- 100–106 aa) Zur Rechtsfigur 100–106
- aaa) Existenz der institutionellen Garantie
- bbb) Herleitung von institutionellen Garantien
- (1) Allgemeine Ansätze
- (a) Begriff der Einrichtung
- (b) Einrichtungsgarantien im Abwägungsprozess
- (2) Herleitung aus Art. 139 WRV
- 106–121 bb) Inhalt der Einrichtungsgarantie: Mindestanforderungen des Sonn- und Feiertagsschutzes 106–121
- aaa) Anzahl und Konkretisierung der geschützten Tage
- (1) Bestandsschutz bestimmter Tage
- (2) Mindestzahl gesetzlich anerkannter Feiertage
- (3) Auswahl der anerkannten Feiertage
- (a) Gesellschaftliche Anerkennung der Feiertage
- (b) Arbeitsruhe und seelische Erhebung als Auswahlkriterien
- (c) Tradition als Auswahlkriterium
- (d) Demographie als Auswahlkriterium
- (aa) Aktuelle Entwicklung
- (bb) Schlussfolgerungen aus der Entwicklung
- bbb) Umfang des inhaltlich geschützten Bestandes
- (1) Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers und Untermaßverbot
- (2) Reichweite des verfassungsrechtlich geforderten Arbeitsverbotes
- (a) Das von Art. 139 WRV verlangte Regel- Ausnahme-Verhältnis
- (b) Der besondere Tagescharakter
- (c) Gottesdienstschutz
- (d) Garantie des Rechtsfriedens
- (e) Fazit
- 121–140 c) Art. 139 WRV als subjektives Recht 121–140
- 121–138 aa) Subjektives Individualrecht 121–138
- aaa) Einrichtungsgarantie als möglicher Ausschlussgrund
- bbb) Grundrechtsnähe des Art. 139 WRV
- ccc) Subjektivrechtl. Charakter aufgrund der Normzwecke
- ddd) Argument der Entpersonalisierung
- eee) Systematische Erwägungen
- fff) Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Ladenschlussgesetz
- (1) Grundrechtsannahme aus Art. 139 WRV i.V.m. Art. 4 GG
- (2) Zusammenspiel von Art. 139 WRV und Grundrechtsnormen
- (3) Bewertung
- ggg) Inhalt des subjektiven Individualrechts
- (1) Abgrenzung zu Grundrechten
- (2) Individualschutz des besonderen Tagescharakters
- hhh) Fazit
- (1) Subjektives Abwehrrecht aus Art. 139
- (2) Teilhaberecht aus Art. 139 WRV
- 138–140 bb) Subjektives Recht der Religionsgemeinschaften 138–140
- aaa) Hinsichtlich der religiösen Komponente und der Wahrungdes Charakters
- bbb) Hinsichtlich des sozialpolitischen Zwecks der Arbeitsruhe
- 140–145 2. Auslegung des Art. 139 WRV im Bedeutungswandel 140–145
- 140–141 a) Beachtung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Rahmen des Art. 139 WRV 140–141
- 141–142 b) Spannungsverhältnis zu Grundrechten 141–142
- 142–145 c) Gesetzgeberische Pflicht zur Anpassung des Sonn- und Feiertagsschutzes? 142–145
- 142–143 aa) Grundsatz des legislatorischen Spielraums 142–143
- 143–145 bb) Berücksichtigungsfähige Aspekte 143–145
- aaa) Orientierung an gesellschaftlichen Bedürfnissen zur Sozialsynchronisation
- bbb) Säkularisierung
- ccc) Zuwachs anderer Religionen
- II. Landesverfassungsrechtliche Bestimmungen
- 145–145 1. Überblick 145–145
- 146–146 2. Mit Art. 139 WRV vergleichbare Schutzzwecke 146–146
- 146–147 3. Hinter Art. 139 WRV zurückbleibende Schutzintentionen 146–147
- 148–151 4. Über Art. 139 WRV hinausgehende Schutzintentionen 148–151
- 148–148 a) Art. 14 Brandenburgische Verfassung 148–148
- b) Art. 3 Abs. 1 LVBW
- 148–149 aa) Inhalt 148–149
- 149–151 bb) Kollision mit Art. 139 WRV 149–151
- III. Christliche Verfassungstradition als verfassungsrechtliches Prinzip
- 151–152 1. Versuche der Annahme einer christlichen Prägung der Rechtsordnung 151–152
- 153–153 2. Präambel als Ausgangspunkt für die Annahme einer christlichen Prägung 153–153
- 154–154 3. Herleitung einer christlichen Prägung aus wesentlichen Verfassungsgrundsätzen 154–154
- 155–155 4. Herleitung einer christlichen Prägung aus der gesetzlichen Anordnung von Eidesformeln 155–155
- 155–158 5. Bewertung 155–158
- 159–160 3. Teil: Grundrechtliche Bezüge des Feiertagsschutzes 159–160
- I. Konkurrenz der geförderten Grundrechte
- 160–164 1. Verhältnis zwischen Art. 139 WRV und Grundrechten 160–164
- a) Verdrängung
- 164–164 b) Idealkonkurrenz 164–164
- 164–166 2. Eingriffskonkurrenz 164–166
- 167–167 3. Keine Schutzbereichseröffnung des geförderten Grundrechts 167–167
- 168–169 4. Fälle der Verstärkungswirkung bei fehlendem Grundrechtseingriff 168–169
- 170–175 5. Eingriffsäquivalent bei der Grundrechtsdimension der Leistungsrechte 170–175
- 170–172 a) Bagatellgrenze in der abwehrrechtlichen Dimension 170–172
- 172–173 b) Erforderlichkeit eines Bagatellvorbehaltes bei Schutzpflichten 172–173
- 173–175 c) Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle 173–175
- II. Religionsfreiheit - Art. 4 Abs. 1 und 2 GG
- 175–175 1. Schutzbereichseröffnung 175–175
- 176–177 2. Grundsätzliche Herleitung einer Schutzpflicht aus Art. 4 GG 176–177
- 178–178 3. Schutzpflicht hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Feiertage 178–178
- 179–182 4. Schutzpflicht hinsichtlich des Arbeits- und Beschäftigungsverbotes 179–182
- 179–180 a) Schutzpflicht hinsichtlich der Teilnahme an Kultushandlungen 179–180
- 180–182 b) Generelle Sonntagsruhe als Ausdruck religiöser Überzeugung 180–182
- 183–184 5. Schutzpflicht hinsichtlich Sicherung des »besonderen Charakters« 183–184
- 185–187 6. Schutzpflicht hinsichtlich des Ladenschlusses 185–187
- III. Recht auf Ehe und Familie - Art. 6 Abs. 1 GG
- 187–187 1. Schutzbereichseröffnung 187–187
- 188–190 2. Schutzpflicht zur Gewährleistung familiären Zusammenlebens 188–190
- IV. Versammlungsfreiheit - Art. 8 Abs. 1 GG
- 190–190 1. Schutzbereich 190–190
- 191–193 2. Schutzpflicht der allgemeinen Arbeitsruhe 191–193
- V. Vereinigungsfreiheit – Art. 9 Abs. 1 GG
- 193–193 1. Schutzbereich 193–193
- 193–195 2. Schutzpflicht der allgemeinen sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe 193–195
- VI. Recht auf Leben und Gesundheit - Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG
- 195–195 1. Schutzbereich 195–195
- 195–197 2. Aktivierung der staatlichen Schutzpflicht 195–197
- VII. Menschenwürde - Art. 1 Abs. 1 GG
- 197–197 1. Schutzbereich 197–197
- 198–198 2. Verletzung der staatlichen Schutzpflicht 198–198
- 199–199 VIII.Subjektive Rechte der Religionsgemeinschaften aus Staatsverträgen 199–199
- 199–200 1. Staatskirchenverträge 199–200
- 201–202 2. Folgen für rechtliche Abwägung 201–202
- 203–203 4. Teil: Kollidierendes Verfassungsrecht 203–203
- I. Feiertagsauswahl
- 203–204 1. Das Recht auf Gleichbehandlung 203–204
- a) Grundsätze
- 204–204 b) Ungleichbehandlung bei der Feiertagsanerkennung 204–204
- 205–205 2. Eingriff in die Glaubens-, Weltanschauungs- und Bekenntnisfreiheit 205–205
- 206–206 3. Negative Glaubens-, Weltanschauungs- und Bekenntnisfreiheit 206–206
- II. Beeinträchtigungen durch Arbeits- und Handlungsverbote der LFtG
- 206–207 1. Berufsfreiheit – Art. 12 Abs. 1 GG 206–207
- a) Schutzbereichseröffnung
- 207–207 b) Eingriff durch Arbeits- und Handlungsverbote 207–207
- 208–212 2. Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 3 GG 208–212
- 208–210 a) Schutzbereich 208–210
- 210–212 b) Eingriff 210–212
- 213–215 3. Glaubens-, Weltanschauungs- und Bekenntnisfreiheit – Art. 4 Abs. 1, 2 GG 213–215
- a) Schutzbereich
- 213–214 aa) Religionsausübungsfreiheit 213–214
- 214–215 bb) Weltanschauungsfreiheit 214–215
- 215–215 b) Eingriff 215–215
- 216–237 4. Negative Glaubens-, Weltanschauungs- und Bekenntnisfreiheit – Art. 4 Abs. 1, 2 GG 216–237
- 216–223 a) Schutzbereich 216–223
- 216–222 aa) Inhalt der negativen Religionsfreiheit 216–222
- aaa) Negative Freiheit als Negation der positiven Freiheit
- bbb) Ausprägungen der negativen Religionsfreiheit in der WRV
- ccc) Reichweite der negativen Religionsfreiheit
- 222–223 bb) Speziell: Die Verschonung von religiösen Inhalten durch staatliche Handlungen 222–223
- 223–237 b) Eingriff 223–237
- 223–225 aa) Eingriffe in die negative Religionsfreiheit in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 223–225
- 225–233 bb) Kritik und Bewertung 225–233
- aaa) Grundsätzliche Beeinträchtigung der negativen Religionsfreiheit
- bbb) Das Argument des staatlichen verordneten Atheismus
- ccc) Problem des subjektiven Empfindens der Beeinträchtigung
- (1) Subjektive Auffassung staatlicher Symbolik
- (2) Parallele zur Gewissensfreiheit
- ddd) Die »Widerspruchslösung«
- 233–237 cc) Anwendung der Grundsätze auf den Sonn- und Feiertagsschutz 233–237
- 237–237 c) Die negative Religionsfreiheit im Hinblick auf mittelbare Drittwirkung 237–237
- 237–237 5. Die allgemeine Handlungsfreiheit 237–237
- 237–238 6. Gleichheitssatz 237–238
- III. Beeinträchtigungen durch Ladenschlussgesetze
- 238–239 1. Eingriff in die Berufsfreiheit 238–239
- 240–243 2. Pressefreiheit, Art. 5 Abs. 1 GG 240–243
- 240–241 a) Schutzbereich 240–241
- 241–243 b) Eingriff 241–243
- aa) Ladenschlussgesetz (noch geltende Rechtslage in Bayern)
- 243–243 bb) Neue landesgesetzliche Regelungen 243–243
- 244–244 3. Informationsfreiheit, Art. 5 Abs. 1 GG 244–244
- a) Schutzbereich
- b) Eingriff
- 245–246 4. Negative Religionsfreiheit 245–246
- a) Grundrecht der Kunden
- 246–246 b) Grundrecht der Geschäftsinhaber 246–246
- 247–247 5. Eigentumsfreiheit 247–247
- 248–248 6. Allgemeine Handlungsfreiheit 248–248
- 248–248 7. Gleichbehandlungsgrundsatz 248–248
- IV. Beeinträchtigungen durch Versammlungsverbote der LFtG
- 248–248 1. Schutzbereich der Versammlungsfreiheit – Art. 8 Abs. 1 GG 248–248
- 249–250 2. Eingriff 249–250
- V. Besondere Vorschriften zum Schutz der Gottesdienstausübung und der stillen Tage
- 250–251 1. Eingriff in die Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 3 GG 250–251
- 252–252 2. Eingriff in die negative Religionsfreiheit 252–252
- 252–252 3. Die Versammlungsfreiheit 252–252
- 253–254 4. Die Rundfunkfreiheit 253–254
- VI. Rundfunkstaatsverträge
- 254–255 1. Rundfunkfreiheit 254–255
- a) Schutzbereich
- 255–255 b) Eingriff in die Rundfunkfreiheit 255–255
- 256–256 2. Eingriff in die Berufsfreiheit 256–256
- 257–257 3. Eingriff in die negative Religionsfreiheit 257–257
- 258–258 4. Gleichbehandlungsgrundsatz 258–258
- VII. Arbeitszeitgesetz
- 258–258 1. Eigentumsfreiheit 258–258
- 259–259 2. Eingriff in die Berufsfreiheit 259–259
- a) Recht des Arbeitnehmers
- b) Recht des Arbeitgebers
- 260–260 3. Eingriff in die negative Glaubens-, Weltanschauungs- und Bekenntnisfreiheit 260–260
- 260–260 4. Gleichheitssatz 260–260
- 261–261 VIII.Sonstige gesetzliche Regelungen (StVO, MuSchG) 261–261
- 261–261 1. Eingriff in die negative Religionsfreiheit 261–261
- 262–262 2. Eingriff in die Berufsfreiheit 262–262
- IX. Die Wertneutralität des Staates nach Artt. 4 Abs. 1, 3 Abs. 3, 33 Abs. 3, 140 GG, 136 Abs. 1, Abs. 4, 137 Abs. 1 WRV als kollidierendes Verfassungsrecht
- 262–305 1. Dogmatische Herleitung und Inhalt 262–305
- 262–264 a) Historische Entwicklung und soziologischer Hintergrund 262–264
- 264–266 b) verfassungsrechtliche Herleitung 264–266
- 264–265 aa) Religiöse Aspekte im deutschen Verfassungsrecht 264–265
- 265–266 bb) Verortung des Neutralitätsgebots im Grundgesetz 265–266
- 266–305 c) Unterschiedliche Neutralitätskonzepte 266–305
- 266–274 aa) Strikte Trennungsthesen 266–274
- aaa) Krüger
- bbb) Fischer
- ccc) Czermak
- ddd) Renck
- eee) Kleine
- 274–279 bb) Positive Neutralität des Staates gegenüber Religionen und Weltanschauungen 274–279
- aaa) Heckel
- bbb) Schlaich
- 279–280 cc) Hierarchisierungsmodell (Ladeur/Augsberg) 279–280
- 280–285 dd) Begründungsneutralität 280–285
- aaa) Abgrenzung zur Wirkungsneutralität
- bbb) Normative Herleitung
- ccc) Vereinbarkeit mit »positivem« Neutralitätsverständnis
- 285–299 ee) Bewertung 285–299
- aaa) Krüger
- bbb) Fischer
- ccc) Czermak und Renck
- ddd) Kleine
- eee) Ladeur/Augsberg
- fff) Schlaich
- ggg) Heckel
- hhh) Begründungsverbot Husters
- 299–304 ff) Zusammenfassung 299–304
- aaa) Zulässigkeit oder Erforderlichkeit staatlicher Förderung der Religion
- bbb) Wertneutralität als Gleichbehandlungsgebot
- 304–305 gg) Abwägung des Neutralitätsgebotes 304–305
- 305–305 hh) Subjektives Recht auf staatliche Wertneutralität 305–305
- 306–307 2. Verletzung durch gesetzlichen Sonn- und Feiertagsschutz 306–307
- X. Konkurrenzen
- 307–307 1. Idealkonkurrenz und Abwägungsverbund 307–307
- 308–310 2. Verschiedene Grundrechtsträger 308–310
- 311–311 5. Teil: Ausgleich der verfassungsrechtlichen Interessen 311–311
- I. Praktische Konkordanz
- 311–314 1. Anwendbarkeit der praktischen Konkordanz – Verneinung von Konkurrenzlösungen 311–314
- 311–312 a) Grundsätzliche Unterscheidung von Kollision und Konkurrenz 311–312
- 312–314 b) Suspendierung kollidierender Grundrechte durch Art. 139 WRV i.V.m. Art. 140 GG 312–314
- 314–314 c) Prima-facie-Vorrang von Grundrechten 314–314
- 315–315 2. Grundsätze der praktischen Konkordanz 315–315
- 316–338 3. Regeln des Abwägungsvorganges 316–338
- 316–332 a) Gewichtung des Abwägungsmaterials 316–332
- 316–319 aa) Schwierigkeiten einer pauschalen Skalierung 316–319
- 319–332 bb) Maßstäbe einer relativen Gewichtung 319–332
- aaa) Gewichtung durch Alternativenbetrachtung
- bbb) Abwägungsrelevante Kriterien
- ccc) Das Argument der Konkretisierung
- ddd) Berücksichtigung objektiver Wertgehalte der Grundrechte
- (1) Grundsätze
- (2) Versubjektivierte Gehalte
- eee) Eindeutigkeit des Abwägungsergebnisses
- fff) Notwendigkeit der Begrenzung der Zweckverfolgung
- ggg) Zwischenergebnis zu den Maßstäben
- 332–336 b) Anwendung der Regeln auf die Beurteilung abstrakt-genereller Rechtssätze 332–336
- 332–333 aa) Abstrakt-generelle Konfliktlösung 332–333
- 333–334 bb) Ausnahme- und Ermessensregelungen zur Erzielung von Einzelfallkonkordanz 333–334
- 334–336 cc) Abwägung auf der Stufe der Angemessenheit 334–336
- 336–338 c) Überprüfbarkeit der Abwägungsentscheidung des Gesetzgebers 336–338
- 336–337 aa) Eindeutigkeit der praktischen Konkordanz 336–337
- 337–338 bb) Verständnis des Optimierungsgebotes der praktischen Konkordanz 337–338
- 339–341 4. Standort der praktischen Konkordanz beim Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 339–341
- 342–343 5. Zwischenfazit 342–343
- II. Verfassungsrechtliche Würdigung des bestehenden Feiertagsschutzes
- 343–392 1. Sonn- und Feiertagsgesetze 343–392
- 343–358 a) Feiertagsauswahl 343–358
- 343–356 aa) Ausgleich mit der Religionsfreiheit 343–356
- aaa) Verhältnis der positiven und negativen Religionsfreiheit – Toleranzprinzip
- bbb) Das Toleranzgebot
- (1) Herleitung des Prinzips
- (2) Kritische Würdigung
- (3) Zwischenfazit
- (4) Bedeutung für die Feiertagsauswahl
- ccc) Berücksichtigung der staatlichen Wertneutralität
- (1) Festsetzung des Sonntags als wöchentlicher Ruhetag
- (2) Festlegung der gesetzlichen Feiertage
- (3) Pflicht zur Anerkennung nichtchristlicher Feiertage
- 356–358 bb) Gleichheitssatz des Art. 3 GG 356–358
- aaa) Schutz des Sonntages
- bbb) Anerkennung gesetzlicher Feiertage
- 358–358 cc) Gesamtwürdigung und Ergebnis 358–358
- 358–392 b) Inhaltliche Ausgestaltung des Feiertagsschutzes durch die Landesfeiertagsgesetze (Handlungs- und Versammlungsverbote) 358–392
- 358–359 aa) Belange zugunsten des Sonn- und Feiertagsschutzes 358–359
- 359–367 bb) Allgemeine Handlungsverbote 359–367
- aaa) Berufsfreiheit
- (1) Konkurrentenschutz als beachtlicher Belang
- (2) Auslegung des Merkmals »Geeignetheit zur Störung«
- (3) Problematik der automatisierten Betriebe
- bbb) Kunstfreiheit
- ccc) Negative Religionsfreiheit
- ddd) Allgemeine Handlungsfreiheit
- 367–374 cc) Besondere Handlungs- und Veranstaltungsverbote 367–374
- aaa) Kunstfreiheit
- bbb) Allgemeine Handlungsfreiheit
- ccc) Religionsfreiheit
- ddd) Staatliche Wertneutralität
- 374–376 dd) Versammlungsverbot 374–376
- aaa) Störung der Sonn- und Feiertagsruhe durch Versammlungen
- bbb) Zweck der Versammlungsfreiheit
- ccc) Störungsabhängige Versammlungsverbote
- 376–380 ee) Verbot von Unterhaltungsveranstaltungen 376–380
- 380–381 ff) Verbote zum Schutz der »stillen Tage« 380–381
- 381–392 gg) Gesamtabwägung 381–392
- aaa) Allgemeine Handlungsverbote
- (1) Vorverlagerung des Sonn- und Feiertagsschutzes durch das Merkmal der Geeignetheit zur Störung
- (2) Allgemeinheit der Handlungsverbote
- (3) Ausnahmevorschriften
- (4) Gesamtbewertung unter Berücksichtigung des additiven Grundrechtseingriffs
- bbb) Handlungsverbote zum Schutz der Gottesdienste
- (1) Verbot von Handlungen, die zur Störung geeignet sind
- (2) Verbot konkreter Störungen
- 393–411 2. Ladenschlussrecht 393–411
- 393–397 a) Berufsfreiheit 393–397
- 393–395 aa) Eingriff in Erwerbsmöglichkeiten aus Gründen des Arbeits- und Wettbewerbsschutzes 393–395
- 395–396 bb) Benachteiligung gegenüber E-Commerce 395–396
- 396–397 cc) Berufsfreiheit der Arbeitnehmer 396–397
- 397–397 dd) Zwischenergebnis 397–397
- 397–399 b) Presse- und Informationsfreiheit 397–399
- 399–400 c) Allgemeine Handlungsfreiheit 399–400
- 400–401 d) Gleichbehandlungsgrundsatz 400–401
- 401–411 e) Gesamtabwägung 401–411
- 401–402 aa) Rechtfertigung von Eingriffen 401–402
- 402–411 bb) Zulässigkeit von Ausnahmeregelungen 402–411
- aaa) Verkaufsoffene Sonntage – Rechtsprechung zum Berliner Ladenschlussgesetz 2009
- bbb) Einordung des Urteils
- ccc) Konsequenzen aus der Rechtsprechung
- ddd) Ausnahmen zugunsten bestimmter Geschäftszweige
- eee) Bäderregelung
- (1) Besondere Interessenlage
- (2) Bedeutung des in Art. 139 WRV enthaltenen Regel-Ausnahmeverhältnisses
- (3) Anlassabhängige Verkaufssonntage
- 411–411 f) Zwischenergebnis 411–411
- 411–422 3. Arbeitszeitgesetz 411–422
- 411–412 a) Berufsfreiheit 411–412
- 412–421 b) Belange zugunsten des Sonn- und Feiertagsschutzes – Frage nach zu weitgehenden Ausnahmen 412–421
- 412–420 aa) Arbeit trotz des Sonntages 412–420
- aaa) Daseinsvorsorge
- bbb) Presse und Rundfunk
- ccc) Betriebswirtschaftliches Interesse
- (1) § 10 Abs. 2 Nr. 13 ArbZG
- (2) § 10 Abs. 2 Nr. 14 ArbZG
- (3) § 10 Abs. 2 Nr. 13 ArbZG
- ddd) Ermächtigung zu Rechtsverordnungen und Ausnahmebewilligungen
- 420–421 bb) Arbeit für den Sonntag 420–421
- 421–422 c) Gleichheitswidrigkeit der Ausnahmeregelungen 421–422
- 422–422 d) Zwischenergebnis 422–422
- 422–430 4. Sonstige Regelungen 422–430
- 422–423 a) § 30 Abs. 3 StVO 422–423
- 423–424 b) Sonstige arbeitsschutzrechtliche Regelungen 423–424
- 424–428 c) Entgeltfortzahlung 424–428
- 424–425 aa) Art. 14 GG 424–425
- 425–428 bb) Art. 3 GG 425–428
- aaa) Problematik von Arbeitsfreistellung und Lohnfortzahlung
- bbb) Vorhandene Regelungen in Bayern und Hamburg
- ccc) Kompetenz der Länder
- 428–429 d) Rundfunkstaatsvertrag 428–429
- 429–430 e) Zivilrecht und Verfahrensrecht 429–430
- 431–442 6. Teil: Ausblick und Thesen 431–442
- 431–431 I. Verfassungsrechtliche Offenheit für neue Wege des Feiertagsschutzes? 431–431
- II. Wesentliche Ergebnisse der Arbeit in Thesen
- 443–452 Literaturverzeichnis 443–452