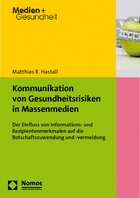Kommunikation von Gesundheitsrisiken in Massenmedien
Der Einfluss von Informations- und Rezipientenmerkmalen auf die Botschaftszuwendung und -vermeidung
Zusammenfassung
Das Ziel, Menschen besser für leicht vermeidbare Gesundheitsrisiken zu sensibilisieren, zählt zu den größten Herausforderungen der Gesundheitskommunikation. Der vorliegende Band untersucht, welche Eigenschaften von Gesundheitsbotschaften und potenziellen Rezipienten darüber entscheiden, ob solche Botschaften Zuwendung oder Vermeidung – als Voraussetzung für jede Wirkung – erfahren. Die Botschaftsmerkmale Bedrohlichkeit, Selbstwirksamkeit und Evidenzart stehen im Zentrum der Analysen. Ergebnisse einer experimentellen Studie in Deutschland und den USA zeigen, dass bestimmte Merkmalskombinationen deutliche Aufmerksamkeitssteigerungen und -reduzierungen bewirken, wobei sich länderspezifische Zuwendungspräferenzen ergeben.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–14 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–14
- 15–24 1. Problemstellung und Untersuchungsgegenstand 15–24
- 15–22 1.1 Metatheoretische und interdisziplinäre Verortung 15–22
- 22–23 1.2 Relevanz der Forschungsfragen 22–23
- 23–24 1.3 Vorgehen 23–24
- 25–42 2. Gesundheit und Gesundheitskommunikation 25–42
- 25–31 2.1 Gesundheit und Krankheit 25–31
- 25–26 2.1.1 Subjektive Gesundheits- und Krankheitsverständnisse 25–26
- 26–28 2.1.2 Wissenschaftliche Sichtweisen 26–28
- 28–31 2.1.3 Zusammenfassung 28–31
- 31–40 2.2 Gesundheitsbotschaften in Massenmedien 31–40
- 31–33 2.2.1 Arbeitsdefinition 31–33
- 33–34 2.2.2 Vorkommen und Nutzung 33–34
- 34–36 2.2.3 Angst- bzw. Furchtappelle 34–36
- 36–40 2.2.4 Normative Anforderungen und Abwägungen 36–40
- 40–42 2.3 Zusammenfassung 40–42
- 43–56 3. Selektive Botschaftszuwendung und -vermeidung 43–56
- 43–44 3.1 Selektion und Selektivität 43–44
- 44–47 3.2 Aufmerksamkeit 44–47
- 47–51 3.3 Vermeidungsverhalten 47–51
- 47–48 3.3.1 Botschaftsvermeidung 47–48
- 48–49 3.3.2 Defensivität 48–49
- 49–51 3.3.3 Reaktanz und Bumerangeffekt 49–51
- 51–55 3.4 Rezeption als Zuwendungs- und Vermeidungsverhalten 51–55
- 51–53 3.4.1 Differenzierungen von Rezeptionsverhalten 51–53
- 53–55 3.4.2 Rezeptionsverhalten als Approach/Avoidance 53–55
- 3.4.2.1 Behaviorales Aktivierungssystem (BAS)
- 3.4.2.2 Behaviorales Inhibitionssystem (BIS)
- 3.4.2.3 BAS/BIS und die Modellierung von Rezeptionsverhalten
- 55–56 3.5 Zusammenfassung 55–56
- 57–100 4. Botschaftsmerkmal Bedrohlichkeit 57–100
- 57–72 4.1 Konstruktexplikation 57–72
- 57–61 4.1.1 Bedrohung und Bedrohlichkeit 57–61
- 61–62 4.1.2 Risiko 61–62
- 62–63 4.1.3 Gefahr und Risiko aus rechtlicher Perspektive 62–63
- 63–69 4.1.4 Angst, Ängstlichkeit und Furcht 63–69
- 4.1.4.1 Furcht
- 4.1.4.2 Angst
- 69–72 4.1.5 Differenzierungen von Bedrohlichkeit 69–72
- 72–81 4.2 Bedrohlichkeit und Botschaftszuwendung 72–81
- 72–75 4.2.1 Evolutionstheoretische und biophysiologische Annahmen 72–75
- 75–78 4.2.2 Nützlichkeit von Botschaften: Informational Utility 75–78
- 78–79 4.2.3 Bedrohlichkeit als Nachrichtenwert 78–79
- 79–80 4.2.4 Rational Choice 79–80
- 80–81 4.2.5 Comprehensive Model of Information Seeking 80–81
- 81–89 4.3 Bedrohlichkeit und Botschaftsvermeidung 81–89
- 81–82 4.3.1 Eskapismus 81–82
- 82–84 4.3.2 Negativer Affekt 82–84
- 84–86 4.3.3 Dissonanzreduktion 84–86
- 86–88 4.3.4 Vermeidung von Todessalienz 86–88
- 88–89 4.3.5 Abwehr von Beeinflussung 88–89
- 89–94 4.4 Bedrohlichkeit und Zuwendung/Vermeidung 89–94
- 89–91 4.4.1 Triebreduktionsmodell 89–91
- 91–92 4.4.2 Parallel Response Model 91–92
- 92–94 4.4.3 Personality Model of Coping 92–94
- 94–98 4.5 Individuelle Unterschiede 94–98
- 94–95 4.5.1 Demografische Merkmale 94–95
- 95–98 4.5.2 Traits 95–98
- 4.5.2.1 Dispositionelle Ängstlichkeit
- 4.5.2.2 Repression-Sensitization
- 4.5.2.3 Unsicherheitstoleranz
- 98–100 4.6 Zusammenfassung 98–100
- 101–114 5. Botschaftsmerkmal Selbstwirksamkeit 101–114
- 101–105 5.1 Konstruktexplikation 101–105
- 105–108 5.2 Selbstwirksamkeit und Botschaftszuwendung 105–108
- 105–107 5.2.1 Selbstwirksamkeit in Ansätzen des Gesundheitsverhaltens 105–107
- 107–108 5.2.2 Selbstwirksamkeit und Reaktanz 107–108
- 108–109 5.3 Selbstwirksamkeit und Botschaftsvermeidung 108–109
- 109–112 5.4 Individuelle Unterschiede 109–112
- 112–114 5.5 Zusammenfassung 112–114
- 115–140 6. Bedrohlichkeit und Selbstwirksamkeit in Kombination 115–140
- 115–129 6.1 Zuwendungsansätze 115–129
- 115–120 6.1.1 Ansätze der Informationssuche 115–120
- 6.1.1.1 Theory of Motivated Information Management
- 6.1.1.2 Risk Information Seeking and Processing Model
- 6.1.1.3 Augmented Risk Information Seeking and Processing Model
- 120–124 6.1.2 Furchtappellansätze 120–124
- 6.1.2.1 Health Belief Model
- 6.1.2.2 Protection Motivation Theory
- 124–129 6.1.3 Stufenmodelle des Gesundheitsverhaltens 124–129
- 6.1.3.1 Modell von Block und Keller (1998)
- 6.1.3.2 Health Action Process Approach
- 6.1.3.3 Precaution Adoption Process Model
- 129–135 6.2 Kombinierte Zuwendungs- und Vermeidungsansätze 129–135
- 129–131 6.2.1 Kognitiv-transaktionales Stressmodell 129–131
- 131–133 6.2.2 Extended Parallel Process Model 131–133
- 133–135 6.2.3 Risk Perception Attitude Framework 133–135
- 135–140 6.3 Zusammenfassung 135–140
- 141–172 7. Botschaftsmerkmal Evidenzart 141–172
- 141–147 7.1 Konstruktexplikation 141–147
- 141–143 7.1.1 Summarische Evidenz: Statistiken 141–143
- 143–145 7.1.2 Episodische Evidenz: Fallbeispiele 143–145
- 145–147 7.1.3 Verhältnis zu Bedrohlichkeit und Selbstwirksamkeit 145–147
- 147–150 7.2 Fallbeispieleffekt und Base-Rate Fallacy 147–150
- 150–160 7.3 Evidenzart und Zuwendung/Vermeidung 150–160
- 150–151 7.3.1 Genetische und biophysiologische Prädispositionen 150–151
- 151–153 7.3.2 Lebhaftigkeit von Botschaften: Vividness 151–153
- 153–154 7.3.3 Exemplification Theory 153–154
- 154–156 7.3.4 Sozialer Vergleich 154–156
- 156–157 7.3.5 Kulturelle Adaption 156–157
- 157–158 7.3.6 Narrationsspezifische Aufmerksamkeitseffekte 157–158
- 158–159 7.3.7 Personalisierung als Nachrichtenwert 158–159
- 159–159 7.3.8 Reaktanz 159–159
- 159–160 7.3.9 Negativer Affekt gegenüber Statistiken 159–160
- 160–165 7.4 Individuelle Unterschiede 160–165
- 160–162 7.4.1 Cognitive-Experiential Self-Theory of Personality 160–162
- 162–163 7.4.2 Intuitiv-experientieller und rational-analytischer Denkstil 162–163
- 163–165 7.4.3 Alternative differenzialpsychologische Konzeptionen 163–165
- 165–165 7.4.4 Demografische Merkmale 165–165
- 165–172 7.5 Zusammenfassung 165–172
- 165–167 7.5.1 Evidenzart und Rezeptionsverhalten 165–167
- 167–172 7.5.2 Zusammenfassende Überlegungen 167–172
- 7.5.2.1 Botschaftsmerkmale
- 7.5.2.2 Kulturelle Unterschiede
- 7.5.2.3 Geschlechtsunterschiede
- 7.5.2.4 Botschaftswirkungen
- 173–204 8. Untersuchungsanlage 173–204
- 173–177 8.1 Überblick 173–177
- 177–180 8.2 Versuchsablauf im Detail 177–180
- 177–179 8.2.1 Instruktion 177–179
- 179–180 8.2.2 Rezeptionsphase 179–180
- 180–180 8.2.3 Online-Fragebogen 180–180
- 180–180 8.2.4 Debriefing 180–180
- 180–182 8.3 Versuchspersonen 180–182
- 182–191 8.4 Stimulusmaterial und -präsentation 182–191
- 182–190 8.4.1 Gesundheitsnachrichten 182–190
- 8.4.1.1 Manipulierte Artikel
- 8.4.1.2 Unmanipulierte Artikel
- 8.4.1.3 Überblick- bzw. Startseite
- 190–191 8.4.2 Details zur Programmierung 190–191
- 191–195 8.5 Pretests 191–195
- 191–194 8.5.1 Pretest des Stimulusmaterials 191–194
- 194–195 8.5.2 Test des Versuchsablaufs und der Fragebogenverständlichkeit 194–195
- 195–197 8.6 Erhebung des Zuwendungsverhaltens 195–197
- 197–204 8.7 Erhebung von Selbstaussagen 197–204
- 197–198 8.7.1 Bewertung des Online-Nachrichtenmagazins 197–198
- 198–199 8.7.2 Emotionen in der Rezeptionssituation 198–199
- 199–201 8.7.3 Differentielle Persönlichkeitsmerkmale 199–201
- 8.7.3.1 Dispositionelle Ängstlichkeit
- 8.7.3.2 Gesundheitliche Kontrollüberzeugung
- 8.7.3.3 Ungewissheitstoleranz
- 8.7.3.4 Aufmerksamkeitsstil (Represser versus Sensitizer)
- 8.7.3.5 Informationsverarbeitungsstile
- 201–203 8.7.4 Gesundheitsrisikobezogene Einstellungen 201–203
- 203–204 8.7.5 Kontrollvariablen 203–204
- 204–204 8.7.6 Sonstige Fragebogeninhalte 204–204
- 205–268 9. Ergebnisse 205–268
- 205–216 9.1 Vorabanalysen 205–216
- 205–206 9.1.1 Beschreibung der Stichprobe 205–206
- 206–208 9.1.2 Manipulationsunabhängiges Zuwendungsverhalten 206–208
- 208–210 9.1.3 Interne Konsistenz und Korrelationen der Persönlichkeitsskalen 208–210
- 210–210 9.1.4 Konsistenz und Zusammenhänge der Kontrollvariablen 210–210
- 210–211 9.1.5 Magazinbewertung 210–211
- 211–212 9.1.6 Risikobezogene Botschaftswirkungen 211–212
- 212–212 9.1.7 Zusammenhänge der Zuwendungsindikatoren 212–212
- 212–216 9.1.8 Exploration von Geschlechts- und Länderunterschieden 212–216
- 216–216 9.1.9 Soziale Erwünschtheit 216–216
- 216–219 9.2 Auswertungsstrategie 216–219
- 219–238 9.3 Botschaftsmerkmale und Botschaftsnutzung 219–238
- 219–233 9.3.1 Analysen auf aggregierter Ebene 219–233
- 9.3.1.1 Einfluss von Kontrollvariablen
- 9.3.1.2 Länderunterschiede
- 9.3.1.3 Geschlechtsunterschiede
- 233–236 9.3.2 Analysen auf der Ebene der Einzelartikel 233–236
- 236–238 9.3.3 Zusammenfassung 236–238
- 238–247 9.4 Dispositionelle Rezipientenmerkmale 238–247
- 238–240 9.4.1 Dispositionelle Ängstlichkeit 238–240
- 240–241 9.4.2 Repression/Sensitization 240–241
- 241–242 9.4.3 Unsicherheitstoleranz 241–242
- 242–246 9.4.4 Gesundheitliche Kontrollüberzeugung 242–246
- 246–247 9.4.5 Informationsverarbeitungsstile 246–247
- 247–247 9.4.6 Zusammenfassung 247–247
- 247–268 9.5 Wirkungen der Botschaftsrezeption 247–268
- 247–252 9.5.1 Emotionales Erleben der Rezeptionssituation 247–252
- 252–253 9.5.2 Bewertung des Magazins 252–253
- 253–267 9.5.3 Zuwendung und risikobezogene Einstellungen 253–267
- 267–268 9.5.4 Zusammenfassung 267–268
- 269–284 10. Zusammenfassung und Ausblick 269–284
- 269–272 10.1 Forschungsstand 269–272
- 272–278 10.2 Hauptbefunde der empirischen Studie 272–278
- 272–275 10.2.1 Botschaftsmerkmale 272–275
- 275–276 10.2.2 Geschlechts- und Länderunterschiede 275–276
- 276–277 10.2.3 Dispositionelle Persönlichkeitsunterschiede 276–277
- 277–278 10.2.4 Botschaftszuwendung und -wirkung 277–278
- 278–282 10.3 Limitationen 278–282
- 282–283 10.4 Implikationen für die Gesundheitskommunikationspraxis 282–283
- 283–284 10.5 Ausblick 283–284
- 285–322 Literaturverzeichnis 285–322
- 323–352 Anhang 323–352