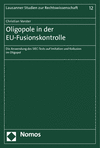Oligopole in der EU-Fusionskontrolle
Die Anwendung des SIEC-Tests auf Imitation und Kollusion im Oligopol
Zusammenfassung
Der SIEC-Test soll Wettbewerbsbehinderungen im Oligopol erfassen. Der Autor zeigt in einer rechtsökonomischen Analyse die strukturellen Schwächen der bekannten Ansätze auf: Das Konzept der koordinierten Effekte (Kollusion) erfasst „zu wenige“ und das der unilateralen Effekte „zu viele“ Fälle.
Die Studie entwickelt als bessere Lösung das „Konzept der Imitation“, bei dem ein Imitationsverhalten der Oligopolisten zu einer Behinderung dynamischen Wettbewerbs führt. Dieses Konzept basiert auf moderner Verhaltensökonomik und erfasst alle Wettbewerbsbehinderungen im Oligopol, auch Fälle einer „Kollusion ohne Bestrafung“, eines sogenannten Oligopolfriedens oder einer Preisführerschaft. Auch für die deutsche Fusionskontrolle, in die der SIEC-Test mit der 8. GWB-Novelle Einzug findet, gelten die Ergebnisse der Analyse. Die Studie entwickelt zudem eine Methodik für den „more economic approach“ im Kartellrecht, mit der ökonomische Ergebnisse in die Auslegung von Rechtsnormen integriert werden können.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–18 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–18
- 19–20 Abkürzungsverzeichnis 19–20
- 21–32 Kapitel 1. Einleitung 21–32
- 21–27 A. Problemstellung 21–27
- 21–24 I. Kritik an dem Konzept der kollektiven Marktbeherrschung 21–24
- 24–25 II. Keine Abhilfe seit der FKVO-Reform 2004 24–25
- 25–27 III. Anlass für das Konzept der Imitation 25–27
- 27–29 B. Vorgehensweise der Arbeit 27–29
- 29–32 C. Begriffsdefinitionen 29–32
- 33–78 Kapitel 2. Eine interdisziplinäre Methodik für die Fusionskontrolle 33–78
- 33–39 A. Spezifisch kartellrechtliche Methodenprobleme 33–39
- 33–35 I. Konkretisierung anhand von „Konzepten“ 33–35
- 35–36 II. Regulative Normstruktur in der Fusionskontrolle 35–36
- 36–39 III. Methodische Probleme der Interdisziplinarität 36–39
- 39–44 B. Die kartellrechtlich-funktionale Auslegung 39–44
- 44–55 C. Die Ökonomische Theorie des Rechts 44–55
- 44–46 I. Rechtstheoretischer Ansatz 44–46
- 46–48 II. Methode 46–48
- 48–49 III. Die Lösung des interdisziplinären Problems 48–49
- 49–51 IV. Die Bewertung mittels des hypothetischen Konsenses 49–51
- 51–54 V. Würdigung 51–54
- 1. Problem der Legitimation
- 2. Kritik am hypothetischen Konsens
- 54–55 VI. Mögliche Weiterentwicklung 54–55
- 55–56 D. Zwischenergebnis 55–56
- 56–78 E. Eigener Ansatz 56–78
- 56–59 I. Ansätze zur Weiterentwicklung der Ökonomischen Th. des Rechts 56–59
- 1. Materielle Legitimation
- 2. Systembildung
- 3. Recht als System in der Zeit
- 59–61 II. Eigene interdisziplinäre Methodik 59–61
- 61–71 III. Begründung des eigenen Ansatzes 61–71
- 1. Differenz Sein-Sollen
- 2. System von Rechtsprinzipien
- a) Materiale Gerechtigkeit in Rechtsprinzipien
- b) Drei Ebenen des Systems
- c) Normenhierarchie im System (Normative Selektion)
- 3. Evolution des Rechts
- a) Konzeption einer Evolution des Rechts
- b) Bewertung von Rechtsinnovationen
- c) Evolution des normativen Systems
- d) Theorie einer normativen Evolution des Rechts
- 71–76 IV. Übereinstimmung mit der Methodik im europäischen Recht 71–76
- 1. Auslegung
- 2. Interdisziplinarität
- 3. Bewertung im Regel-Prinzipien-System
- 4. Fazit
- 76–78 V. Das Instrumentarium der Neuen Institutionenökonomik 76–78
- 1. Grundannahmen der Neuen Institutionenökonomik
- 2. Modelle der Neuen Institutionenökonomik
- 79–122 Kapitel 3. Ökonomische Grundlagen 79–122
- 79–90 A. Oligopoltheorie 79–90
- 79–81 I. Definition des Oligopols über die oligopolistische Interdependenz 79–81
- 81–87 II. Verhaltensannahmen in den traditionellen Oligopoltheorien 81–87
- 1. Individuelle Gewinnmaximierung
- 2. Imitation
- 3. Gemeinsame Gewinnmaximierung – Kollusion
- 87–90 III. Strategisches Verhalten 87–90
- 1. Mengen-/Preiswettbewerb
- 2. Produktdifferenzierung
- 3. Zeitstrategien/ Taktik (leader/ follower)
- 90–96 B. Strukturierte Übersicht über die Wettbewerbstheorien 90–96
- 90–93 I. Wettbewerb als dreipoliger Prozess 90–93
- 93–96 II. Überblick über die Wettbewerbstheorien 93–96
- 96–121 C. Evolutorische Wettbewerbstheorie 96–121
- 96–105 I. Das Variations-Selektions-Schema von Kerber 96–105
- 1. Grundannahmen
- 2. Konzept des Wettbewerbsprozesses von Kerber
- 3. Koordination im Parallelprozess
- 105–121 II. Eigenes Erklärungsmuster oligopolistischer Marktmacht 105–121
- 1. Selektion – vertikale Marktmacht
- a) Wissensdefizite der Nachfrager - Ursache für Marktmacht
- b) Stabilisierung der Wissensdefizite führt zu dauerhafter Marktmacht
- c) Zusammenfassung
- 2. Oligopolfriede als oligopolistische Reaktionsstarrheit
- a) Kombination von horizontaler und vertikaler Ebene
- b) Wettbewerbsprozess oszilliert zwischen Homogenität und Heterogenität
- c) Drei Voraussetzungen der oligopolist. Reaktionsstarrheit
- – Marktmacht der Oligopolisten
- – Horizontale Koordination der Oligopolisten durch Imitation
- – Imitation reduziert Dynamik des Wettbewerbs
- d) Zusammenfassung
- 3. Standort der drei FKVO-Konzepte im dynamischen Wettbewerbsprozess
- 4. Wettbewerbspolitische Beurteilung
- 121–122 D. Ökonomische Hypothese: Oligopolfrieden durch Imitation 121–122
- 123–362 Kapitel 4. Die Erfassung von Oligopolen durch Art. 2 III FKVO 123–362
- 123–315 A. Die Auslegung 123–315
- 123–158 I. Die Auslegung des Art. 2 III FKVO (SIEC-Test) 123–158
- 1. Wortlaut „durch die wirksamer Wettbewerb ... erheblich behindert würde“
- a) Wirksamer Wettbewerb
- – Keine Definition von Wettbewerb erforderlich
- – Wirksamer Wettbewerb
- b) Behinderung des Wettbewerbs
- – Dynamisches Wettbewerbsverständnis
- – Unterschied zum SLC-Test
- c) Erhebliche Behinderung
- – Kriterium der Zurechenbarkeit
- – Quantitatives Spürbarkeitskriterium
- – Qualitatives Kriterium: Dynamik des Wettbewerbs
- d) Zusammenfassung und Bedeutung des SIEC-Tests für Oligopolsachverhalte
- 2. Wortlaut „beherrschende Stellung“
- a) Wortbedeutung
- b) Keine systematische Auslegung des Begriffs mit Art. 102 AEUV
- c) Anwendung auf Oligopolmärkte
- – Theorie der kollektiven Einheit
- – Marktbeherrschung durch mehrere Oligopolisten
- – Fazit: Zwei denkbare Konstruktionen von oligopolistischer Marktmacht
- 3. Verhältnis der Wettbewerbsbehinderung zur Marktbeherrschung
- a) Der alte 2-Stufen-Test: Marktbeherrschung plus Behinderungsklausel
- b) Ein halbherziger Paradigmenwechsel
- – Im Fall von Marktbeherrschung
- – Sonstige Fälle: Marktbeherrschung als „Maßstab“
- – Fazit: Strukturtest und/oder Verhaltenstest
- 4. Grammatikalische Auslegung
- a) Kausalität
- b) Prognose
- c) Marktabgrenzung
- – Notwendigkeit der Marktabgrenzung
- – Oligopolisten als Marktbeherrscher auf Teilmärkten
- – Zeitliche Marktabgrenzung
- d) Ergebnis der grammatikalischen Auslegung
- 5. Zwischenergebnis der Auslegung und Vorgaben für Oligopole
- 158–161 II. Das Oligopolproblem von 1989 158–161
- 1. Historischer Wille des Rates in der alten VO Nr. 4064/89
- 2. Grundsätzliche Anwendbarkeit der FKVO auf Oligopole (Richterrecht des EuGH in Frankreich/Kommission)
- 161–182 III. Die 1. Lösung: Kollektive Marktbeherrschung/ Konzept der Kollusion 161–182
- 1. Merkmale des Konzepts der Kollusion
- a) Historischer Ursprung in der Missbrauchsaufsicht
- b) Gedanke der kollektiven Einheit
- c) Konzept der koordinierten Effekte/ ökonomisches Modell der Kollusion
- 2. Der Entwicklungspfad der kollektiven Marktbeherrschung in der Rechtsprechung zur FKVO
- a) Das Urteil Frankreich/Kommission
- b) Das Urteil Gencor/Kommission
- c) Das Urteil Airtours/Kommission
- d) Das Urteil Impala/Kommission & bloßes Parallelverhalten
- e) Grenzen des Entwicklungspfads
- 3. Unterschiede zur Missbrauchsaufsicht nach Art. 102 AEUV
- a) Rechtsprechung zur kollektiven Marktbeherrschung unter Art. 82 EG
- b) Unterschiede zwischen der FKVO und Art. 102 AEUV
- – Normenhierarchie
- – Verantwortlichkeit für schädigendes Verhalten
- – Normadressat und Normstruktur
- – Prognose und präventive Normanwendung
- – Zusammenfassung der Unterschiede
- c) Abkoppelung von der Missbrauchsaufsicht
- 4. Prüfungsschritte des Konzepts
- 5. Vereinbarkeit mit dem SIEC-Test
- 182–219 IV. Der Wille des Rates in der FKVO-Reform 2004 182–219
- 219–242 II. Das Konzept der Kollusion 219–242
- 1. Die Dilemma-Struktur der Kollusion
- 2. Bestrafung als extrinsische Lösung
- a) Arten der Bestrafung
- b) Glaubwürdigkeit der Bestrafung
- c) Kritik am Konzept der Bestrafung
- 3. Kritik am Kollusionskonzept
- a) Rechtliche Zulässigkeit von glaubwürdigen Bestrafungen
- b) Doppeldeutigkeit der Kriterien
- c) Kritik an der Spieltheorie als Analyseinstrument
- 4. Alternative Ansätze zur Überwindung des Dilemmas
- a) Reputation bei Spielen mit unvollständiger Information
- b) Vertrauensökonomik
- c) Reziprozität als Verhalten oder als soziale Norm
- d) Ergebnis der alternativen Ansätze
- 5. Zusammenfassung zum Konzept der Kollusion
- 242–257 III. Folgenanalyse des Konzepts der Kollusion 242–257
- 1. Folgenanalyse der Kollusionskriterien – Ergebnisse aus dem Appendix
- a) Folgenanalyse der horizontalen Kriterien
- b) Folgenanalyse der vertikalen Kriterien
- c) Folgenanalyse der unternehmensinternen Kriterien
- 2. Zwischenergebnis: Fehler 1. und 2. Art
- a) Vier wesentliche Fehlsteuerungen
- – Symmetrische Marktanteile sind kein (hinreichendes) Indiz für Kollusion
- – Kriterien für Wettbewerbsanreiz überschätzen Instabilität der Kollusion
- – Die unternehmensinternen Kriterien sind nicht praxistauglich
- – Relevanz der Verhaltensannahmen
- b) Fehler 1. und 2. Art
- c) Fall-Beispiele für Fehler 2. Art (Under-enforcement)
- 3. Nicht-intendierte Nebenwirkungen für Marktverhalten
- a) Vorfeldwirkung bei der Planung von Zusammenschlüssen
- b) Anreize zum Marktverhalten vor der Fusion
- 257–275 IV. Das Konzept der unilateralen Effekte 257–275
- 1. Verhaltensannahmen des Konzepts
- 2. Der Preisaufschlag (markup) als relevantes Kriterium
- 3. Die Bedeutung von Verhaltensannahmen
- 4. Berechnung der unilateralen Effekte
- 5. Ökonomische Kritik und Folgenanalyse
- a) Keine dynamische Analyse der Oligopolmärkte
- b) Keine Datengrundlage/ Kriterien sind nicht praxistauglich
- c) Kein Kriterium für die „Erheblichkeit“ einer Wettbewerbsbehinderung
- d) Fehler 1. Art (Over-enforcement)
- – Vorfeldwirkung und mangelnde Vorhersehbarkeit
- – Auswirkungen auf den Produktmarkt
- e) Verbale Versuche, dynamische Effekte zu erfassen
- 6. Ergebnis
- 275–293 V. Das Konzept der Imitation 275–293
- 1. Ideelle Herkunft des Konzepts der Imitation
- a) Notwendigkeit eines eigenen Konzepts
- b) Methodischer Ansatz
- 2. Imitation als Marktverhalten und Imitationsgleichgewicht
- a) Imitation als Lernverhalten
- b) Imitation als Marktverhalten
- c) Imitationsgleichgewicht
- d) Marktergebnisse bei Imitation
- – Konkurrenzgleichgewicht
- – Cournot-Gleichgewicht
- – Marktergebnisse in Höhe des Monopolpreises
- – Zwischenergebnis
- – Abgrenzung zum Nash-Gleichgewicht bei Gewinnmaximierung
- 3. Auswirkung der Imitation auf den Wettbewerbsprozess
- a) Abgrenzung von Imitation und Kollusion/ Kooperation
- b) Imitation reduziert den Innovationsanreiz
- – Geschwindigkeit der Imitation
- – Intensität der Imitation
- – Wahl des Aktionsparameters
- c) Imitation führt zur Wettbewerbsbehinderung
- 4. Zusammenfassung und Bedeutung
- 293–312 VI. Folgenanalyse des Konzepts der Imitation 293–312
- 1. Die Kriterien im Konzept der Imitation
- a) Individuelle Marktmacht der Oligopolisten
- b) Typus der Nachfrager
- c) Anzahl der Oligopolisten
- d) Innovatoren und Kooperatoren
- e) Markttransparenz
- f) Imitierbarkeit der Aktionen
- g) Homogene oder heterogene Produkte
- h) Restwettbewerb und potentieller Wettbewerb
- 2. Anwendungsbeispiel für das Konzept der Imitation
- a) Der Fall T-Mobile Austria/Tele.ring
- b) Vergleich der Konzepte am Beispielsfall
- 3. Nebenwirkungen auf Marktverhalten
- a) Nebenwirkungen bei der Planung v. Zusammenschlüssen
- b) Nebenwirkungen für das Marktverhalten
- c) Steuerung des Wettbewerbsprozesses in Ri. Innovation
- 312–315 VII. Ergebnis der ökonomischen Folgenanalyse 312–315
- – Konzept der Kollusion
- – Konzept der unilateralen Effekte
- – Konzept der Imitation
- 315–362 C. Die Bewertung der Konzepte 315–362
- 315–321 I. Keine Bewertung anhand eines Normzwecks 315–321
- 1. Normzweck der FKVO
- 2. Funktionen des Wettbewerbs
- 321–343 II. Vier Rechtsprinzipien des EU-Kartellrechts 321–343
- 1. Fusionsfreiheit
- a) Grundrecht aus Art. 17 GRC
- b) Verhältnismäßigkeit
- c) Berücksichtigung in den drei Konzepten
- 2. Selbständigkeitspostulat
- a) Inhaltliche Reichweite
- – Das Recht, sich dem Markt anzupassen
- – Der Verzicht auf Wettbewerbsvorstöße
- b) Widerspruch zum Konzept der Kollusion/ der Imitation?
- 3. Prinzip der Verantwortung für Marktmacht
- a) Verantwortung für Marktmacht
- b) Berücksichtigung in den Konzepten
- 4. Prinzip des Vertrauens in die Wettbewerbsdynamik
- a) Herleitung des Rechtsprinzips
- b) Besondere Bedeutung für prognostische Fusionskontrolle
- c) Aufwertung durch FKVO-Reform 2004
- d) Legitimation der drei Konzepte
- 343–358 III. Kollusion mit Bestrafung: Normkonkurrenz zu Art. 102 AEUV 343–358
- a) Voraussetzungen, Verstöße gegen Art. 102 AEUV in der Prognose zu berücksichtigen
- b) Verstößt Bestrafung des Abweichlers gegen Art. 102?
- c) Ergebnis und Folgen für das Konzept der Kollusion
- 358–362 IV. Gesamtergebnis: Bewertung der Konzepte 358–362
- 1. Konzept der Kollusion
- 2. Konzept der unilateralen Effekte
- 3. Konzept der Imitation
- 363–370 Kapitel 5. Zusammenfassung 363–370
- 363–364 A. Interdisziplinäre Methodik 363–364
- 364–365 B. Konzept der Imitation 364–365
- 365–369 C. Kritik der bisherigen Lösungen 365–369
- 365–368 I. Konzept der Kollusion (koordinierte Effekte) 365–368
- 368–369 II. Konzept der unilateralen (nicht-koordinierten) Effekte 368–369
- 369–370 D. Ausblick 369–370
- 371–430 Kapitel 6. Appendix – Folgenanalyse der Kriterien des Konzepts der Kollusion 371–430
- 371–409 A. Horizontale Kriterien 371–409
- 371–379 I. Anzahl der Oligopolisten 371–379
- 1. Neoklassische Modelle
- 2. Modelle mit unvollständiger Information
- 3. Fazit
- 379–382 II. Konzentrationsgrad 379–382
- 1. Konzentrationsmaße HHI und CR
- 2. Konzentrationsmaß als Filter?
- 3. Sind Marktanteile in der Praxis zutreffend zu ermitteln?
- 382–387 III. Oligopolgruppe, Randfirmen (fringe firms) und Mavericks 382–387
- 1. Abgrenzung der Oligopolgruppe
- 2. Bedeutung der Randfirmen
- 3. Maverick
- 4. Ergebnis und Folgenanalyse
- 387–391 IV. Symmetrie der Oligopolisten 387–391
- 1. Symmetrische Wettbewerbsanreize
- 2. Symmetrie der Marktanteile
- 3. Fazit
- 391–400 V. Markttransparenz 391–400
- 1. Unvollständige Information
- a) Auswirkung der Informationslage
- b) Informationsaustausch als Indiz für Kollusion
- c) Folgenanalyse
- 2. Unvollkommene Information
- 3. Sonstige erleichternde Vertragsklauseln
- 4. Zusammenfassung
- 400–406 VI. Kontakte zwischen den Oligopolisten 400–406
- 1. Frühere Kollusionen/Kartelle
- 2. Cheap talk
- 3. Verflechtungen und Verbände
- 4. multi-market contacts
- 406–409 VII. Potentieller Wettbewerb und Marktzutrittsschranken 406–409
- 1. Marktzutrittsschranken
- 2. Marktschranken-Kollusion (Marktaufteilung)
- 3. Potentieller Wettbewerb
- 409–417 B. Vertikale Kriterien 409–417
- 409–411 I. Elastizität der Gesamtnachfrage 409–411
- 411–414 II. Homogene oder heterogene Produkte/ unternehmensindividuelle Nachfrageelastizität 411–414
- 1. Koordination
- 2. Wettbewerbsanreiz
- 3. Folgenanalyse
- 414–416 III. Art und Umfang der Nachfrage 414–416
- 1. Häufigkeit und Größe der Transaktionen
- 2. Ausschreibungen (Bietermärkte)
- 416–417 IV. Änderungen der Nachfrage/ Marktphasen 416–417
- 417–428 C. Interne Kriterien 417–428
- 417–425 I. Kostenstrukturen 417–425
- 1. Aus Symmetrie folgt Konsens?
- 2. Kostenstruktur als Wettbewerbsanreiz
- 3. Folgenanalyse
- a) Anreiz zur adversen Selektion
- b) Lösungsmöglichkeiten der Neuen Institutionenökonomik
- – Signalling
- – Screening
- – Umkehr der Beweislast
- c) Publizität von privaten Informationen
- d) Ergebnis
- 425–428 II. Kapazitäten 425–428
- 1. Überkapazitäten
- 2. Kapazitätskollusion
- 3. Folgenanalyse
- 428–430 D. Ergebnisübersicht zur Folgenanalyse der Kollusionskriterien 428–430
- 431–455 Literaturverzeichnis 431–455