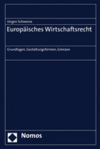Europäisches Wirtschaftsrecht
Grundlagen, Gestaltungsformen, Grenzen
Zusammenfassung
Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen der europäischen Wirtschaftspolitik zu kennen. Das „Europäische Wirtschaftsrecht“ bietet einen vertieften Einblick in die Funktionsweise, Perspektiven und Grenzen der europäischen Wirtschaftsordnung, die immer mehr Bürger und Unternehmen in ihren existenziellen Interessen berührt.
Der Band erläutert die Grundstrukturen und Grundprobleme des europäischen Wirtschaftsrechts. Er bietet eine verlässliche Orientierungshilfe auf einem Rechtsgebiet, das durch eine Flut von Einzelregelungen gekennzeichnet ist. Zudem lenkt er den Blick auf den unabdingbaren Zusammenhang zwischen ökonomischer und politischer Einigung. Mit seiner systematischen Analyse ist das Handbuch der Wegweiser im komplexen Geflecht des europäischen Wirtschaftsrechts.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–20 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–20
- 21–26 I. Einführung 21–26
- 21–21 1. Zielsetzung der Untersuchung 21–21
- 21–23 2. Gründe und Rahmenbedingungen für die Untersuchung 21–23
- 23–24 3. Der Untersuchungsgegenstand 23–24
- 24–26 4. Gliederung der Untersuchung 24–26
- 27–36 II. Das wirtschaftsverfassungsrechtliche Konzept der EU 27–36
- 27–31 1. Das Grundkonzept 27–31
- 31–33 2. Der europäische Binnenmarkt als Grundlage der Europäischen Union 31–33
- 33–36 3. Das Ausmaß des Europäischen Wirtschaftsrechts 33–36
- 37–180 III. Grundfreiheiten und Wettbewerbsrecht als Grundlagen des Binnenmarktes 37–180
- 37–38 1. Einführung: Die Kernelemente des Binnenmarktes 37–38
- 38–41 2. Die Kompetenz zur Rechtsangleichung im Binnenmarkt gemäß Art. 95 EG 38–41
- 41–99 3. Die Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes 41–99
- 41–51 a) Die Freiheit des Warenverkehrs 41–51
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Gewährleistungsinhalt
- cc) Unmittelbare Anwendbarkeit der Grundfreiheiten .
- dd) Maßnahmen gleicher Wirkung
- ee) Rechtfertigungsgründe bei einem Eingriff
- ff) Eingeschränkte Kontrolle gegenüber Verkaufsmodalitäten
- gg) Rechtfertigung speziell durch Grundrechte
- 51–68 b) Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 51–68
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Gewährleistungsinhalt
- cc) Drittwirkung
- dd) Rechtfertigungsmöglichkeiten für einen Eingriff
- ee) Unionsbürgerschaft und Sekundärrecht
- ff) Diskriminierungsverbote im Berufsleben
- (i) Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben
- (ii) Altersdiskriminierung und Kündigungsschutz
- gg) Sonstige europarechtliche Auswirkungen auf das Arbeitsrecht
- 68–82 c) Die Niederlassungsfreiheit 68–82
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Gewährleistungsinhalt
- cc) Mögliche Rechtfertigung eines Eingriffs
- dd) Sekundärrecht
- (i) Harmonisierung des mitgliedstaatlichen Gesellschaftsrechts
- (ii) Gesellschaftsformen des europäischen Rechts
- (1) Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)
- (2) Die Europäische Aktiengesellschaft (SE)
- (3) Die Europäische Genossenschaft (SCE)
- (iii) Richtlinien zur gegenseitigen Anerkennung von Diplomen, Ausbildungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen
- 82–92 d) Die Dienstleistungsfreiheit 82–92
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Gewährleistungsinhalt
- cc) Mögliche Rechtfertigung für Eingriffe
- dd) Grenzen der Dienstleistungsfreiheit
- ee) Sekundärrecht
- 92–99 e) Der freie Kapital- und Zahlungsverkehr 92–99
- aa) Anwendungsbereich
- bb) Gewährleistungsinhalt
- cc) »Goldene« Aktien
- dd) Beschränkungs- und Rechtfertigungsmöglichkeiten
- 99–144 4. Das europäische Wettbewerbsrecht 99–144
- 99–101 a) Einführung: Wettbewerbsregeln für Unternehmen – Art. 81 und 82 EG sowie Fusionskontrollrecht 99–101
- 101–108 b) Das Kartellverbot gemäß Art. 81 EG 101–108
- aa) Das materiellrechtliche Kartellverbot
- (i) Das von Art. 81 EG untersagte Verhalten
- (ii) Die Zwischenstaatlichkeitsklausel
- (iii) Die Rechtsfolge des Art. 81 Abs. 2 EG
- (iv) Ausnahmen vom Kartellverbot: Art. 81 Abs. 3 EG
- bb) Änderungen durch die Kartellverfahrensverordnung VO (EG) Nr. 1/2003
- 108–112 c) Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gemäß Art. 82 EG 108–112
- aa) Das von Art. 82 EG untersagte Verhalten
- bb) Revision des Art. 82 EG
- 112–117 d) Fusionskontrolle 112–117
- aa) Einführung
- bb) Die Fusionskontrollverordnung
- cc) Rechtsprechungspraxis zur Fusionskontrolle
- 117–118 e) Grundzüge des Kartellverfahrensrechts 117–118
- 118–124 f) Bußgelder 118–124
- 124–132 g) Öffentliche Unternehmen, Art. 86 EG 124–132
- aa) Einführung
- bb) Die unterschiedlichen Adressaten des Art. 86 EG
- cc) Rechtsprechungspraxis zu Art. 86 EG
- dd) Neuerungen bezüglich der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
- ee) Die Daseinsvorsorge in der europäischen Verfassungsreform
- 132–144 h) Wettbewerbsregeln für die Mitgliedstaaten: Art. 87 EG 132–144
- aa) Einführung
- bb) Begriff der Beihilfe
- (i) Die einzelnen Merkmale der Beihilfe
- (ii) Gewährung einer Begünstigung
- (iii) Gewährung aus staatlichen Mitteln
- cc) Mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbare Beihilfen: Art. 87 Abs. 2 EG
- dd) Das Beihilfekontrollverfahren
- ee) Die Rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger Beihilfen
- ff) Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des Beihilfenrechts
- 144–144 i) Das Wettbewerbsrecht nach dem Verfassungsvertrag 144–144
- 144–180 5. Sonderbereiche 144–180
- 144–153 a) Die Landwirtschaft 144–153
- aa) Der Agrarmarkt als Teil des Gemeinsamen Marktes
- bb) Die Besonderheiten des Agrarmarkts
- cc) Das EG-Agrarrecht in der Praxis
- dd) Résumé: Die Bedeutung der Landwirtschaft für die EU und das Gemeinschaftsrecht
- 153–165 b) Die Steuerpolitik 153–165
- aa) Einführung
- bb) Kompetenzen der Union und Harmonisierung steuerrechtlicher Regelungen
- (i) Direkte und indirekte Steuern
- (ii) Unterschiede zwischen Art. 93 EG und Art. 94 EG
- (iii) Getroffene Harmonisierungsmaßnahmen
- cc) Einwirkung allgemeiner europarechtlicher Rechtsgrundsätze auf das Steuerrecht
- (i) Rechtssache Manninen
- (ii) Rechtssache Marks & Spencer
- (iii) Urteilswirkungen
- (1) Problematik
- (2) Besondere Situation im Steuerrecht
- (3) Mögliche Abhilfe durch die Rechtsprechung
- dd) Konfliktpotential im Bereich der harmonisierten Steuern
- ee) Konsequenzen
- 165–180 c) Das öffentliche Auftragswesen 165–180
- aa) Die verschiedenen Ebenen rechtlicher Regelungen
- bb) Europäisches Gemeinschaftsrecht
- (i) Primärrecht
- (1) Die Bedeutung der Grundfreiheiten
- (2) Die Anwendbarkeit der Beihilfevorschriften
- (3) Öffentliche Aufträge im Verteidigungssektor
- (ii) Europäische Vergaberichtlinien
- (1) Die materiellen Vergaberichtlinien der Gemeinschaft
- (a) Die neue Vergabekoordinierungsrichtlinie
- (b) Die neue Sektorenrichtlinie
- (c) Der Auftraggeber i. S. d. Vergabekoordinierungsrichtlinie
- (d) Die Bedeutung der Schwellenwerte
- (2) Die Rechtsmittelrichtlinien
- (a) Rechtsweg und Instanzenzug
- (b) Kontrolldichte bei der Nachprüfung des Vergabeverfahrens
- (c) Überarbeitung der Rechtsmittelrichtlinie
- 181–204 IV. Die Außendimension des Binnenmarktes – Die gemeinsame Handelspolitik 181–204
- 181–187 1. Begriff und Grundlagen der gemeinsamen Handelspolitik 181–187
- 181–183 a) Kompetenzen im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik 181–183
- 183–185 b) Der Begriff der gemeinsamen Handelspolitik 183–185
- 185–186 c) Neuerungen auf Grund des Vertrages von Nizza 185–186
- 186–187 d) Die Regelungen im Europäischen Verfassungsvertrag . 186–187
- 187–190 2. Die Anwendbarkeit von WTO-Vorschriften im Gemeinschaftsrecht 187–190
- 187–188 a) Die Rechtslage unter dem GATT 1947 187–188
- 188–190 b) Die Rechtslage nach Abschluss des WTO-Übereinkommens 188–190
- 190–190 c) Alternative Handlungsmöglichkeiten 190–190
- 190–199 3. Gestaltungsmittel der EU im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik 190–199
- 190–195 a) Handelspolitische Schutzmaßnahmen 190–195
- aa) Die handelspolitischen Schutzmaßnahmen im Überblick
- bb) Insbesondere: Antidumping-Maßnahmen
- (i) Möglichkeiten des Rechtsschutzes gegen Antidumping-Maßnahmen
- (ii) Materielle Kontrolldichte bei Klagen gegen Antidumping-Maßnahmen
- 195–199 b) Wirtschaftssanktionen 195–199
- aa) Kompetenzgrundlagen
- bb) Wirtschaftssanktionen in der gerichtlichen Praxis
- 199–204 4. Die EG als Zollunion 199–204
- 199–201 a) Kompetenzgrundlagen für das Zollrecht 199–201
- 201–203 b) Zollrechtliches Sekundärrecht und seine Anwendung 201–203
- 203–204 c) Maßstäbe der Rechtsprechung 203–204
- 205–214 V. Die Wirtschafts- und Währungsunion 205–214
- 205–206 1. Strukturentscheidungen 205–206
- 206–207 2. Die rechtlichen Grundlagen der Wirtschafts- und Währungspolitik 206–207
- 207–209 3. Die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungspolitik 207–209
- 209–213 4. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt 209–213
- 209–210 a) Ursprüngliche Ausgestaltung 209–210
- 210–210 b) Ziele 210–210
- 210–211 c) Defizitverfahren gegen Deutschland und Frankreich 210–211
- 211–212 d) Gerichtliche Kontrolle 211–212
- 212–213 e) Reformen 212–213
- 213–214 5. Der Europäische Verfassungsvertrag 213–214
- 215–236 VI. Die wirtschaftsbezogenen Grundrechte 215–236
- 215–232 1. Die wirtschaftsbezogenen Grundrechte nach geltendem Recht 215–232
- 215–219 a) Der Grundrechtsschutz in der Europäischen Union 215–219
- aa) Einführung
- bb) Grundrechtlich geschützte Wirtschaftsbereiche
- 219–225 b) Die Berufsfreiheit 219–225
- aa) Einleitung
- bb) Schutzbereich
- (i) Sachlicher Schutzbereich
- (ii) Persönlicher Schutzbereich
- cc) Eingriff
- dd) Rechtfertigungsmöglichkeiten für Eingriffe in die Berufsfreiheit
- 225–232 c) Das Recht auf Eigentum 225–232
- aa) Einführung
- bb) Schutzbereich
- cc) Eingriff
- dd) Mögliche Rechtfertigungsgründe für Eingriffe in das Eigentum
- (i) Grundsätzliche Rechtfertigung von Eingriffen in das Eigentumsrecht
- (ii) Spezielle Aspekte bei der Bestimmung der Eingriffsschranken
- (1) Berufung auf das Recht der Meinungsfreiheit
- (2) (Grund-)Rechtsschutz im Verwaltungsverfahren .
- (3) Die besondere Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der wirtschaftsbezogenen Grundrechte
- 232–236 2. Charta der Grundrechte/Teil II des EVV 232–236
- 232–234 a) Die allgemeine Bedeutung der Europäischen Grundrechtecharta 232–234
- 234–236 b) Inhaltliche Neuerungen durch die Charta bzw. den Europäischen Verfassungsvertrag 234–236
- 236–236 3. Folgerungen 236–236
- 237–273 VII. Gestaltungsformen des europäischen Wirtschaftsrechts 237–273
- 237–266 1. Die Handlungsformen der Gemeinschaft 237–266
- 237–238 a) Primäres Gemeinschaftsrecht und sekundäres Gemeinschaftsrecht 237–238
- 238–241 b) Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 238–241
- aa) Inhalt des Prinzips
- bb) Auswirkungen auf die Handlungsformen
- cc) Folgen der Wahl der Kompetenzgrundlage für die sekundäre Gesetzgebung
- 241–262 c) Die Handlungsformen des sekundären Gemeinschaftsrechts 241–262
- aa) Die Verordnung, Art. 249 Abs. 2 EG
- (i) Rechtsnatur und Wirkung
- (ii) Allgemeine Geltung
- (iii) Gesamtverbindlichkeit
- (iv) Unmittelbare Anwendbarkeit
- (v) Verordnungsgeber
- bb) Die Richtlinie, Art. 249 Abs. 3 EG
- (i) Rechtsnatur und Wirkung
- (ii) Regelungsintensität: Zulässigkeit detaillierter Richtlinien
- (iii) Art und Weise der Umsetzung in innerstaatliches Recht
- (1) Umsetzungsfrist
- (2) Wahl der Form und Mittel
- (3) Umsetzung durch Verwaltungspraxis, Verweisung oder Verwaltungsvorschriften
- (iv) Sperrwirkung
- (v) Richtlinienkonforme Auslegung
- (vi) Sanktionen bei fehlender Umsetzung
- cc) Die Entscheidung, Art. 249 Abs. 4 EG
- (i) Individuelle Geltung
- (ii) Gesamtverbindlichkeit
- (iii) Zulässigkeit beigefügter Nebenbestimmungen
- dd) Die Empfehlung und Stellungnahme, Art. 249 Abs. 5 EG
- (i) Rechtsnatur und Wirkung
- (ii) Erlassendes Organ, Adressaten
- (iii) Sonstige Rechtsakte der EG
- 262–264 d) Die Normenhierarchie innerhalb des Sekundärrechts . 262–264
- 264–266 e) Die Rechtsakte der Union nach dem Europäischen Verfassungsvertrag 264–266
- 266–272 2. Das System des administrativen Vollzugs des Gemeinschaftsrechts 266–272
- 266–270 a) Das Trennungsprinzip 266–270
- 270–272 b) Das Kooperationsprinzip – das »Netzwerk« der Wettbewerbsbehörden als Beispielsfall 270–272
- 272–273 3. Résumé 272–273
- 274–305 VIII. Der Rechtsschutz im europäischen Wirtschaftsrecht 274–305
- 274–276 1. Einleitung 274–276
- 274–275 a) Die Bedeutung des Rechtsschutzes im Gemeinschaftsrecht 274–275
- 275–275 b) Der Rechtsprechungsauftrag der Gemeinschaftsgerichte 275–275
- 275–276 c) Die rechtsschutzfreundliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts 275–276
- 276–276 d) Übersicht über die behandelten einzelnen Rechtsschutzfragen 276–276
- 276–297 2. Die Rechtsbehelfe im Einzelnen 276–297
- 276–286 a) Die Nichtigkeitsklage 276–286
- aa) Funktion und Schutzrichtung
- bb) Zulässigkeitsvoraussetzungen
- (i) Anfechtbare Rechtsakte
- (ii) Rechtsschutz gegen Entscheidungen
- (iii) Rechtsschutz gegen Verordnungen
- (iv) Unmittelbare und individuelle Betroffenheit
- (1) Unmittelbare Betroffenheit
- (2) Individuelle Betroffenheit
- (v) Ergebnis
- 286–289 b) Das Vorabentscheidungsverfahren 286–289
- aa) Funktion und Schutzrichtung
- bb) Zulässigkeitsvoraussetzungen
- cc) Ergebnis
- 289–297 c) Die Schadensersatzklage 289–297
- aa) Funktion und Schutzrichtung
- bb) Voraussetzungen der Amtshaftung der Gemeinschaft
- (i) Allgemeine Haftungsvoraussetzungen
- (ii) Haftung für normatives Unrecht
- (iii) Angleichung der Haftungsvoraussetzungen für Gemeinschaftsorgane und Mitgliedstaaten
- (iv) Angleichung der Haftungstatbestände für normatives und administratives Unrecht
- cc) Die Haftung der Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht
- (i) Die Voraussetzungen der mitgliedstaatlichen Haftung
- (ii) Die Durchsetzung des Haftungsanspruchs
- dd) Ergebnis
- 297–299 3. Die gerichtliche Durchsetzung der Wirtschaftsgrundrechte 297–299
- a) Aktuelle Rechtsschutzmöglichkeiten in Grundrechtsfragen
- 299–299 b) Einführung einer europäischen Grundrechtsbeschwerde 299–299
- 299–301 4. Die Effektivität des Individualrechtsschutzes 299–301
- 299–300 a) Zugang zum Gericht 299–300
- 300–300 b) Wirksamkeit des Rechtsschutzes 300–300
- 300–301 c) Rechtzeitiger Rechtsschutz 300–301
- 301–303 5. Organisatorische Ausgestaltung des Rechtsschutzes 301–303
- 301–302 a) Dreistufigkeit 301–302
- 302–303 b) Revisionsmöglichkeiten 302–303
- 303–304 6. Die richterliche Kontrolldichte 303–304
- 304–305 7. Résumé 304–305
- 306–340 IX. Die Weiterentwicklung des europäischen Wirtschaftsrechts und neue Politikfelder der Gemeinschaft 306–340
- 306–320 1. Die als Annex zum Wirtschaftsrecht entwickelten Politikfelder 306–320
- 306–315 a) Umweltpolitik 306–315
- aa) Kompetenzgrundlagen der EG-Umweltpolitik
- (i) Die Entwicklung einer Annexkompetenz
- (ii) Die ausdrückliche Anerkennung einer EG-Kompetenz
- bb) Die Bedeutung des Umweltschutzes im Primärund Sekundärrecht
- cc) Résumé
- 315–320 b) Verbraucherschutz 315–320
- aa) Entwicklung und Ausgestaltung der EG-Verbraucherschutzpolitik im Primärrecht
- bb) Verbraucher und Verbraucherleitbild im EG-Recht
- cc) EG-Sekundärrecht auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes
- 320–330 2. Grenzbereiche 320–330
- 320–324 a) Bildungspolitik 320–324
- aa) Primärrechtliche Grundlagen der EG-Bildungspolitik
- bb) Rechtsprechung des EuGH
- 324–330 b) Kultur- und Medienpolitik 324–330
- aa) Primärrechtliche Grundlagen der EG-Medienund Kulturpolitik
- bb) Kompetenzverteilung
- cc) Die Medien- und Kulturpolitik im Europäischen Verfassungsvertrag
- dd) Résumé
- 330–339 3. Neue Zuständigkeiten – Die Unionsbürgerschaft 330–339
- 330–331 a) Grundlagen 330–331
- 331–333 b) Schutzrichtung 331–333
- 333–336 c) Beispiele aus der Rechtsprechung 333–336
- 336–338 d) Kritik 336–338
- 338–339 e) Die Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG 338–339
- 339–339 f) Der Europäische Verfassungsvertrag 339–339
- 339–340 4. Résumé 339–340
- 341–394 X. Grenzen des europäischen Wirtschaftsrechts 341–394
- 341–342 1. Einführung 341–342
- 341–341 a) Problemstellung 341–341
- b) Gliederungsübersicht
- 342–366 2. Die Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten 342–366
- 342–361 a) Die geltende Rechtslage 342–361
- aa) Grundsätze
- (i) Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
- (ii) Implied powers und effet utile
- (iii) Kompetenztypen
- bb) Das Subsidiaritätsprinzip
- (i) Grundlagen und Justiziabilität
- (ii) Gründe für die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips im Unionsrecht
- (iii) Wahrung der Identität der Mitgliedstaaten
- (iv) Das Subsidiaritätsprinzip als elementares Unionsinteresse
- cc) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
- dd) Die Binnenmarktkompetenz
- (i) Grundlagen
- (ii) Gründe für die Einführung von Art. 95 EG
- (iii) Art. 95 EG und der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung
- (iv) Voraussetzungen
- (v) Primärrechtliche Grenzen
- (vi) Notwendige Einschränkungen des Anwendungsbereichs von Art. 95 EG
- ee) Kompetenzen auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts
- 361–365 b) Die Ausgestaltung im Europäischen Verfassungsvertrag 361–365
- aa) Allgemeine Zuständigkeitsregeln
- (i) Kompetenztypen
- (ii) Flexibilitätsklausel
- (iii) Bewertung
- bb) Die allgemeinen Kompetenzausübungsregeln der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
- cc) Die Binnenmarktkompetenz
- dd) Kompetenzen auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts
- 365–366 c) Vorschläge zur besseren Kompetenzabgrenzung in Bezug auf den Binnenmarkt 365–366
- 366–374 3. Kompetenzausdehnung durch Richterrecht 366–374
- 366–368 a) Gegenüber den Mitgliedstaaten: Die Anwendung allgemeiner europarechtlicher Grundsätze auf Gebieten ohne eigentliche Gemeinschaftskompetenz 366–368
- 368–369 b) Gegenüber dem Unionsgesetzgeber: Beispiel Unionsbürgerschaft 368–369
- 369–374 c) Einschränkungen der Urteilswirkungen 369–374
- aa) Begrenzung der Auswirkungen der Urteile für die Mitgliedstaaten
- (i) Möglichkeiten der Begrenzung
- (ii) Kein Freibrief für die Mitgliedstaaten
- bb) Rücksichtnahme auf den Rechtssicherheitsbedarf der Unternehmen
- 374–377 4. Überschießende Richtlinienumsetzung (»gold plating«) 374–377
- 374–375 a) Begriffsbestimmung 374–375
- 375–376 b) Europarechtliche Vorgaben 375–376
- 376–377 c) Aufsplitterung des Binnenmarktes 376–377
- 377–385 5. Umstrittene Gesetzgebungsvorhaben 377–385
- 377–378 a) Dienstleistungsrichtlinie 377–378
- 378–382 b) Weitere Reformvorschläge 378–382
- aa) Chemikalienverordnung (»REACH«)
- bb) Arbeitszeitrichtlinie
- cc) Richtlinie zur optischen Strahlung
- 382–384 c) Reaktion der Union: »Bessere Rechtsetzung« und Health-Claims-Verordnung 382–384
- 384–385 d) Bewertung 384–385
- 385–393 6. Neuere Entwicklungen 385–393
- 385–389 a) Ausdehnung des Anwendungsbereichs des europäischen Wirtschaftsrechts seitens der EU 385–389
- aa) Fusionskontrolle
- bb) Energiepolitik
- 389–393 b) Re-Nationalisierungsbestrebungen in den Mitgliedstaaten 389–393
- aa) Fusionen
- (i) EON/Endesa
- (ii) Gaz de France/Suez
- (iii) UniCredit/Hypovereinsbank
- bb) Bewertung
- 393–394 7. Schlussfolgerungen 393–394
- 395–410 XI. Résumé – Perspektiven des europäischen Wirtschaftsrechts 395–410
- 411–434 Literaturverzeichnis 411–434
- 435–440 Stichwortverzeichnis 435–440