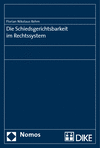Die Schiedsgerichtsbarkeit im Rechtssystem
Zusammenfassung
In Wirtschaftsstreitigkeiten nimmt die Schiedsgerichtsbarkeit eine bedeutsame Rolle ein. Am Beispiel des deutschen und des schweizerischen Rechts werden Fragen der verfassungsrechtlichen Legitimation und des Verhältnisses zur staatlichen Gerichtsbarkeit erörtert sowie Perspektiven für die Gesetzesauslegung wie auch für die Gesetzgebung aufgezeigt.
Kernaussage ist, dass die Schiedsgerichtsbarkeit ebenso wie die Staatsgerichtsbarkeit im Rechtsstaatsprinzip und nicht in der Privatautonomie zu verorten ist. Dem Einzelnen soll ein Anspruch auf staatliche Anerkennung des Schiedsentscheids als Ausgleich für das ihm auferlegte Selbsthilfeverbot zukommen. Vorbehaltlich des staatlichen Rechtsprechungsmonopols stellt dabei die Schiedsgerichtsbarkeit eine im Verhältnis zu der Staatsgerichtsbarkeit gleichwertige, nicht aber gleichartige Form des Rechtsschutzes dar.
Vor diesem Hintergrund werden unter anderem Fragen der Schiedsfähigkeit, der Vollstreckbarkeitserklärung von Schiedsurteilen, der staatsgerichtlichen Aufgaben im Zusammenhang mit Schiedsverfahren sowie der Schiedsgesetzgebung behandelt und die notwendige Verbindung zwischen Theorie und Praxis hergestellt.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–8 Titelei 1–8
- 9–16 Inhaltsübersicht 9–16
- 17–30 Abkürzungsverzeichnis 17–30
- 31–39 Literaturverzeichnis 31–39
- 40–40 Verzeichnis der Materialien 40–40
- 41–44 § 1 Einführung 41–44
- 41–42 I. Bestimmung des Untersuchungsgegenstands 41–42
- 42–44 II. Gang der Untersuchung 42–44
- 45–49 § 2 Das Verhältnis zwischen Schieds- und Staatsgerichtsbarkeit 45–49
- 45–45 I. Einführung 45–45
- 45–46 II. Ersatzfunktion der Schiedsgerichtsbarkeit 45–46
- 46–47 III. Massstabsfunktion der Staatsgerichtsbarkeit 46–47
- 47–48 IV. Notwendigkeit der Differenzierung 47–48
- 48–49 V. Verbindungslinien zwischen Schieds- und Staatsgerichtsbarkeit 48–49
- 49–49 VI. Zusammenfassung 49–49
- 50–73 § 3 Privatautonomie im Rechtssystem 50–73
- 50–50 I. Einführung 50–50
- 50–72 II. Der Begriff der Privatautonomie 50–72
- 50–50 A. Einführung 50–50
- 50–52 B. Definition 50–52
- 52–52 C. Kritik am Begriff der Privatautonomie 11 III. Privatautonomie und Verfassung 52–52
- 52–53 A. Einführung 52–53
- 53–59 B. Rechtstechnische Funktionalität der Privatautonomie 53–59
- 1. Einführung
- 2. Privatautonomie aus abwehrrechtlichem Verständnis
- 3. Privatautonomie aus leistungsrechtlichem Verständnis
- a. Einführung
- b. Ermächtigungstheorie und Delegationstheorie
- c. Anerkennungstheorien im Überblick
- ca. Einführung
- cb. Kompetenz kraft Anerkennung
- cc. Anerkennung individueller privatrechtswirksamer Verhaltensweisen
- d. Ergebnis
- 59–65 C. Verfassungsrechtliche Verortung der Vertragsfreiheit aus der Sicht von Rechtsprechung und Lehre 59–65
- 1. Verortung der Vertragsfreiheit im Rahmen der allgemeinen Handlungsfreiheit (Deutschland)
- 2. Verortung der Vertragsfreiheit – Vorrang der Spezialgrundrechte? (Deutschland)
- 3. Vertragsfreiheit als Ausdruck der Wirtschaftsfreiheit (Schweiz)
- 4. Vertragsfreiheit als unbenanntes Freiheitsrecht (Deutschland/Schweiz)
- 5. Vertragsfreiheit als Institutsgarantie (Deutschland/Schweiz)
- 6. Ergebnis
- 65–72 D. Verortung der Privatautonomie innerhalb des Rechtsstaatsprinzips 65–72
- 1. Einführung
- 2. Vorüberlegungen
- a. Notwendigkeit der Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips
- b. Dogmatische Bedeutung des Rechtsstaatsprinzips
- 3. Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips im Hinblick auf die Privatautonomie
- a. Vorüberlegung
- b. Subjektiv-öffentliches Recht auf Anerkennung individueller privatrechtswirksamer Verhaltensweisen
- c. Objektiv-rechtliche Dimension des Rechtsstaatsprinzips in Bezug auf die Privatautonomie
- d. Notwendigkeit der Errichtung einer Privatrechtsordnung
- 4. Ergebnis
- 72–73 IV. Zusammenfassung 72–73
- 74–110 § 4 Konfliktlösung durch staatliche Anerkennung schiedsrichterlicher Streitentscheidung 74–110
- 74–74 I. Einführung 74–74
- 74–75 II. Der Schiedsspruch als zentrales Charakteristikum der Schiedsgerichtsbarkeit 74–75
- 75–76 III. Der Urteilscharakter des Schiedsspruchs im Hinblick auf Billigkeitsentscheide 75–76
- 76–80 IV. Rechtsfunktionalität des Schiedsspruchs 76–80
- 76–76 A. Einführung 76–76
- 76–77 B. Privater Charakter des Schiedsspruchs 76–77
- 77–80 C. Notwendigkeit der staatlichen Anerkennung des Schiedsspruchs 77–80
- 1. Einführung
- 2. Die Anerkennung von Schiedssprüchen im Rahmen der gegenwärtigen Gesetzgebung
- a. Einführung
- b. Anerkennung des Schiedsspruchs durch Zuerkennung der Rechtskraft nach gegenwärtigem Recht
- c. Anerkennung durch Zuerkennung der Vollstreckbarkeit nach gegenwärtigem Recht
- 80–80 D. Ergebnis 80–80
- 80–88 V. Verfassungsrechtliche Verortung des Anspruchs auf Anerkennung schiedsrichterlicher Urteile 80–88
- 80–80 A. Einführung 80–80
- 80–81 B. Abzulehnende Auffassungen 80–81
- 81–81 C. Alternativvorschlag 81–81
- 81–84 D. Das Anerkennungsmodell 81–84
- 1. Einführung
- 2. Grundaussagen des Justizgewährleistungsanspruchs
- 3. Die drei Säulen des Anerkennungsmodells
- a. Erste Säule: Staatliche Anerkennung des Schiedsspruchs
- b. Zweite Säule: Staatliche Kontrolle des Schiedsspruchs
- c. Dritte Säule: Staatliche Unterstützung des Schiedsverfahrens
- 4. Ergebnis
- 84–87 E. Der Anerkennungsanspruch als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips 84–87
- 1. Einführung
- 2. Der Justizanspruch als entgegenstehendes Prinzip?
- 3. Anspruch auf freie Wahl des Rechtsschutzes
- 87–88 F. Ergebnis 87–88
- 88–102 VI. Grenzen des Anerkennungsanspruchs – Die Anerkennungsfähigkeit von Schiedsentscheiden 88–102
- 88–89 A. Einführung 88–89
- 89–97 B. Kriterium der Schiedsfähigkeit 89–97
- 1. Einführung
- 2. Fehlende Schiedsfähigkeit als Nichtigkeitsgrund
- a. Einführung
- b. Bestandsaufnahme
- c. Das Argument aus § 1055 D-ZPO bzw. Art. 190 Abs. 1 CH-IPRG
- d. Das Argument aus § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. a D-ZPO bzw. Art. 190 Abs. 2 lit. b 1. Alt. CH-IPRG
- e. Notwendigkeit der Annahme der Nichtigkeit
- f. Notwendigkeit der verfassungskonformen Auslegung der Aufhebungsvorschrift der Schiedsunfähigkeit
- 3. Gleichwertigkeit der beiden Rechtsschutzformen
- a. Einführung
- b. Prinzip der staatlichen Gerichtsbarkeit – Verneinung der Gleichwertigkeit
- c. Grundsatz der Gleichwertigkeit beider Rechtsschutzformen
- 4. Ergebnis
- 97–102 C. Begrenzung des Anerkennungsanspruchs durch weitere Nichtigkeitsgründe 97–102
- 1. Einführung
- 2. Fehlende Schiedsvereinbarung als Nichtigkeitsgrund?
- 3. Verstoss gegen den Ordre public als Nichtigkeitsgrund
- a. Ordre-public-Verständnis
- b. Ordre-public-Verstoss als Nichtigkeits- und Aufhebungsgrund
- c. Einzelne Fragestellungen
- 4. Weitere Nichtigkeitsgründe
- 102–102 D. Ergebnis 102–102
- 102–109 VII. Wirkungen des Anerkennungsanspruchs 102–109
- 102–105 A. Rechtskraftverständnis in Ansehung von Schiedssprüchen 102–105
- 1. Einführung
- 2. Disponibilität der Rechtskraft von Schiedssprüchen
- a. Bestandsaufnahme
- b. Notwendigkeit der Annahme der Dispositionsbefugnis
- 3. Berücksichtigung der Rechtskraft eines Schiedsurteils im staatlichen Prozess
- 4. Ergebnis
- 105–109 B. Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen 105–109
- 1. Einführung
- 2. § 1060 D-ZPO als unzulässige Einschränkung des Anerkennungsanspruchs
- 3. Art. 192 Abs. 2 CH-IPRG als unzulässige Einschränkung des Anerkennungsanspruchs
- 4. Schiedsspruch und Vollstreckungsbescheid
- 5. Ergebnis
- 109–110 VIII. Zusammenfassung 109–110
- 111–121 § 5 Der Aufhebungsanspruch 111–121
- 111–111 I. Einführung 111–111
- 111–112 II. Der Aufhebungsanspruch als Gegenstück des Anerkennungsanspruchs 111–112
- 112–113 III. Anspruchsberechtigung 112–113
- 113–114 IV. Wahrung der Integrität der Schiedsgerichtsbarkeit 113–114
- 114–116 V. Wirkungen der staatsgerichtlichen Aufhebung 114–116
- 114–115 A. Deklaratorische Aufhebung nichtiger Schiedssprüche 114–115
- 115–116 B. Konstitutive Aufhebung rechtsfehlerhafter Schiedsurteile 115–116
- 116–120 VI. Verzichtbarkeit des Aufhebungsanspruchs 116–120
- 116–116 A. Einführung 116–116
- 116–117 B. Verzichtbarkeit der deklaratorischen Aufhebung 116–117
- 117–120 C. Verzichtbarkeit der konstitutiven Aufhebung 117–120
- 1. Zulässigkeit des Verzichts
- 2. Folgen der Disponibilität des Aufhebungsanspruchs: Endgültige Entscheidungsbefugnis der Schiedsgerichte hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage?
- a. Zuständigkeitskriterium der wirksamen Schiedsvereinbarung
- b. Zuständigkeitskriterium der Schiedsfähigkeit
- 120–121 VII. Zusammenfassung 120–121
- 122–130 § 6 Anspruch auf gerichtliche Unterstützungsmassnahmen 122–130
- 122–122 I. Einführung 122–122
- 122–124 II. Der Anspruch auf gerichtliche Unterstützungsmassnahmen und dessen verfassungsrechtliche Verankerung 122–124
- 124–125 III. Der Unterstützungsanspruch als subjektiv-öffentliches Recht der Parteien 124–125
- 125–126 IV. Grenzen des Anspruchs auf gerichtliche Unterstützungsmassnahmen 125–126
- 126–129 V. Anfechtbarkeit gerichtlicher Ernennungsentscheidungen 126–129
- 126–128 A. Anfechtbarkeit im Geltungsbereich der D-ZPO 126–128
- 1. Negativer Ernennungsbeschluss
- 2. Positiver Ernennungsbeschluss
- 128–129 B. Anfechtbarkeit im Geltungsbereich des CH-IPRG 128–129
- 1. Negativer Ernennungsentscheid
- 2. Positiver Ernennungsentscheid
- 129–130 VI. Zusammenfassung 129–130
- 131–159 § 7 Entscheidungsbefugnisse der beiden Gerichtsbarkeiten im Widerstreit 131–159
- 131–132 I. Einführung 131–132
- 132–141 II. Beurteilung der Zuständigkeitsfrage im Rahmen von staatsgerichtlichen Feststellungsverfahren 132–141
- 132–133 A. Bestandsaufnahme 132–133
- 1. Rechtslage D-ZPO
- 2. Rechtslage CH-IPRG
- 133–137 B. Zulässigkeit staatsgerichtlicher Feststellungsverfahren zur Klärung der Zuständigkeitsfrage 133–137
- 1. Rechtslage vor Bildung des Schiedsgerichts
- a. Rechtslage D-ZPO
- b. Rechtslage CH-IPRG
- 2. Rechtslage nach Bildung des Schiedsgerichts
- a. Rechtslage CH-IPRG
- b. Rechtslage D-ZPO
- c. Keine Verzögerungsgefahr
- d. Rechtsschutzinteresse
- 137–138 C. Zum Gegenstand des Feststellungsverfahrens 137–138
- 138–138 D. Verzichtbarkeit des Feststellungsbegehrens 138–138
- 138–140 E. Wirkungen staatsgerichtlicher Feststellungen hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage 138–140
- 1. Erlass eines Schiedsspruchs nach rechtskräftiger staatsgerichtlicher Feststellung der Unzulässigkeit des Schiedsverfahrens
- 2. Erlass eines Schiedsspruchs vor rechtskräftiger staatsgerichtlicher Feststellung der Unzulässigkeit des Schiedsverfahrens
- 140–141 F. Ergebnis 140–141
- 141–154 III. Beurteilung der Zuständigkeitsfrage ausserhalb von staatsgerichtlichen Feststellungsverfahren 141–154
- 141–141 A. Einführung 141–141
- 141–143 B. Die Schiedseinrede 141–143
- 1. Notwendigkeit der Erhebung der Schiedseinrede
- 2. Wirkungen der staatsgerichtlichen Entscheidung über die Schiedseinrede
- 143–154 C. Die Rüge der Unzuständigkeit der Schiedsgerichts 143–154
- 1. Einführung
- 2. Zuständigkeitskriterium der bestehenden Schiedsfähigkeit
- 3. Positiver Zwischenentscheid
- a. Einführung
- b. Rechtslage im Rahmen des CH-IPRG
- c. Rechtslage im Rahmen der D-ZPO
- ca. Rechtliche Qualifikation des Zwischenentscheids
- cb. Wirkungen des Zwischenentscheids
- cc. Staatsgerichtliche Überprüfung des Zwischenentscheids
- 4. Negativer Zuständigkeitsentscheid
- a. Rechtslage im Rahmen des CH-IPRG
- b. Rechtslage im Rahmen der D-ZPO
- ba. Rechtliche Qualifikation des Zuständigkeitsentscheids
- bb. Aufhebbarkeit des Prozessschiedsspruchs im Falle der rechtsfehlerhaften Verneinung des Bestehens einer wirksamen Schiedsvereinbarung
- bc. Aufhebbarkeit des Prozessschiedsspruchs im Falle der rechtsfehlerhaften Annahme der Schiedsunfähigkeit des Streitgegenstands
- bd. Weitere staatsgerichtliche Rechtsschutzmöglichkeiten
- 154–154 D. Ergebnis 154–154
- 154–158 IV. Grundsatz der parallelen Sachentscheidungsbefugnis 154–158
- 154–155 A. Einführung 154–155
- 155–158 B. Der Anwendungsbereich der parallelen Sachentscheidungsbefugnis 155–158
- 1. Bestehen einer parallelen Sachentscheidungsbefugnis
- 2. Entfallen der parallelen Sachentscheidungsbefugnis
- 158–159 V. Zusammenfassung 158–159
- 160–163 § 8 Die schiedsgerichtliche Kostenentscheidung 160–163
- 160–160 I. Einführung 160–160
- 160–162 II. Verfassungsrechtliche Grundlagen der schiedsgerichtlichen Kostenentscheidung 160–162
- 162–163 III. Zulässigkeit der bezifferten Kostenentscheidung hinsichtlich des Schiedsrichterhonorars 162–163
- 163–163 IV. Rechtsschutz gegen den Kostenentscheid 163–163
- 163–163 V. Zusammenfassung 163–163
- 164–168 § 9 Schiedsgerichtsbarkeit und Grundrechte 164–168
- 164–164 I. Einführung 164–164
- 164–166 II. Vorüberlegungen 164–166
- 164–165 A. Schiedsspruch als private Willensäusserung 164–165
- 165–165 B. Fehlende Grundrechtsbindung Privater 165–165
- 165–166 C. Grundrechtsbindung kraft Vertrags 165–166
- 166–167 III. Grundrechtsverwirklichung durch den Staat 166–167
- 166–166 A. Erste Säule: Staatliche Anerkennung des Schiedsspruchs 166–166
- B. Zweite Säule: Staatliche Kontrolle des Schiedsspruchs
- 167–167 C. Dritte Säule: Staatliche Unterstützung des Schiedsverfahrens 167–167
- 167–168 IV. Ergebnis 167–168
- 169–172 § 10 Vorlageberechtigung der Schiedsgerichte zum EuGH – zum Verhältnis zwischen Staats- und Schiedsgerichtsbarkeit 169–172
- 169–169 I. Einführung 169–169
- 169–170 II. Unmittelbare Vorlageberechtigung der Schiedsgerichte 169–170
- 170–171 III. Vorlagegesuch des Schiedsgerichts an das Staatsgericht im Rahmen des § 1050 S. 1 D-ZPO 170–171
- 171–172 IV. Argumente gegen eine eigenständige schiedsgerichtliche Vorlagebefugnis 171–172
- 172–172 V. Zusammenfassung 172–172
- 173–175 § 11 Schiedsgerichtsbarkeit und Privatautonomie 173–175
- 173–173 I. Einführung 173–173
- II. Schiedsgerichtsbarkeit als Ausfluss der Privatautonomie?
- 175–175 III. Zusammenfassung 175–175
- 176–192 § 12 Fragen der Schiedsgesetzgebung 176–192
- 176–176 I. Einführung 176–176
- 176–177 II. Eckpunkte der Schiedsgesetzgebung 176–177
- 177–190 III. Darstellung der verschiedenen Regelungsebenen innerhalb der Schiedsgesetzgebung 177–190
- 177–178 A. Einführung 177–178
- 178–186 B. Anerkennungsebene 178–186
- 1. Einführung
- 2. Das Kriterium der Schiedsfähigkeit in der deutschen und schweizerischen Gesetzgebung – eine Bestandsaufnahme
- 3. Kritik an dem Kriterium der Vergleichsfähigkeit
- a. Einführung
- b. Untauglichkeit des Vergleichskriteriums
- c. Verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit der Abkopplung der Schiedsfähigkeit vom Kriterium der Vergleichsfähigkeit
- 4. Geeignetheit des Kriteriums der Vermögensrechtlichkeit des Anspruchs zur Definition der Schiedsfähigkeit
- 5. Lösungsansätze zur Normierung der Schiedsfähigkeit
- a. Notwendigkeit der konkreten Bestimmung des Anwendungsbereichs der Schiedsgerichtsbarkeit
- b. Gedanken zur Bestimmung des Anwendungsbereichs der Schiedsgerichtsbarkeit
- 6. Notwendigkeit der einheitlichen Definition des Kriteriums der Schiedsfähigkeit
- 7. Ergebnis
- 186–186 C. Unterstützungsebene 186–186
- 186–189 D. Aufhebungsebene 186–189
- 1. Aufhebungsgründe
- 2. Verzicht auf Rechtsmittel
- 3. Zur Beschwerdeinstanz
- 4. Ergebnis
- 189–190 E. Schiedsverfahrensrecht 189–190
- 1. Unterebene des zwingenden Schiedsverfahrensrechts
- 2. Unterebene des dispositiven Schiedsverfahrensrechts
- 190–192 IV. Zusammenfassung 190–192
- 193–202 § 13 Zusammenfassende Thesen 193–202
- 203–205 § 14 Anmerkungen zur Schiedsgesetzgebung in Deutschland 203–205
- 203–203 I. Ausgliederung des Schiedsrechts aus der D-ZPO 203–203
- 203–204 II. Konkretisierung des § 1030 D-ZPO 203–204
- 204–204 III. Verzicht auf § 1060 D-ZPO 204–204
- 204–204 IV. Erweiterung der Aufhebungsgründe 204–204
- 204–205 V. Abänderung des § 1050 D-ZPO 204–205
- 205–205 VI. Erweiterung des § 1032 Abs. 2 D-ZPO 205–205
- 205–205 VII. Abänderung des § 1040 Abs. 3 D-ZPO 205–205
- 206–209 § 15 Anmerkungen zur Schiedsgesetzgebung in der Schweiz 206–209
- 206–206 I. Kodifikation der Binnenschiedsgerichtsbarkeit in einem eigenständigen Gesetz 206–206
- 206–206 II. Konkretisierung des Anwendungsbereichs der Schiedsgerichtsbarkeit 206–206
- 206–207 III. Verzicht auf Art. 192 Abs. 2 CH-IPRG 206–207
- 207–207 IV. Erweiterung des Art. 192 Abs. 1 CH-IPRG 207–207
- 207–208 V. Angleichung der Aufhebungsvorschriften 207–208
- 208–208 VI. Abänderung des Art. 184 Abs. 2 CH-IPRG 168 VII. Verzicht auf Art. 179 Abs. 2 CH-IPRG 208–208
- 208–209 VIII. Normierung der Feststellungsklage 208–209
- 209–209 IX. Verzicht auf Art. 370 Abs. 2 E CH-ZPO 209–209
- 210–212 § 16 Fazit 210–212