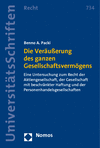Die Veräußerung des ganzen Gesellschaftsvermögens
Eine Untersuchung zum Recht der Aktiengesellschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Personenhandelsgesellschaften
Zusammenfassung
Bei einem Unternehmenskauf im Wege der Einzelrechtsnachfolge (asset deal) ist häufig fraglich, ob die Vermögensveräußerung einer Zustimmung der Anteilsinhaber bedarf. Der Autor stellt das Konzept des Zustimmungsvorbehalts bei Veräußerung des „ganzen Gesellschaftsvermögens“ auf völlig neue Beine. Danach kommt es für den Zustimmungsvorbehalt nicht auf eventuelle Auswirkungen auf den Unternehmensgegenstand an, sondern auf einen Wertvergleich bzw. Vergleich der Ertragskraft. Dazu ist eine Unternehmensbewertung unter Modifikationen und die Festlegung eines Schwellenwertes erforderlich. Ferner klärt der Autor für die einzelnen Gesellschaftsformen jeweils, welche Mehrheit zur Zustimmung und welche Formalia einzuhalten sind.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–20 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–20
- 21–26 Abkürzungsverzeichnis 21–26
- 27–30 Ausgewählte Normen 27–30
- 31–34 I. Einleitung und Gang der Untersuchung 31–34
- 35–223 II. Auslegung des Begriffes des „ganzen Gesellschaftsvermögens“ 35–223
- 35–39 1. Begriff des „Gesellschaftsvermögens“ 35–39
- 39–223 2. Begriff des „ganzen“ Gesellschaftsvermögens 39–223
- 39–46 a) Allgemeines 39–46
- aa) Veräußerung des „ganzen“ Gesellschaftsvermögens trotz des Verbleibens von Restvermögen
- bb) Kenntnis des Erwerbers
- (1) Allgemeines
- (2) Folgerungen für die einzelnen Gesellschaftsformen
- (a) Folgerungen für das Recht der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- (b) Folgerungen für das Recht der Personenhandelsgesellschaften
- (3) Zusammenfassung
- 46–125 b) quantitative Kriterien 46–125
- aa) Anwendbarkeit der quantitativen Kriterien
- bb) Qualifikation als „ganzes“ Vermögen durch Festlegung eines Schwellenwertes
- (1) Vorzugswürdigkeit einer pauschalierenden Betrachtungsweise gegenüber einer Einzelfallbetrachtung
- (a) Rechtsunsicherheit als Folge einer Einzelfallbetrachtung
- (aa) Gefahr der persönlichen Haftung der Mitglieder der Geschäftsleitung
- (bb) Unwirksamkeit der Veräußerung als Rechtsfolge
- (cc) Verzögerung von unternehmerisch sinnvollen Umstrukturierungen bei nicht notwendiger Anrufung der Versammlung der Anteilsinhaber
- (i) Kosten der Durchführung einer Versammlung der Anteilsinhaber
- (ii) Offenlegung gegenüber Wettbewerbern
- (iii) Zeitablauf bis zur Bestandskraft eines Beschlusses
- (iv) Zusammenfassung
- (dd) Verständnis der Rolle der Rechtsprechung
- (i) Rechtsunsicherheit im Bereich richterlicher Rechtsfortbildung und von Rechtsprechungsänderungen
- (ii) Rechtsunsicherheit bei unklarer Rechtslage
- (iii) Rechtssicherheit als elementarer Bestandteil einer gerechten Rechtsordnung
- (iv) Orientierung der höchstrichterlichen Rechtsprechung an den Auswirkungen auf die Allgemeinheit
- (v) Rechtsprechung als gesellschaftliche Dienstleistung
- (b) volkswirtschaftliche Auswirkungen der Rechtsunsicherheit
- (aa) Fehlallokation von volkswirtschaftlichem Produktivvermögen
- (i) wirtschaftliche Bedeutung der Möglichkeit zur Umstrukturierung von Unternehmen
- (ii) wirtschaftliche Neutralität in § 179a Abs. 1 AktG angelegt
- (iii) Ungeeignetheit des Rechts der Unternehmensumstrukturierungen zur Differenzierung zwischen wirtschaftlich sinnvollen und nicht sinnvollen Maßnahmen
- (iv) Auswirkungen auf die Finanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt
- (v) Zusammenfassung
- (bb) Parallele zu dem Politikziel des Abbaus von Verwaltungskosten
- (cc) erleichterte Umstrukturierungsmöglichkeit im Hinblick auf die Globalisierung der Wirtschaft
- (c) Zusammenfassung
- (2) Pauschalierung durch Festlegung eines Schwellenwertes mittels Betrachtung des Vermögenswertes
- (3) Schwellenwert als Verhältnis des verbleibenden zum gesamten Vermögen
- (4) Zwischenergebnis
- cc) Maßgeblicher Schwellenwert für die Qualifikation als „ganzes“ Vermögen
- (1) Anhaltspunkte aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung
- (a) „Hoesch/Hoogovens“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes
- (b) „Holzmüller“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes
- (c) „Altana/Milupa“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes
- (d) Nichtannahmebeschluss des Bundesgerichtshofes vom 20. November 2006
- (e) Zwischenergebnis
- (2) Wortlaut des § 179a Abs. 1 S. 1 AktG
- (3) Entwicklung unter Geltung der Vorgängerregelungen zu § 179a Abs. 1 AktG
- (a) Element der „Unerheblichkeit“
- (b) Element „einzelner“ Vermögensgegenstände
- (c) Zusammenfassung
- (4) Parallele zu vergleichbaren Regelungen
- (a) Parallele zu § 311b Abs. 2 bzw. Abs. 3 BGB
- (b) Parallele zu § 1822 Nr. 1 BGB
- (c) Parallele zu § 1 Abs. 1a UStG
- (d) Parallele zu § 25 Abs. 1 HGB
- (e) Parallele zu § 1365 Abs. 1 BGB
- (f) Parallele zu Instrumenten des Rechts der Unternehmensumstrukturierung
- (aa) in Betracht kommende Rechtsinstrumente
- (i) Squeeze-out
- (ii) Eingliederung
- (iii) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
- (bb) Gemeinsamkeiten und Unterschiede der in Betracht kommenden Rechtsinstrumente
- (cc) Vergleich der in Betracht kommenden Rechtsinstrumente mit der Veräußerung des ganzen Gesellschaftsvermögens
- (i) Vergleich im Allgemeinen
- (ii) Vergleich mit der übertragenden Auflösung
- (?) Vergleich im Hinblick auf die wirtschaftliche Folge der Maßnahmen
- (?) Vergleich im Hinblick auf die erforderliche Mehrheit des Zustimmungsbeschlusses
- (5) Zusammenfassung
- dd) Auswirkungen auf das Bewertungsverfahren
- (1) Allgemeines
- (2) Besonderheiten im Rahmen der Veräußerung des ganzen Gesellschaftsvermögens
- (a) Brutto- bzw. Nettokapitalisierung
- (b) ertragsteuerliche Belastung der Anteilsinhaber
- (aa) Allgemeines
- (bb) keine Anwendbarkeit im Rahmen des § 179a AktG
- (cc) Zwischenergebnis zur ertragsteuerlichen Belastung der Anteilsinhaber
- ee) Wertvergleich des Restvermögens mit dem Gesamtvermögen
- ff) Zwischenergebnis
- 125–220 c) qualitative Kriterien 125–220
- aa) Unterscheidung der Begriffe „Unternehmensziel“ und „Unternehmensgegenstand“
- (1) Unterschiedliche Verwendung der Begriffe durch den Gesetzgeber
- (2) Verwendung der Begriffe in der Literatur
- (3) Verwendung der Begriffe durch den Bundesgerichtshof
- (4) Unternehmensziele einer erwerbswirtschaftlich tätigen Gesellschaft
- (a) Unternehmensziel der „Gewinnerzielung“
- (aa) Parallele zu der Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Vereinen
- (bb) Rückschlüsse aus den Vorschriften über den Jahresabschluss und die Gewinnverwendung
- (cc) allgemeine Äußerungen in der Rechtsprechung und in der Literatur
- (dd) Zusammenfassung
- (b) Gewinnerzielung „zugunsten der Anteilsinhaber“
- (c) über die Gewinnerzielung hinausgehende Ziele
- (5) Unterscheidung der Begriffe des Unternehmenszieles und des Unternehmensgegenstandes bei sämtlichen Gesellschaftsformen
- (a) Unterscheidung bei den Kapitalgesellschaften
- (aa) Unterscheidung bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- (bb) Unterscheidung bei der Aktiengesellschaft
- (i) Argument des Anspruchs auf den Bilanzgewinn
- (ii) Argument der Verneinung der Beschränkung einer Aktiengesellschaft auf erwerbswirtschaftliche Zwecke durch den Gesetzgeber
- (iii) Argument der Unterscheidung zwischen Unternehmensgegenstand und Ziel bei Investmentaktiengesellschaften
- (iv) Gegenargument der mangelnden Flexibilität für Umstrukturierungsmaßnahmen
- (v) Argument der gesetzlichen Sonderregelungen zur Erleichterung von Umstrukturierungen
- (vi) Abwägung der Möglichkeit der Umstrukturierung gegen die Rechtssicherheit des Kapitalmarktes
- (vii) Zwischenergebnis
- (b) Unterscheidung bei den Personenhandelsgesellschaften
- (6) Unternehmensziel i.S.d. § 33 Abs. 1 S. 2 BGB
- (a) Allgemeine Erwägungen
- (b) Besondere Erwägungen mit Blick auf die einzelnen Gesellschaftsformen
- (aa) Anwendbarkeit des § 33 Abs. 1 S. 2 BGB im Recht der Kapitalgesellschaften
- (bb) Anwendbarkeit des § 33 Abs. 1 S. 2 BGB im Recht der Personenhandelsgesellschaften
- (7) Zwischenergebnis
- bb) Folge der Unterscheidung zwischen den Begriffen „Unternehmensziel“ und „Unternehmensgegenstand“ für die Auslegung des Begriffes des „ganzen“ Gesellschaftsvermögens
- (1) Wortlaut und Gesetzesbegründung des § 179a Abs. 1 AktG
- (2) Auslegung durch die Rechtsprechung und Literatur
- (a) Auslegung durch die „Holzmüller“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes
- (aa) Gesellschaftsvermögen als Grundlage der Unternehmenstätigkeit
- (bb) keine Weiterverfolgung der Unternehmensziele möglich
- (i) Wortlaut des von dem Bundesgerichtshof verwendeten Begriffes
- (ii) Vergleich mit der Begriffsverwendung in anderen Teilen der „Holzmüller“-Entscheidung
- (iii) Subsumtion des Bundesgerichtshofes
- (?) weitere Unternehmenstätigkeit durch verbleibendes Vermögen
- (?) „Abwerfen von Gewinn“
- (?) Erträge aus Beteiligungen
- (?) Zusammenfassung
- (iv) in der Satzung festgelegte Unternehmensziele
- (b) Auslegung durch die sonstige Rechtsprechung und Literatur
- (aa) Gleichsetzung des Begriffes der Unternehmensziele mit dem des Unternehmensgegenstandes
- (bb) Vorarbeiten von Timm als historische Begründung der Gleichsetzung
- (c) Auslegung unter Heranziehung des § 303 HGB-1900
- (3) Auslegung unter Berücksichtigung der Rechtsfolge des § 179a Abs. 1 AktG
- (a) Rechtsunsicherheit bei Abstellen auf den Unternehmensgegenstand
- (aa) Darstellung der Rechtsunsicherheit
- (bb) Konsequenzen dieser Rechtsunsicherheit
- (cc) Lösung der Rechtsunsicherheit
- (b) erhöhte Rechtsunsicherheit bei Abstellen auf den gelebten Unternehmensgegenstand
- (c) Interesse der Anteilsinhaber
- (d) keine Überprüfungsmöglichkeit durch den Erwerber
- (e) Widersprüchlichkeit bei dem Abstellen auf den Unternehmensgegenstand
- (f) Zusammenfassung
- (4) Zwischenergebnis
- cc) Konkretisierung der weiter bestehenden Möglichkeit der Gewinnerzielung
- (1) Ausnahme für Bagatellfälle einer erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit
- (a) Bagatellfälle bereits in der „Holzmüller“-Entscheidung
- (b) Notwendigkeit einer Ausnahme für Bagatellfälle
- (c) Pauschalierende Betrachtungsweise vorzugswürdig
- (2) Festlegung des Schwellenwertes einer noch ausreichenden Möglichkeit zu weiterer Gewinnerzielung
- (a) Auslegung unter Heranziehung des Sachverhalts der „Holzmüller“-Entscheidung
- (b) Auslegung unter Heranziehung der Rechtsprechung zur „Unerheblichkeit“
- (c) Auslegung unter Beachtung der quantitativen Kriterien zur Bestimmung des ganzen Gesellschaftsvermögens
- (aa) Entwicklung der Unternehmensbewertung in Betriebswirtschaft und Rechtsprechung
- (i) Entwicklung der Unternehmensbewertung in der betriebswirtschaftlichen Literatur und Praxis
- (ii) Entwicklung der Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung
- (iii) Zwischenergebnis
- (bb) heute gültige Grundsätze der Unternehmensbewertung
- (i) Ertragswertverfahren und Discounted-Cash-Flow-Verfahren als Bewertungsmethoden
- (ii) Brutto- bzw. Nettokapitalisierung
- (iii) Berücksichtigung der Ertragsteuern der Anteilsinhaber
- (iv) Ansatz des Liquidationswertes für nicht betriebsnotwendiges Vermögen
- (cc) Anwendbarkeit der Grundsätze der Unternehmensbewertung bei der Veräußerung des ganzen Gesellschaftsvermögens
- (i) Rechentechnik der Brutto- bzw. Nettokapitalisierung
- (ii) Berücksichtigung der Ertragsteuern der Anteilsinhaber
- (iii) Bewertung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens
- (dd) Folge für die Auslegung des Begriffes des ganzen Gesellschaftsvermögens unter qualitativen Kriterien
- (3) Zwischenergebnis
- 220–222 d) Parallele Anwendbarkeit der qualitativen neben den quantitativen Kriterien 220–222
- 222–223 e) Zusammenfassung 222–223
- 224–234 III. Einzelfragen zum Tatbestand der Veräußerung des ganzen Gesellschaftsvermögens 224–234
- 224–226 1. keine Berücksichtigung der Gegenleistung für die Vermögensübertragung 224–226
- 226–234 2. Behandlung von mehreren Einzelmaßnahmen 226–234
- 226–229 a) Parallele zu anderen Rechtsinstituten 226–229
- aa) Parallele zu der Gesamtbetrachtung bei der Hauptversammlungszuständigkeit nach der sog. „Holzmüller/Gelatine“-Rechtsprechung
- bb) Parallele zu § 419 BGB-1900
- 229–229 b) Irrelevanz eines wirtschaftlichen Zusammenhangs 229–229
- 229–234 c) zeitlicher Zusammenhang 229–234
- aa) Zeitraum von sechs Monaten
- bb) Verpflichtungsgeschäft als Anknüpfungspunkt
- 234–234 d) Zusammenfassung 234–234
- 235–288 IV. Rechtsfolge der Betroffenheit des Unternehmenszieles bei den einzelnen Gesellschaftsformen 235–288
- 235–236 1. Rechtsfolge des § 179a Abs. 1 AktG im Recht der Aktiengesellschaft 235–236
- 236–265 2. Anwendung des Rechtsgedankens des § 179a Abs. 1 AktG im Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und deren Rechtsfolge 236–265
- 236–245 a) Erfordernis eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung 236–245
- aa) Erforderlichkeit eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung
- (1) Gescheiterte Reform des Rechts der Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Jahre 1973
- (2) Schutzbedürftigkeit der Gesellschafter
- (3) Beschlusserfordernis durch Anwendung des in § 179a Abs. 1 AktG enthaltenen Rechtsgedankens
- (4) Beschlusserfordernis aufgrund von § 33 Abs. 1 S. 2 BGB
- (5) Zwischenergebnis
- bb) Auswirkung auf die Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte
- cc) Zwischenergebnis
- 245–259 b) erforderliche Mehrheit für die Zustimmung der Gesellschafterversammlung 245–259
- aa) Fehlen einer gesellschaftsvertraglichen Regelung
- (1) Parallele zu der Rechtslage bei Abschluss eines Unternehmensvertrages
- (a) keine Übertragbarkeit des § 293 Abs. 1 S. 2 AktG auf das Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- (b) keine Analogie zu umwandlungsrechtlichen Vorschriften
- (c) Parallele zu § 53 Abs. 3 GmbHG und Minderheitenschutz
- (d) Anwendbarkeit der Kernbereichslehre
- (2) Parallele zu der nachträglichen Vinkulierung der Geschäftsanteile
- (3) Parallele zu anderen Vereinbarungen mit Auswirkungen auf das Gewinnbezugsrecht der Gesellschafter
- (4) Zusammenfassung
- bb) Vorliegen einer gesellschaftsvertraglichen Regelung
- (1) Möglichkeit der Aufnahme einer Mehrheitsklausel in den Gesellschaftsvertrag
- (2) erforderliche Mehrheit für die Aufnahme einer Mehrheitsklausel in den Gesellschaftsvertrag
- (3) Mindestquorum der Mehrheitsklausel
- 259–265 c) Form der Zustimmung 259–265
- aa) notarielle Protokollierung des Zustimmungsbeschlusses
- bb) Form der Zustimmung der nicht erschienenen Gesellschafter
- cc) Zwischenergebnis
- 265–288 3. Anwendung des Rechtsgedankens des § 179a Abs. 1 AktG im Recht der Personenhandelsgesellschaften und deren Rechtsfolge 265–288
- 265–276 a) Erfordernis einer Zustimmung der Gesellschafter 265–276
- aa) Zustimmungsvorbehalt zugunsten der Gesellschafterversammlung in Rechtsprechung und Literatur
- bb) Stellungnahme
- (1) Rechtsgedanke des § 179a AktG als Begründung des Zustimmungsvorbehalts
- (2) Unwirksamkeit als Rechtsfolge
- (a) Interessen der Kommanditisten
- (b) Interessen der persönlich haftenden Gesellschafter
- (c) Zusammenfassung
- 276–285 b) erforderliche Mehrheit für die Zustimmung der Gesellschafter 276–285
- aa) Fehlen einer gesellschaftsvertraglichen Regelung
- bb) Vorliegen einer gesellschaftsvertraglichen Regelung
- (1) Allgemeines
- (2) erforderliche Mehrheit und weitere Anforderungen
- cc) Zusammenfassung
- 285–288 c) Form der Zustimmung 285–288
- 289–294 V. Ergebnis und Thesen 289–294
- 289–289 1. zum Zweck einer Gesellschaft 289–289
- 289–291 2. zum Begriff des „ganzen“ Gesellschaftsvermögens 289–291
- 291–292 3. zu weiteren Einzelfragen bei der Veräußerung des ganzen Gesellschaftsvermögens 291–292
- 292–294 4. zu den Auswirkungen auf die einzelnen Gesellschaftsformen bei der Veräußerung des ganzen Gesellschaftsvermögens 292–294
- 295–325 Literaturverzeichnis 295–325