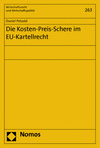Die Kosten-Preis-Schere im EU-Kartellrecht
Zusammenfassung
Häufig sind Unternehmen auf mehreren Marktstufen tätig und bieten Vorprodukte und Endleistungen aus einer Hand an. Wettbewerber, die nur auf der Endleistungsstufe anbieten, stehen mit den integrierten Unternehmen dort im Wettbewerb und sind zugleich auf deren Vorprodukte angewiesen. So können sie zweifachem Preisdruck ausgesetzt sein, der als Kosten-Preis-Schere (margin squeeze) bezeichnet wird. Das europäische Kartellrecht verbietet dies, wenn ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorliegt und hat für diese Fälle in Art. 102 AEUV eine eigenständige Fallgruppe Kosten-Preis-Schere entwickelt.
Die Studie entwickelt einen neuen, ökonomischen Erklärungsansatz für das gebotene kartellrechtliche Eingreifen bei der Kosten-Preis-Schere im EU-Kartellrecht. Hierfür werden vergleichend regulatorische Lösungsansätze herangezogen und erläutert, woraus die divergierende Herangehensweise im US-amerikanischen Kartellrecht resultiert.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–16 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–16
- 17–22 § 1 Einführung und Gang der Untersuchung 17–22
- 23–36 § 2 Die strukturellen Voraussetzungen für die erfolgreiche Durchführung einer Kosten-Preis-Schere 23–36
- 23–28 A. Vertikale Integration 23–28
- 28–30 B. Die Abhängigkeit von der Vorleistung 28–30
- 30–32 C. Marktmacht im vorgelagerten Markt 30–32
- 32–34 D. Marktmacht im nachgelagerten Markt 32–34
- 34–36 E. Zwischenergebnis 34–36
- 37–72 § 3 Die divergierende Behandlung von Kosten-Preis-Scheren in EU-Kartellrecht und US-Antitrustrecht 37–72
- 37–47 A. Die neuere europäische Fallpraxis zur Kosten-Preis-Schere 37–47
- 37–42 I. Das Verfahren Deutsche Telekom AG 37–42
- 42–44 II. Das Verfahren Telefónica 42–44
- 44–45 III. Die neueste Sichtweise der Kommission - das Prioritätenpapier 44–45
- 45–47 IV. Das Vorabentscheidungsverfahren TeliaSonera 45–47
- 47–54 B. Die Fallpraxis zur Kosten-Preis-Schere im US-Antitrustrecht 47–54
- 47–52 I. Von Alcoa zu Trinko 47–52
- 52–54 II. Das Verfahren linkLine 52–54
- 54–72 C. Die Ursachen der Divergenz 54–72
- 54–61 I. Leitbilder der Wettbewerbspolitik 54–61
- 61–64 II. Die Behandlung einseitiger Verhaltensweisen im Vergleich 61–64
- 64–68 III. Das Verhältnis zum Regulierungsrecht 64–68
- 68–72 IV. Zwischenergebnis 68–72
- 73–116 § 4 Margendruck durch Kosten-Preis-Scheren und die rechtliche Bewertung der Auswirkungen auf den geschützten Wettbewerbsprozess 73–116
- 73–78 A. Die Wirkweise einer Kosten-Preis-Schere und die Einflussgrößen des vertikal integrierten Monopolisten 73–78
- 78–81 B. Die Auswirkungen einer Kosten-Preis-Schere auf die Wettbewerbsstruktur 78–81
- 81–92 C. Die Plausibilität der Kosten-Preis-Schere als Behinderungsstrategie 81–92
- 81–90 I. Marktmachtübertragung und das single monopoly profit theorem 81–90
- 90–92 II. Motive für die Behinderung im nachgelagerten Markt ohne Übertragung von Marktmacht 90–92
- 92–116 D. Die kartellrechtliche Beurteilung der Auswirkungen einer Kosten-Preis-Schere 92–116
- 92–97 I. Der Missbrauchsbegriff als allgemeiner Bewertungsmaßstab 92–97
- 97–111 II. Die Abgrenzung zwischen zulässigem Margendruck und Behinderungsmissbrauch 97–111
- 1. Auswirkung des Verhaltens auf Wettbewerber
- 2. Auswirkung des Verhaltens auf die Erlöse des Marktbeherrschers
- 3. Auswirkungen auf die Konsumentenwohlfahrt
- 4. Zwischenergebnis
- 111–116 III. Zur Rechtfertigung durch Effizienzgewinne 111–116
- 117–186 § 5 Die Erfassung wettbewerbswidriger Auswirkungen einer Kosten- Preis-Schere durch andere Fallgruppen missbräuchlichen Verhaltens nach Art. 102 AEUV 117–186
- 117–151 A. Der Beitrag des Verbots der Kampfpreisunterbietung in Art. 102 AEUV 117–151
- 117–129 I. Grundzüge des Verbotes der Kampfpreisunterbietung im EU-Kartellrecht 117–129
- 129–132 II. Kampfpreismissbrauch und Kosten-Preis-Schere 129–132
- 132–135 III. Betrachtung der Opportunitätskosten des Vorleistungstransfers 132–135
- 135–142 IV. Zur Einbindung von Opportunitätskosten in der europäischen Fallpraxis 135–142
- 142–145 V. Opportunitätskosten des internen Transfers - Präzisierung des Verständnisses 142–145
- 145–151 VI. Die Einordnung als Kampfpreismissbrauch - Resümee und Ausblick 145–151
- 151–158 B. Der Beitrag des Verbots unangemessener Verkaufspreise in Art. 102 lit. a AEUV 151–158
- 151–156 I. Grundzüge des Verbots unangemessener Verkaufspreise im EU-Kartellrecht 151–156
- 156–158 II. Die Irrelevanz der Überhöhung des Vorleistungspreises für den Vorwurf des Behinderungsmissbrauchs 156–158
- 158–158 III. Ergebnis zum Beitrag des Verbots unangemessener Verkaufspreise 158–158
- 158–167 C. Der Beitrag des Diskriminierungsverbots in Art. 102 lit. c AEUV 158–167
- 158–163 I. Grundzüge des Verbotes der Preisdiskriminierung im EU-Kartellrecht 158–163
- 163–166 II. Handelspartnereigenschaft der nachgelagerten Einheit und Konzernprivileg 163–166
- 166–167 III. Ergebnis zum Beitrag des Verbots der Preisdiskriminierung 166–167
- 167–182 D. Der Beitrag des Verbots der unzulässigen Geschäftsverweigerung in Art. 102 AEUV 167–182
- 167–175 I. Grundzüge des Kontrahierungszwangs im EU-Kartellrecht 167–175
- 175–180 II. Das Erfordernis eines Belieferungszwangs in Kosten-Preis-Schere-Konstellationen 175–180
- 180–182 III. Ergebnis zum Beitrag des Verbots der unzulässigen Geschäftsverweigerung 180–182
- 182–186 E. Ergebnis zur Verortung der Kosten-Preis-Schere im System des Art. 102 AEUV 182–186
- 187–206 § 6 Die Verhinderung von Kosten-Preis-Scheren außerhalb des Art. 102 AEUV - ein Fall für die Regulierung? 187–206
- 187–197 A. Preisregulierung 187–197
- 187–193 I. Überblick über Methoden der Preisregulierung 187–193
- 193–197 II. Das Beispiel der ECPR - Opportunitätskosten im Regulierungskontext 193–197
- 197–206 B. Vertikale Separierung des integrierten Unternehmens 197–206
- 197–204 I. Prävention und Abhilfe von Margendruck durch Entflechtung 197–204
- 204–206 II. Fakultative Entflechtung durch Verpflichtungszusagen 204–206
- 207–226 § 7 Ergebnis der Untersuchung 207–226