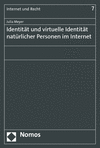Identität und virtuelle Identität natürlicher Personen im Internet
Zusammenfassung
Der oft verwendete Begriff der Identität wurde aus rechtlicher Sicht bisher nur selten untersucht. Das Werk ist die erste umfassende Untersuchung des Begriffs der Identität natürlicher Personen und ihres rechtlichen Schutzes in Bezug auf die elektronische Kommunikation.
Die Autorin definiert zunächst den Begriff der Identität. Auf der Grundlage einer Auseinandersetzung mit Identitätsbegriffen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen unterscheidet sie aus rechtlicher Sicht drei Begriffe: die numerische Identität, die soziale Identität und die virtuelle Identität. Es werden typische Gefährdungen der drei Aspekte im Internet aufgezeigt.
Sodann wird untersucht, wie numerische und soziale Identität durch besondere Persönlichkeitsrechte und das Allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützt werden. Hierbei wird ein neuer Schutzbereich des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts herausgearbeitet.
Hinsichtlich der virtuellen Identität wird deren Schutz durch Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechte untersucht. Die Autorin beantwortet auch die Frage, ob mit einer virtuellen Identität Persönlichkeitsrechte auf einen anderen Nutzer übergehen können.
Abschließend werden Rechtsfolgen von Identitätsverletzungen und die Haftung von Internetplattformbetreibern als mittelbare Störer erörtert.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–14 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–14
- 15–18 Abkürzungsverzeichnis 15–18
- 19–22 § 1 Einleitung 19–22
- 19–21 I. Bedeutung der Kommunikation per Internet 19–21
- 21–22 II. Gegenstand und Gang der Untersuchung 21–22
- 23–57 1. Kapitel: Identität und virtuelle Identität – Gefährdungen im Internet 23–57
- 23–48 § 2 Numerische Identität 23–48
- 23–31 I. Definition und Inhalt numerischer Identität 23–31
- 1. Definition
- 2. Identitätsdaten
- a) Personalien
- b) Personenkennzeichen
- c) Biografische und gesellschaftliche Daten
- d) Körperliche Merkmale
- 3. Bedeutung gesetzlicher Bestimmungen
- 31–38 II. Besonderheiten numerischer Identität im Internet 31–38
- 1. Digitalisierung von Identitätsdaten und digitale Identität
- 2. Kommunikation auf Internetplattformen
- a) Nutzerkonto (Nutzungsverhältnis zum Plattformbetreiber)
- b) Nutzerprofil (Plattformverhältnis zu anderen Nutzern)
- c) Pseudonymität und Anonymität
- d) Bedeutung von Nutzerprofilen
- 3. Besondere Identitätsdaten in der Kommunikation per Internet
- a) IP-Adresse
- b) Domainname
- c) E-Mail-Adresse
- 38–48 III. Gefährdung der numerischen Identität durch Identitätsmissbrauch 38–48
- 1. Identitätsmissbrauch, Abgrenzung zum Identitätsdiebstahl
- a) Identitätsdiebstahl
- b) Identitätsmissbrauch
- 2. Fallgruppen des Identitätsmissbrauchs im Internet
- a) Errichtung neuer Nutzerkonten und -profile
- b) Unbefugten Gebrauch von Nutzerkonten und -profilen
- aa) Zugangssicherung bei Nutzerkonten
- bb) Überwindung der Zugangssicherung
- (1) Phishing, Pharming, Trojaner
- (2) Angriffe auf biometrische Verfahren
- (3) Man-in-the-middle-Angriffe
- 48–48 IV. Fazit 48–48
- 48–52 § 3 Soziale Identität 48–52
- 48–50 I. Definition der sozialen Identität 48–50
- 50–52 II. Gefährdung der sozialen Identität im Internet 50–52
- 52–57 § 4 Virtuelle Identität 52–57
- 52–54 I. Definition der virtuellen Identität 52–54
- 1. Verständnis in den Sozialwissenschaften
- 2. Eigenes Verständnis
- a) Keine Erkennbarkeit des Nutzers
- b) Dauerhafte, konsistente Nutzung
- c) Eigene Definition
- 54–56 II. Plattformen mit häufig vorkommenden virtuellen Identitäten 54–56
- 1. Internetforen
- 2. Second Life
- 3. Auktionsplattform eBay
- 56–57 III. Gefährdungen bei virtueller Identität 56–57
- 58–132 2. Kapitel: Schutz numerischer und sozialer Identität durch Persönlichkeitsrechte 58–132
- 58–68 § 5 Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und besondere Persönlichkeitsrechte – dogmatische Grundlagen 58–68
- 58–64 I. Persönlichkeitsrechte als sonstige Rechte i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB 58–64
- 64–68 II. Verhältnis des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu den besonderen Persönlichkeitsrechten 64–68
- 1. Besondere Persönlichkeitsrechte keine Ausschnitte des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- 2. Allgemeines Persönlichkeitsrecht kein subsidiärer Auffangtatbestand
- 68–68 III. Ergebnis 68–68
- 68–103 § 6 Schutz numerischer und sozialer Identität durch besondere Persönlichkeitsrechte 68–103
- 68–93 I. Namensrecht gemäß § 12 BGB als Identitätsschutz 68–93
- 1. Namensgebrauch und Schutzzweck
- a) Bezeichnung der eigenen oder einer dritten Person
- b) Bezeichnung des Namensträgers
- aa) Namensnennung
- bb) Zuordnungsverwirrung durch kennzeichenmäßigen Gebrauch
- c) Reichweite des Schutzzwecks
- d) Besonderheiten des Gebrauchs eines Namens im Internet
- 2. Namen
- a) Bürgerlicher Name
- b) Wahlnamen (Pseudonyme)
- aa) Wortlaut und Systematik des § 12 BGB
- bb) Historische Auslegung
- cc) Sinn und Zweck: Verkehrsgeltung des Wahlnamens erforderlich
- c) Nutzernamen als Namen im Rechtssinn
- aa) Erfordernis der Verkehrsgeltung
- bb) Verkehrsgeltung und Erkennbarkeit der Person
- cc) Verkehrsgeltung eines Nutzernamens
- d) Zwischenergebnis
- 3. Weitere Voraussetzungen des § 12 BGB
- a) Gleicher Name
- b) Unbefugter Gebrauch
- c) Interessenverletzung
- 4. Keine analoge Anwendung des § 12 BGB auf andere Identitätsdaten
- 5. Ergebnis. Identitätsschutz durch das Namensrecht
- 93–102 II. Recht am eigenen Bild gemäß § 22 KUG als Identitätsschutz 93–102
- 1. Schutzzweck
- a) Bildnisschutz nicht nur bei kennzeichenmäßigem Gebrauch
- b) Selbstbestimmung über Darstellung
- 2. Bildnisse
- a) Darstellungsart und Erkennbarkeit
- b) Besonderheiten im Internet
- 3. Verletzungshandlungen des § 22 KUG
- a) Verbreiten
- b) Öffentliches Zurschaustellen
- c) Verletzungshandlungen des § 22 KUG bei Identitätsverletzungen
- 4. Keine analoge Anwendung des § 22 KUG auf andere Identitätsdaten
- 5. Ergebnis. Identitätsschutz durch Recht am eigenen Bild
- 102–103 III. Urheberpersönlichkeitsrecht gemäß §§ 12-14 UrhG als Identitätsschutz 102–103
- 103–103 IV. Ergebnis. Identitätsschutz durch besondere Persönlichkeitsrechte 103–103
- 103–132 § 7 Schutz numerischer und sozialer Identität durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht 103–132
- 103–105 I. Anwendbarkeit des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts 103–105
- 105–112 II. Dogmatische Grundlagen der inhaltlichen Konkretisierung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts 105–112
- 1. Begriff der Persönlichkeit
- 2. Güter- und Interessenabwägung
- 3. Sphärentheorie
- 4. Fallgruppenbildung
- 5. Neue besondere Persönlichkeitsrechte
- 6. Schutzbereiche: geschützte Interessen und typische Verletzungshandlungen
- 112–131 III. Schutzbereich der Identität im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht 112–131
- 1. Schutz der sozialen Identität vor Verfälschung
- a) Soziale Identität als geschütztes Interesse
- b) Verletzung der sozialen Identität durch Verfälschung
- aa) Verfälschende Tatsachendarstellung
- bb) Substantielle Verfälschung
- cc) Erkennbarkeit der Person
- c) Rechtswidrige Verletzung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- 2. Schutz der numerischen Identität vor Missbrauch
- a) Numerische Identität als geschütztes Interesse
- aa) Schutzwürdigkeit über namensrechtlichen Schutz hinaus
- bb) Schutz der numerischen Identität unabhängig von sozialer Identität
- b) Verletzung der numerischen Identität durch Identitätsmissbrauch
- aa) Identitätsdaten
- bb) Gebrauch als eigene Identitätsdaten
- cc) Unbefugter Gebrauch
- dd) Anwendungsfälle
- c) Rechtswidrige Verletzung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- 131–132 IV. Ergebnis. Identitätsschutz durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht 131–132
- 133–161 3. Kapitel: Schutz der virtuellen Identität 133–161
- 133–143 § 8 Schutz der virtuellen Identität durch Persönlichkeitsrechte 133–143
- 133–134 I. Schutz durch besondere Persönlichkeitsrechte 133–134
- 134–143 II. Schutz durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht 134–143
- 1. Virtuelle Identität als vom Allgemeinen Persönlichkeitsrecht geschütztes Interesse?
- 2. Ehrverletzungen bei virtueller Identität
- a) Meinungsstand
- b) Eigene Meinung
- aa) Innere Ehre
- bb) Äußere Ehre – soziale Geltung
- 3. „Soziale Identität“ bei virtueller Identität
- 4. Unbefugter Gebrauch einer virtuellen Identität
- 5. Schutzwürdigkeit
- 6. Verhältnis von numerischer und sozialer zu virtueller Identität bei pseudonymen Nutzerprofilen
- 143–143 III. Ergebnis. Schutz der virtuellen Identität durch Persönlichkeitsrechte 143–143
- 143–153 § 9 Schutz der virtuellen Identität durch Immaterialgüterrechte 143–153
- 143–145 I. Abgrenzung von Persönlichkeitsrechten und Immaterialgüterrechten 143–145
- 145–146 II. Keine Immaterialgüterrechte sui generis 145–146
- 146–153 III. Urheberrecht an virtueller Identität 146–153
- 1. Werkbegriff des Urheberrechts
- 2. Virtuelle Identität als Werk
- a) Immaterialgut oder Persönlichkeit
- b) Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 UrhG
- aa) Pseudonymisierung oder Anonymisierung einer Person
- bb) Urheberrechtsschutz nach den Grundsätzen über fiktive Figuren
- 3. Urheberpersönlichkeitsrecht und Allgemeines Persönlichkeitsrecht
- 153–153 IV. Ergebnis. Virtuelle Identität und Urheberrecht 153–153
- 153–161 § 10 Persönlichkeitsrechtlicher Schutz eines Erwerbers einer virtuellen Identität 153–161
- 153–157 I. Unübertragbarkeit von Persönlichkeitsrechten 153–157
- 157–160 II. Übertragbarkeit von Persönlichkeitsrechten bei virtueller Identität? 157–160
- 1. Bedeutung der Unverzichtbarkeit von Persönlichkeitsrechten
- 2. Immaterialgut und Persönlichkeitsinteressen bei virtueller Identität
- 160–161 III. Originärer Erwerb eigenen persönlichkeitsrechtlichen Schutzes 160–161
- 162–182 4. Kapitel: Haftung für Identitätsverletzungen 162–182
- 162–170 § 11 Rechtsfolgen von Identitätsverletzungen 162–170
- 162–166 I. Entschädigung für immateriellen Schaden 162–166
- 1. Allgemeine Voraussetzungen
- 2. Verletzungen numerischer, sozialer und virtueller Identität
- a) Gleichzeitige Verletzung sozialer und numerischer Identität
- b) Verletzung der sozialen Identität
- c) Verletzung der numerischen Identität
- d) Persönlichkeitsrechtsverletzungen bei virtueller Identität
- e) Gleichzeitige Verletzung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts und besonderer Persönlichkeitsrechte
- 166–170 II. Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche 166–170
- 1. Negatorischer Rechtsschutz von Persönlichkeitsrechten
- 2. Beseitigung
- 3. Unterlassung
- 4. Reichweite der Beseitigungs- und Unterlassungsverpflichtung
- 170–179 § 12 Störerhaftung des Plattformbetreibers 170–179
- 170–172 I. Allgemeine Voraussetzungen der Haftung mittelbarer Störer 170–172
- 1. Mittelbare Störer
- 2. Verletzung absoluter Rechte
- 172–175 II. Störerhaftung und Telemediengesetz 172–175
- 1. Keine Haftungsprivilegierungen bei Störerhaftung
- 2. Verbot allgemeiner Überwachungspflichten: Kenntnis des Plattformbetreibers
- 175–178 III. Zumutbare Prüfpflichten 175–178
- 178–179 IV. Rechtsfolge der Störerhaftung 178–179
- 1. Beseitigung
- 2. Unterlassung
- 179–179 V. Ergebnis 179–179
- 179–182 § 13 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 179–182
- 183–207 Literaturverzeichnis 183–207