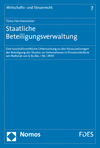Staatliche Beteiligungsverwaltung
Eine haushaltsrechtliche Untersuchung zu den Voraussetzungen der Beteiligung des Staates an Unternehmen in Privatrechtsform am Maßstab von § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO
Zusammenfassung
Das Werk hilft Wissenschaft, Verwaltung und Politik bei der Einordnung und Bewertung staatlicher Handlungs- und Organisationsinstrumente anhand der drei elementarsten Rechtsprinzipien: dem Gemeinwohl-, Wirtschaftlichkeits- und Subsidiaritätsprinzip.
Nicht zuletzt die im Herbst 2008 ausgebrochene Finanzmarktkrise, die sich zu einer globalen Wirtschaftskrise ausgeweitet und die Staatsverschuldung aufgrund staatlicher Interventionen in den Finanzmarktsektor (HRE) sowie teurer Konjunkturpakete in kaum beherrschbare Größenordnungen katapultiert hat, unterstreicht die Aktualität dieser Thematik und die Notwendigkeit, sich eingehender mit den Voraussetzungen der staatlichen Beteiligungsverwaltung zu befassen. Denn die Grundsatzfragen des "Ob" und "Wie" staatlicher Aufgabenerfüllung insbesondere bei wirtschaftlicher Betätigung des Staates in Organisationsformen des Privatrechts eröffnen eine über das Haushalts- und Verwaltungsrecht hinausgehende staats- und wirtschaftsverfassungsrechtliche Dimension.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–38 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–38
- 39–44 Abkürzungsverzeichnis 39–44
- 45–62 Teil 1 Einleitung 45–62
- 45–47 A. Gegenstand und Zweck der Arbeit 45–47
- 47–51 B. Beteiligungsmanagement und Beteiligungsportfolio des Bundes 47–51
- 47–48 I. Die beteiligungsverwaltenden Ressorts 47–48
- 48–51 II. Neuere Entwicklungen 48–51
- 1. Das staatliche Engagement im Raum- und Luftfahrtsektor
- 2. Das staatliche Engagement im Finanzmarktsektor
- 3. Beteiligungsbericht 2009
- 51–52 C. Gesamtwirtschaftlicher Einfluss öffentlicher Unternehmen 51–52
- 52–60 D. Rechtspolitisches Umfeld und verwaltungsrechtliche Grundlagen der staatlichen Beteiligungsverwaltung 52–60
- 52–54 I. Handlungs- und Organisationswahlfreiheit des Staates 52–54
- 54–56 II. Steuerungsinstrumente staatlicher Aufgabenerfüllung 54–56
- 1. Die vier Grundsteuerungsarten staatlicher Aufgabenwahrnehmung
- 2. Die sechs Steuerungsstufen staatlicher Intervention
- 56–60 III. Rechtliche Einordnung kooperativer Handlungs- und Organisationsformen 56–60
- 1. Argumente für die Wahl privatrechtlicher Organisationsformen
- 2. Schattenseiten der Organisationsprivatisierung
- 60–62 E. Folgerungen für die weitere Untersuchung 60–62
- 63–130 Teil 2 Terminologie und Arbeitsdefinitionen 63–130
- 63–72 A. Gemeinwohlinteressen 63–72
- 63–65 I. Gemeinwohl und Gemeinsinn 63–65
- 65–71 II. Gemeinwohl und öffentliche Interessen 65–71
- 1. Einzel- und Gruppeninteressen
- 2. Das Adjektiv öffentlich
- 3. Öffentliche versus private Interessen
- 4. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 71–72 III. Ziele, Zwecke und Maßnahmen 71–72
- 72–97 B. Öffentliche Aufgaben 72–97
- 72–80 I. Staatsaufgaben i.S.v. Art. 30 GG 72–80
- 1. Ausschließliche und konkurrierende Staatsaufgaben
- 2. Fallgruppen staatlicher Aufgabenwahrnehmung
- 3. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 80–85 II. Leistungen der Daseinsvorsorge 80–85
- 1. Der traditionelle, trägerbezogener Ansatz auf nationaler Ebene
- 2. Aufgabenbezogener Ansatz der Europäischen Kommission
- 3. Bedarfsbezogener Ansatz
- 4. Infrastruktur als Leistung der Daseinsvorsorge (Universaldienstleistungen)
- 5. Fiktion nichtwirtschaftlicher Interessen im Kommunalrecht
- 6. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 85–94 III. Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 85–94
- 1. Nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
- 2. Wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
- a. Dienste und Dienstleistungen
- b. Rechtsform- und Rechtsträgerneutralität des Dienstleisters
- c. (Binnen-) Marktbezogenheit der Dienstleistung
- d. Gemeinwohlbezogenheit der Dienstleistung
- 3. Exkurs: Die Regelung im Verfassungsvertrag
- 4. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 94–95 IV. Öffentliche Güter, private Güter und Mischgüter 94–95
- 95–97 V. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung 95–97
- 97–113 C. Öffentliche Unternehmen und Beteiligungen 97–113
- 97–102 I. Öffentliche Unternehmen im Sinne des EU-Vertrages 97–102
- 1. Rechtsform- und Rechtsträgerneutralität des Unternehmensbegriffs
- 2. Wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen
- 3. Das Adjektiv „öffentlich“ und das Merkmal der Beherrschung
- a. Art. 2 Transparenzrichtlinie
- b. Die Inhouse-Rechtsprechung des EuGH
- 102–103 II. Öffentliche Unternehmen im deutschen Recht 102–103
- 103–111 III. Unternehmen und Beteiligungen im Sinne des nationalen Haushaltsrechts 103–111
- 1. Abgrenzung zu öffentlich-rechtlichen Unternehmen
- 2. Beteiligungsrechtliche Organisationsinteressen und -formen
- 3. Unternehmen i.S.v. § 65 BHO
- a. Zulässige Gesellschaftsformen
- b. Konzern- und Holdingstrukturen
- 4. Beteiligungen i.S.v. § 65 BHO
- a. Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen
- b. Trägerstrukturen
- aa. Rein öffentliche und gemischtöffentliche Unternehmen
- bb. Gemischtwirtschaftliche Unternehmen
- 111–113 IV. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung 111–113
- 113–130 D. Begriffe und Formen der Privatisierung 113–130
- 113–114 I. Privatisierungsfähige Verwaltungsaufgaben 113–114
- 114–115 II. Die Rechtsbegriffe Privatisierung, Entstaatlichung und Ausgliederung 114–115
- 115–121 III. Privatisierungsformen 115–121
- 1. Materielle Privatisierung
- a. Entstaatlichung durch materielle Aufgabenprivatisierung
- b. Staatsfinanzierung durch Vermögens- bzw. Kapitalprivatisierung
- c. Grenzen der materiellen Privatisierung
- 2. Formelle Privatisierung
- 121–128 IV. Die Termini ÖPP/PPP/IÖPP/PFI 121–128
- 1. Historischer Exkurs – PPP und Pittsburgh
- 2. Öffentlich-private Partnerschaften (Public Private Partnerships)
- 3. Gemischtwirtschaftliche Unternehmen als sog. „institutionelle öffentlich-private Partnerschaften“ (IÖPP)
- 4. Finanzierung öffentlicher Aufgaben und Private Finanzierungsinitiative (PFI)
- a. Finanzierung von Universaldienstleistungen
- b. Grundvertragsmodelle zur Finanzierung von Infrastrukturvorhaben
- aa. Leasing, Konzessions- und Factoringmodelle
- bb. Inhaber- und Contractingmodelle
- cc. Mischmodelle, insbesondere Betreibermodelle (BOT-/BOO-Modell)
- 5. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 128–130 V. Folgerungen für die Prüfung einer Organisationsprivatisierung 128–130
- 1. (Fort-) Bestehen einer öffentlichen Aufgabe
- 2. Organisatorische Umsetzung der öffentlichen Aufgabe
- 131–276 Teil 3 Das Gemeinwohlprinzip als verfassungsrechtliches und ökonomisches Leitprinzip 131–276
- 131–141 A. Gemeinwohl und Gemeinsinn im Verfassungsstaat 131–141
- 131–133 I. Der Gemeinwohlauftrag der Verfassung 131–133
- 133–141 II. Gemeinwohlidee und Staatsverständnis 133–141
- 1. Das Staatsverständnis westlicher Demokratien
- 2. Die pluralistische Konzeption des heutigen Verfassungsstaates
- a. Zum Gemeinsinn und dessen Vermittlung im freiheitsgewährendem Staat
- b. Gemeinwohlkonkretisierung in den Wissenschaften
- 141–173 B. Gemeinwohlverpflichtung, Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz 141–173
- 141–142 I. Grundrechtsbindung des staatlichen Trägerhaushalts gem. Art. 1 Abs. 3 GG 141–142
- 142–143 II. Grundrechtsbindung der Verwaltung in Privatrechtsform 142–143
- 143–144 III. Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz von Privatpersonen 143–144
- 144–166 IV. Grundrechtsschutz und Grundrechtsbindung von Unternehmen i.S.v. § 65 BHO 144–166
- 1. Alternativität von Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz (Konfusionsargument)
- 2. Grundrechtschutz gemischtwirtschaftlicher Unternehmen
- a. Das Tatbestandsmerkmal „juristische Personen“
- b. Das Tatbestandsmerkmal „inländisch“
- c. Das Tatbestandsmerkmal „ihrem Wesen nach“ und die Durchgriffstheorie
- aa. Kritische Würdigung der Rechtsprechung des BVerfG (HEW-Beschluss)
- (1) Das Funktionskriterium (Qualität der öffentlichen Aufgabe)
- (2) Das Beherrschungskriterium (Beteiligung- und Stimmverhältnisse)
- (3) Das Bindungskriterium (öffentlich-rechtliche Zweckbindung)
- bb. Zwischenergebnis
- 3. Eigene Auffassung: Partielle Grundrechtsschutzbeschränkung durch gesellschaftsvertragsrechtliche Zweckbindung an das staatliche Interesse
- a. Grundsatz der Grundrechtsfähigkeit öffentlicher Unternehmen
- b. Ausnahmetatbestände
- c. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- aa. Legitimation des Unternehmens durch Bindung an den öffentlichen Sachzweck
- bb. Gesellschaftsrechtliche Transformation der staatlichen Einwirkungspflichten
- cc. Einschränkung des grundrechtlichen Schutzbereiches durch Zweckbindung
- dd. Einschränkung des grundrechtlichen Schutzbereiches aufgrund staatlicher Kontrollmechanismen
- d. Ergebnis
- 4. Zusammenfassung zu IV.: Grundrechtsschutz und Grundrechtsbindung von Unternehmen i.S.v. § 65 BHO
- 166–171 V. Bindung und Schutz von Unternehmen durch das Gemeinschaftsrecht 166–171
- 1. Europäischer Grundrechtsschutz
- 2. Die gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten
- a. Grundfreiheitsberechtigung
- b. Grundfreiheitsbindung
- aa. Bindung und Einwirkungspflicht der staatlichen Beteiligungsverwaltung
- bb. Unmittelbare Bindung öffentlicher Unternehmen im Sinne des Gemeinschaftsrechts
- cc. Bindung von Unternehmen mit staatlicher Minderheitsbeteiligung
- 171–173 VI. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung 171–173
- 173–212 C. Der Schutz öffentlicher Interessen in und durch die Rechtsordnung 173–212
- 173–181 I. Struktur und Funktion der Freiheits- und Gleichheitsgrundrechte 173–181
- 1. Die personalistische Grundentscheidung des Grundgesetzes
- 2. Allgemeine und wirtschaftliche Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)
- 3. Die Berufs- und Wettbewerbsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG)
- 4. Eigentumsgarantie und Sozialbindung (Art. 14, 15 GG)
- 5. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 181–183 II. Der Beamtenvorbehalt (Art. 33 Abs. 4 GG) 181–183
- 1. Die Wahrnehmung ständiger Aufgaben
- 2. Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse
- 183–184 III. Staatszielbestimmungen 183–184
- 184–212 IV. Staatsstrukturprinzipen 184–212
- 1. Das demokratische Prinzip
- a. Die Treuhandfunktion des Staates in der Volksherrschaft
- b. Mehrheits- versus Freiwilligkeitsprinzip
- c. Personelle und sachliche Legitimation öffentlicher Unternehmen i.S.v. § 65 BHO
- aa. Institutionelle und personelle Legitimation
- bb. Sachlich-inhaltliche Legitimation
- cc. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 2. Das Bundesstaatsprinzip
- 3. Das Sozialstaatsprinzip
- 4. Das Rechtsstaatsprinzip
- a. Der Vorbehalt des Gesetzes und die Wesentlichkeitstheorie
- aa. Zum Gesetzesvorbehalt im Range der Beteiligungsverwaltung
- bb. Zum Gesetzesvorbehalt bei Subventionierung öffentlicher Unternehmen
- b. Das Untermaßgebot
- c. Das Übermaßgebot (Verhältnismäßigkeitsprinzip im weiter Sinne)
- aa. Die drei Teilgebote des Verhältnismäßigkeitsprinzips
- bb. Das Gebot der Geeignetheit
- cc. Das Erforderlichkeitsgebot
- (1) Das modifizierte „Pareto-Kriterium“
- (2) Konservierung der selbständigen Zwecke nach dem sog. „Pareto-Kriterium“
- (3) Kompensation der unselbständigen Zwecke nach dem sog. „Kaldor-Hicks-Kriterium“
- (4) Ergebnis
- dd. Das Proportionalitätsgebot (Verhältnismäßigkeit im engern Sinne)
- (1) Rechtsprinzipien und hieraus ableitbare Kollisions- bzw. Abwägungsgesetze
- (2) Zur Berücksichtigung von fiskalischen Interessen und Verwaltungskosten
- ee. Zur Einordnung des ökonomischen Minimalprinzips als finanzrechtliche Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsprinzips
- 212–248 D. Die staatliche Verantwortung in der sozialen Marktwirtschaft 212–248
- 212–222 I. Die verfassungsrechtliche Ausgangslage 212–222
- 1. Wirtschaftspolitische Neutralität und -verfassungsrechtliche Offenheit
- a. Das Modell der „sozialen Marktwirtschaft“
- b. Wirtschaftsverfassungsrechtliche Grundprinzipien
- 2. Das Wirtschaftsmodell der Europäischen Union
- a. Die Europäisierung des deutschen Wirtschaftsrechts
- b. Exkurs: Der Vertrag über eine Verfassung für Europa, der Vertrag von Lissabon und die Grundrechtscharta
- c. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 3. Zur Herleitung von Privatisierungsgeboten
- 222–234 II. Wirtschaftstheoretische Grundlagen der Beteiligungsverwaltung 222–234
- 1. Effizienz und Gerechtigkeit als Maßstäbe staatlicher Wirtschaftstätigkeit
- 2. Der Homo Oeconomicus: Das ökonomische Prinzip als Rationalprinzip
- a. Rationalität der Verfassung und politische Realität
- b. Normative und positive Anknüpfungspunkte der Wirtschaftstheorie
- c. Ableitung gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrtfunktionen
- 3. Öffentliche Unternehmen und die Neue Institutionenökonomie
- a. Theorie der Eigentums- und Verfügungsrechte (Property-Rights-Theorie)
- b. Transaktionskostentheorie
- c. Prinzipal-Agenten-Theorie (Economic Theorie of Agency)
- 4. Staats- und Marktfunktionen in der Wettbewerbsordnung
- a. Marktversagen
- b. Staatsversagen
- c. Spieltheorie und Doppelfunktion des Unternehmerstaates
- 5. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 234–243 III. Zur Instrumentalfunktion öffentlicher Unternehmen 234–243
- 1. Inhalt der Instrumentalthese
- 2. Einwände gegen die Instrumentalthese
- a. Zweifel an der Gemeinwohlorientierung des politischen Unternehmensträgers
- b. Keine hinreichende Konkretisierung des Unternehmenszwecks
- c. Strukturelle Ineffizienz öffentlicher Unternehmen
- aa. Grundsatz der wirtschaftlichen Neutralität der rechtlichen Organisationsform
- bb. Problematik der Wirtschaftlichkeitsmessung und Effizienzanalyse
- (1) Kamerale und doppische Wirtschaftsrechung
- (2) Das Speyerer Verfahren
- (3) International Public Accounting Standards (IPSAS)
- (4) Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- cc. Informations- und Wissensasymmetrien in komplexen Organisationen
- dd. Ergebnis
- 243–244 IV. Theorie der anfechtbaren Märkte 243–244
- 244–248 V. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung 244–248
- 248–267 E. Instrumente zur Kontrolle der staatlichen Beteiligungsverwaltung 248–267
- 248–254 I. Risikoverteilung, staatliche Letztverantwortlichkeit und Ausfallhaftung 248–254
- 1. Innerstaatliche Ausfallhaftung und staatliche Fachaufsicht
- 2. Staatliche Wirtschaftsaufsicht und Regulierung
- a. Regulierung als Rechtsbegriff
- b. Beispiele staatlicher Regulierung im Infrastrukturbereich
- c. Regulierung und öffentliche Bindung
- d. Vor- und Nachteile staatlicher Regulierung
- 3. Zwischenergebnis
- 254–260 II. Staatliche Kontrollinstitutionen im Range der Beteiligungsverwaltung 254–260
- 1. Die Rolle der beteiligungsverwaltenden Exekutive
- 2. Eingeschränkter Prüfungsauftrag der Rechnungshöfe
- 3. Eingeschränkte parlamentarische Kontrolle
- 4. Haushaltskontrolle
- a. Finanzkontrolle des Bundes
- b. Finanzkontrolle bei institutionellen Zuwendungen
- 5. Gesellschaftsrechtliche Kontrollinstrumente
- 260–260 III. Kontrolle und Steuerung staatlicher Stabilisierungsmaßnahmen nach dem FMStG 260–260
- 260–262 IV. Private Kontrollsysteme 260–262
- 1. Kontrolle durch den Gütermarkt
- 2. Kontrolle durch den Kapitalmarkt
- 262–263 V. Aufsicht und Kontrolle durch unabhängige Kommissionen 262–263
- 263–264 VI. Eigenkontrolle durch Selbstbindung im Rahmen eines „Public Corporate Governance Kodex“ 263–264
- 264–264 VII. Kontrolle durch die mediale Öffentlichkeit 264–264
- 264–265 VIII. Kontrollkosten 264–265
- 265–267 IX. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung 265–267
- 267–276 F. Ergebnis zu Teil 3 267–276
- 277–502 Teil 4 Die drei Grundprinzipien der staatlichen Beteiligungsverwaltung 277–502
- 277–338 A. Die zwei Gemeinwohlklauseln des § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO 277–338
- 277–289 I. Das „wichtiges Interesse“ als staatsorganisationsrechtliches Formalziel 277–289
- 1. Zur sachzielbezogenen Auslegung der herrschenden Meinung
- a. Kritische Stellungnahme
- aa. Unternehmensanteile von „besonderer Bedeutung“ i.S.v. § 65 Abs. 7 Satz 1 BHO
- bb. Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung i.S.v. § 6 BHO
- b. Argumente für eine formale Auslegung
- aa. Das staatsorganisationsrechtliche Regel-Ausnahme-Prinzip
- bb. Das „unmittelbare wichtige Interesse“ i.S.v. Art. 65 Abs. 1 Nr. 1 bayHO
- 2. Das finanzorganisationsrechtliche „erhebliche Interesse“ i.S.v. § 23 BHO
- a. Staatliche Zuwendungen in Form von Zuschüssen an Unternehmen i.S.v. § 65 BHO als subsidiäres Finanzierungsinstrument
- aa. Zuwendungsbegriff und Zuwendungsarten
- (1) Zuweisungen und Zuschüsse
- (2) Projektförderung und institutionelle Förderung
- bb. Die Zuwendungsvoraussetzungen
- b. Das „erhebliche Interesse“ i.S.v § 23 BHO
- 3. Ergebnis
- 289–300 II. Der „angestrebte Zweck“ als staatsaufgabenrechtliches Sachziel 289–300
- 1. Staatliche Gemeinwohlverantwortung und Aufgabenkompetenz
- a. Aufgabenabgrenzung und Verbot der Doppelzuständigkeit
- b. Sonderproblem der Mischfinanzierung
- c. Sonderproblem der Aufgabenüberschneidung bei institutioneller Förderung
- aa. Verbot der Doppelveranschlagung für denselben Zweck gem. § 17 Abs. 4 BHO
- (1) Ausnahmen und Abgrenzung von Zweck und Maßnahme
- (2) Adressat des haushaltrechtlichen Verbotes der Doppelveranschlagung
- (3) Vermeidungsstrategien
- bb. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 2. Technische versus gemeinwohlorientierte Auslegung des Zweckbegriffs
- a. Technische Auslegung des Zweckbegriffs
- aa. Stellungnahme
- bb. Zwischenergebnis
- b. Gemeinwohlorientierte Auslegung
- 3. Ergebnis
- 300–304 III. Begründungspflicht und Bindungswirkung des § 65 Abs. 1 BHO 300–304
- 1. Nachweis eines wichtigen Organisationsinteresses
- 2. Nachweis eines öffentlichen Subventions- bzw. Interventionsinteresses
- 3. Abweichen vom Normbefehl aus wichtigem Grund
- a. Öffentlich-private Partnerschaften als atypischer Fall
- b. Stellungnahme und Ergebnis
- 304–310 IV. Gestaltungsmissbrauch 304–310
- 1. Finanzierungsgesellschaften
- 2. Steuersparmodelle
- 3. Personalpolitik
- 4. Eingehen von mittelbaren Beteiligungen zur Umgehung des § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO
- 5. Gründung von Stiftungen bürgerlichen Rechts
- 6. PPP- bzw. PFI-Projekte
- 7. Stellungnahme und Ergebnis
- 310–334 V. Wirtschaftliche Betätigung des Staates, staatliches Gewinn- und Fiskalinteresse 310–334
- 1. Das staatliche Einnahmeinteresse
- a. Gemeinschaftsrechtliche Schranken
- b. Finanz- und Wirtschaftsverfassungsrechtliche Schranke (Steuerstaatsprinzip)
- aa. Das Verhältnis von Steuern und privatrechtlichen Einnahmen
- bb. Zwischenergebnis
- c. Haushaltsrechtliche Schranke
- aa. Hinweise für die Verwaltung von Bundesbeteiligungen
- bb. Stellungnahmen in der haushaltsrechtlichen Literatur
- cc. Die Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 2 BHO
- dd. Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip
- d. Exkurs: Keine Anerkennung reiner Fiskalinteressen im Kommunalrecht
- aa. Der öffentliche Zweck als Primärziel (Vorrangprinzip)
- bb. Neben- und Annextätigkeiten
- e. Stellungnahme und Ergebnis
- 2. Verfassungsrechtliche geregelte Bereiche staatlicher Wirtschaftstätigkeit
- a. Die wirtschaftliche Betätigung im Finanzsektor
- b. Die wirtschaftliche Betätigung im Schienenverkehrssektor
- c. Liberalisierung auf dem Post- und Telekommunikationssektor
- aa. Wegfall der Legitimation staatlichen Wirtschaftens und eines Beteiligungsinteresses des Bundes im Telekommunikationssektor
- bb. Wegfall der Legitimation staatlichen Wirtschaftens und eines Beteiligungsinteresses des Bundes im Postsektor
- d. Liberalisierung des Energiesektors
- 3. Staatliche Maßnahmen auf Grundlage der Finanzmarktstabilisierungsgesetze
- a. Der Finanzmarktstabilisierungsfonds des Bundes (SoFFin)
- b. Überblick über die Stabilisierungsmaßnahmen gem. §§ 6–8 FMStFG, §§ 2–4 FMStFV
- aa. Rekapitalisierung (§ 7 FMStFG, § 3 FMStFV)
- bb. Garantieermächtigung (§ 6 FMStFG, § 2 FMStFV)
- cc. Risikoübernahme (§ 8 FMStFG, § 4 FMStFV)
- c. Voraussetzungen einer staatlichen Beteiligung an einem Unternehmen des Finanzmarktes i.S.v. § 7 FMStFG, § 3 FMStFV [Rekapitalisierung]
- aa. Vorliegen der drei Grundprinzipien der staatlichen Beteiligungsverwaltung
- bb. Sonstige Vorgaben
- d. Stellungnahme
- 4. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 334–336 VI. Überprüfung des Vorliegens eines wichtigen Organisationsinteresses und Kontrolle der öffentlichen Zwecksetzung 334–336
- 1. Das öffentliche Interesse als Kontrollgegenstand des Bundesrechnungshofs
- 2. Gerichtliche Kontrolle staatlicher Entscheidungen
- 336–338 VII. Zusammenfassung zu A.: Die zwei Gemeinwohlklauseln des § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO 336–338
- 338–389 B. Gesellschaftsrechtliche Absicherung des staatlichen Gemeinwohlauftrags 338–389
- 338–345 I. Grad der Einflussmöglichkeit 338–345
- 1. Zielkonflikte zwischen Unternehmen und Unternehmensträger am Beispiel der DB AG
- 2. Zielkonflikte bei Eigenunternehmen am Beispiel der DB AG
- 3. Zielkonflikte bei gemischtöffentlicher Beteiligungsstruktur am Beispiel der EADS N.V.
- 4. Zielkonflikte bei gemischtwirtschaftlicher Beteiligungsstruktur am Beispiel der VW AG
- 5. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 345–353 II. Die Fortschreibung des staatlichen Sachzwecks in der Unternehmensverfassung 345–353
- 1. Zur Unterscheidung von Gesellschaftszweck und Gesellschaftsgegenstand
- 2. Zur ökonomischen Notwendigkeit der Gemeinwohlkonkretisierung
- a. Zielkonkretisierung im Gesellschaftszweck versus Flexibilität der Geschäftsführung
- aa. Inkurs: Grundsatz der sachlichen Spezialität versus Grundsatz der Haushaltsklarheit
- bb. Stellungnahme
- b. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 3. Anforderungen an die inhaltliche Ausgestaltung der Unternehmensverfassung
- a. Vergleich mit §§ 59, 60 Abgabenordnung
- b. Zif. 1.1.4 des „Public Corporate Governance Kodex“ der Landeshauptstadt Stuttgart
- 4. Allgemeine Schlussfolgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 5. Spezielle Schlussfolgerung für reine Industriebeteiligungen
- 353–371 III. Alternative Sicherstellung der Einhaltung des staatlichen Beteiligungszwecks 353–371
- 1. Anforderungen bei fehlender Implementierung des staatlichen Beteiligungszwecks in der Unternehmensverfassung
- a. Vorliegen eines eine Ausnahme rechtfertigenden Sachgrundes (übergeordnete Gemeinwohlinteressen)
- aa. Materielle Privatisierungspläne
- bb. Außerhalb des Unternehmens liegende Gemeinwohlinteressen
- b. Unmittelbare Verpflichtung der Unternehmensleitung auf das übergeordnete Gemeinwohlinteresse
- c. Sicherstellung von Informationsrechten
- d. Gesetzliche Befristung des staatlichen Beteiligungsengagements
- 2. Sicherung des staatlichen Beteiligungszwecks durch die Gesellschafterstellung
- a. Zum Merkmal der Beherrschung im Rahmen der Beteiligungsverwaltung
- aa. Zur Frage der Angemessenheit der Einflussnahme
- bb. Zur Frage der Art und Weise der Einflussnahme
- b. Umgehung der Gemeinwohlbindung durch Eingehen von mittelbaren Beteiligungen
- aa. Keine Anwendung des § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO
- bb. Mittelbare Gemeinwohlbindung über § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO
- cc. Unmittelbare verfassungsrechtliche Gemeinwohlbindung
- dd. Stellungnahme
- c. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 3. Gesellschaftsvertragliche Sonder- und Vetorechte
- a. Die „golden share“ Großbritanniens an der britischen Flugsicherungsgesellschaft National Air Traffic Services
- b. Die Sonderrechte des Bundes und des Landes Niedersachsen an der Volkswagen AG
- c. Gesellschaftsvertragliche Sonder- und Vetorechte versus Europäisches Wettbewerbsrecht
- d. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 4. (Gesellschafts-) vertragliche Absicherung des staatlichen Informationszugriffs
- a. Wissensverlust durch Aufgabendelegation
- aa. Informations- und Wissensdefizite bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation
- bb. Wissensverlust der Britischen Airforce nach Aufgabeprivatisierung
- cc. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- b. Die Informationsinteressen der unmittelbaren Kooperationsbeteiligten
- aa. Gesellschaftsrechtliche Informationsrechte des staatlichen Anteilseigners
- bb. Inkurs: Zum Informationsinteresse des Bürgers als mittelbar Beteiligter
- c. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 371–378 IV. Zur Bindung der Geschäftsleitung an den öffentlichen Sachzweck 371–378
- 1. Persönliche Interessenskonflikte der Geschäftsleitung
- 2. Auswirkungen auf die Geschäftsberichtspraxis
- a. Klassische Mängel in den Geschäftsberichten
- b. Vorschläge zur qualitativen Verbesserung der Geschäftsberichtspraxis
- 3. Personelle Anforderungen an die Geschäftsleitung
- 378–384 V. Exkurs: Zur Frage der Notwendigkeit eines Verwaltungskooperationsrechtes 378–384
- 1. Überblick zu den in der Literatur vertretenen Ansätzen
- a. Gründe für eine Stärkung des „kooperativen Staates“
- b. Kritik am Leitbild des kooperativen Gewährleistungsstaates
- c. Regelungsbedarf
- 2. Stellungnahme im Hinblick auf die Beteiligungsverwaltung
- 384–387 VI. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung 384–387
- 387–389 VII. Zusammenfassung zu B.: Gesellschaftsvertragliche Absicherung des staatlichen Gemeinwohlauftrags 387–389
- 389–454 C. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip 389–454
- 389–402 I. Kerngehalt des Wirtschaftlichkeitsprinzips 389–402
- 1. Die drei Teilgebote des Wirtschaftlichkeitsprinzips
- a. Das Minimalprinzip
- b. Das Maximalprinzip
- c. Das Optimalprinzip
- 2. Betrachtungsebenen des ökonomischen Prinzips
- a. Einzel- und Gesamtwirtschaftlichkeit
- b. Gemeinwirtschaftlichkeit und Allimentationsprinzip
- c. Bedarfswirtschaftlichkeit und Sachzielpriorität
- 3. Erfolgs- und Kontrollinstrumente der Wirtschaftlichkeit
- a. Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität als Erfolgsmaßstäbe
- b. Das Verhältnis von Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Effizienz
- aa. Das Effektivitätsprinzip ("Richtige Dinge tun")
- bb. Das Effizienzprinzip ("Dinge richtig tun")
- c. Exkurs: Zum Ausblendungskonzept der internen Budgetierung
- 4. Die Gewichtung der Wirtschaftsprinzipien anhand der jeweiligen Zielkonzeptionen
- 5. Folgen der Vieldimensionalität des Wirtschaftlichkeitsbegriffs
- 402–423 II. Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip 402–423
- 1. Wirtschaftlichkeit als offenes Rechtsprinzip und formales Optimierungsgebot
- a. Grundsätzliche Einwände
- aa. Zur Bindungswirkung der öffentlichen Hand an das Wirtschaftlichkeitsprinzip
- bb. Stellungnahme
- b. Zur räumlichen und zeitlichen Dimension der Wirtschaftlichkeit
- aa. Einwände gegen den verfassungsrechtlichen Schutz vor langfristig unwirtschaftlichen staatlichen Maßnahmen
- bb. Stellungnahme
- cc. Folgerungen für das Verhältnis von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
- dd. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- c. Zum Konflikt zwischen rationalen und politischen Entscheidungsprozessen
- aa. Wirtschaftlichkeit als Gefahr für die Demokratie
- bb. Stellungnahme
- d. Normativer und gesetzlicher Funktionszusammenhang
- aa. Problem des Zweckregresses
- bb. Wirtschaftlichkeit und dessen rechtsdogmatische Einordnung in die Kategorien Recht- und Zweckmäßigkeit
- (1) Identität von Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
- (2) Kein Konflikt zwischen Zweck- und Rechtmäßigkeit staatlicher Entscheidungen
- (3) Das Vorrangprinzip
- (4) Wirtschaftlichkeit als subsidiäres Verfassungsrecht
- e. Eigene Auffassung: Das Wirtschaftlichkeitsgebot als vollwertiges Leitprinzip der Verfassung
- 3. Verfassungsrechtliche Herleitungen in Literatur und Rechtsprechung
- a. Die mittelbare Herleitung des Wirtschaftlichkeitsprinzips aus Art. 114 GG
- aa. Stand der rechtswissenschaftlichen Literatur
- bb. Die Rechtsprechung des rheinland-pfälzischen VerfGH
- b. Wirtschaftlichkeit als Unterfall des Verhältnismäßigkeitsprinzips
- aa. Das Urteil des nordrhein-westfälischen VerfGH
- bb. Umfang und Reichweite des Wirtschaftlichkeitsprinzips
- (1) Einwände der Literatur
- (2) Stellungnahme
- c. Wirtschaftlichkeit als Konkretisierung des Gemeinwohls
- aa. Das BGH-Urteil zu unwirtschaftlichen Leasingverträgen
- bb. Stellungnahme
- 4. Folgerung für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 423–428 III. Das haushalts- und beteiligungsrechtliche Wirtschaftlichkeitsprinzip 423–428
- 1. Beteiligungsrechtliche Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsprinzips
- 2. Der Grundsatz der Sparsamkeit als Bestandteil des Minimalprinzips
- 3. Das Verhältnis von Wirtschaftlichkeit und Qualität
- 428–437 IV. Ausgewählte Wirtschaftlichkeitsfragen im Range der Beteiligungsverwaltung 428–437
- 1. Die Negativformulierung des § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO
- 2. Das haushaltsrechtliche Finanzinteresse als übergeordnetes Beteiligungsinteresse
- a. Adressat des haushaltsrechtlichen Finanzinteresses
- b. Inhalt und Reichweite des haushaltsrechtlichen Finanzinteresses
- aa. Vereinbarkeit einer Subventionsvergabe mit dem öffentlichen Finanzinteresse
- bb. Die Anforderungen im Range der Beteiligungsverwaltung
- c. Zulässigkeit der Berücksichtigung von Fiskalinteressen
- 3. Zur Wirtschaftlichkeit öffentlicher und privater Kontrollsysteme
- 4. Zur Wirtschaftlichkeit von Privatfinanzierungen im Rahmen von IÖPPs
- a. Privatfinanzierungen contra Wirtschaftlichkeit
- b. Staatsschuldenrechtliche Behandlung von gemischtwirtschaftlichen Unternehmen
- c. Ergebnis
- 437–441 V. Rechtfertigungstatbestände für unwirtschaftliche Entscheidungen 437–441
- 1. Arbeitsmarkt- und konjunkturpolitische Erwartungen
- 2. Einkauf von Zeit
- 3. Sicherung staatlicher Autarkie
- 4. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 441–451 VI. Überprüfbarkeit des Wirtschaftlichkeitsprinzips 441–451
- 1. Der beteiligungsrechtliche Wirtschaftlichkeitsmaßstab
- a. Vorgabe des Abwägungsrahmens
- b. Erfolgskontrolle
- 2. Wirtschaftlichkeitskontrolle gem. § 65 Abs. 1 Nr. 4 BHO
- a. Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft
- b. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer
- c. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Bundesrechnungshof
- 3. Erweiterte Prüfung der Wirtschaftlichkeit gem. § 53 HGrG, §§ 66, 67 BHO
- a. Erweiterte Prüfung durch den Abschlussprüfer
- b. Erweiterte Prüfung durch den Bundesrechnungshof
- 4. Gerichtliche Überprüfbarkeit des Wirtschaftlichkeitsprinzips
- 5. Keine ökonomische Zweck-Mittel-Analyse ohne Definition von Mittel und Zweck
- 451–454 VII. Zusammenfassung zu C.: Das Wirtschaftlichkeitsprinzip 451–454
- 454–499 D. Das Subsidiaritätsprinzip 454–499
- 454–465 I. Ursprung und Kerngehalt des Subsidiaritätsprinzips 454–465
- 1. Die Väter der katholischen Soziallehre
- 2. Wurzeln des staatsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips
- 3. Anwendungsvoraussetzungen des Subsidiaritätsprinzips
- 4. Potentielle Geltungsebenen in Staat und Gesellschaft
- 5. Materieller Gehalt des Subsidiaritätsprinzips
- a. Positive Subsidiarität
- b. Negative Subsidiarität
- c. Synthese von positiver und negativer Subsidiarität
- 6. Subsidiarität als Kompetenz- bzw. Zuständigkeitsprinzip
- a. Subsidiarität als staatsorganisationsrechtliches Strukturprinzip
- b. Wirtschaftstheoretische Bestätigung des normativen Aussagegehalts des Subsidiaritätsprinzips
- 465–478 II. Subsidiarität im Gemeinschaftsrecht 465–478
- 1. Gemeinschaftsrechtlicher Anwendungsbereich und Bindungswirkung
- 2. Die Verfahrensgrundsätze gemäß Verfassungsvertrag
- 3. Die Verfahrensgrundsätze gemäß Grundlagenvertrag von Lissabon
- a. Implementierung eines gemeinschaftsrechtlichen Kompetenzkatalog
- b. Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung als besondere kompetenzrechtliche Ausprägung des gemeinschaftsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips
- c. Mitwirkung der nationalen Parlamente
- d. Nationalstaatliche Transformation der Mitwirkungsrechte des Bundestages und des Bundesrates nach Maßgabe des Integrationsveranwortungsgesetzes
- aa. Das Lissabon-Urteil des BVerfG zur Integrationsverantwortung des Bundestages gem. Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 GG
- bb. Das Integrationsverantwortungsgesetz
- (1) Zustimmungsanforderungen
- (2) Notbremsemechanismus
- (3) Ablehnungsrecht bei Vorschläge auf Grundlage der allgemeinen Brückenklausel
- (4) Subsidiaritätsrüge und Subsidiaritätsklage
- 478–483 III. Subsidiarität als Verfassungsprinzip 478–483
- 1. Historische Gründe des Fehlens einer verfassungsrechtlichen Subsidiaritätsklausel
- 2. Verfassungsrechtliche Anknüpfungspunkte
- a. Der Europa-Artikel 23 GG
- b. Freiheitsgrundrechte und Freiwilligkeitsprinzip
- c. Die Verankerung im Grundsatz der Erforderlichkeit
- 3. Ergebnis
- 483–496 IV. Der beteiligungsrechtliche Grundsatz der Subsidiarität 483–496
- 1. Inhalt und Reichweite der Formulierung „auf andere Weise“
- a. Keine Ausgliederung von bloß vorübergehenden Aufgabenerfordernissen
- b. Lebenszyklen von Unternehmen
- aa. Erste Phase: Anlauf- und Aufbau- oder Experimentierphase
- bb. Zweite Phase: Ausreif- bzw. Partizipationsphase
- cc. Dritte Phase: Konkurrenzphase
- dd. Vierte Phase: Re- bzw. Umstrukturierungsphase oder Rückbildungsphase
- ee. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- c. Kein Selbstzweck
- d. Zwischenergebnis
- 2. Rechtliche Bewertung des „Ebensogut-Falles“
- a. Art. 65 Abs. 1 Nr. 1 bayHO
- b. Vergleich mit kommunalrechtlichen Subsidiaritätsklauseln
- c. Stellungnahmen in der Literatur
- d. Eigene Auffassung
- e. Ergebnis
- 3. Subsidiarität bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmen
- 4. Begründungspflicht
- 496–499 V. Zusammenfassung zu D.: Das Subsidiaritätsprinzip 496–499
- 499–502 E. Ergebnis zu Teil 4 499–502
- 503–572 Teil 5 Europarechtliche Vorgaben der Beteiligungsverwaltung 503–572
- 503–509 A. Grundstrukturen des Gemeinschaftsrechts 503–509
- 503–507 I. Eigentumsfreiheit und Neutralitätsprinzip 503–507
- 507–507 II. Die Prinzipien der Gleichbehandlung und der Gestaltungsfreiheit 507–507
- 507–509 III. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung 507–509
- 509–556 B. Beihilferechtliche Zulässigkeit institutioneller Zuwendungen 509–556
- 509–515 I. Das Beihilfeverbot des Art. 87 Abs. 1 EGV (jetzt Art. 107 Abs. 1 AEUV) 509–515
- 1. Begünstigung bestimmter Unternehmen durch staatlich gewährte Mittel
- a. Begünstigung bestimmter Unternehmen
- b. Begünstigung durch staatlich gewährte Mittel
- aa. Wirtschaftsverwaltungsrechtlicher Subventionsbegriff
- bb. Der Begriff der Begünstigung im Sinne des Beihilferechts
- 2. Keine Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung
- 3. Potentielle Wettbewerbsverfälschung und
- 4. Potentielle Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels
- 515–550 II. Durchbrechung des Beihilfeverbots 515–550
- 1. Die Doppelfunktion des staatlichen Beteiligungsträgers
- a. Marktüblichkeit der Begünstigung
- b. Das Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers (Investortest)
- aa. Beteiligungsstruktur öffentlicher Unternehmen
- bb. Formelle Privatisierung
- cc. Indizien bei materieller Privatisierung
- c. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 2. Ausgleich gewinnmindernder Gemeinwohlverpflichtungen
- a. Die Kollisionsregel des Art. 86 Abs. 2 EGV (jetzt Art. 106 Abs. 2 AEUV)
- aa. Abgrenzung von wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Dienstleistungen
- (1) Problemaufriss
- (2) Grundlegende Einwände gegen die marktbezogene Abgrenzung
- (3) Die Gemeinschaftsrechtsprechung zu sozialen Dienstleistungen
- (4) Standpunkt des Europäischen Parlaments
- (5) Definitionsvorschlag des Europäischen Zentralverbandes der öffentlichen Wirtschaft (CEEP)
- (6) Weitere Stellungnahmen in der Literatur
- (7) Eigene Stellungnahme
- (8) Die Dienstleistungsrichtlinie
- bb. Betrauung öffentlicher Unternehmen mit Gemeinwohlaufgaben
- (1) Die Person des Betrauenden
- (2) Formelle Anforderungen an den Betrauungsakt
- (3) Das Problem der Unterbetrauung
- (4) Zur Frage der Überwachung der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung
- cc. Verhinderung der Aufgabenerfüllung
- (1) Zum Verhinderungsmaßstab
- (2) Zur Frage der Beweislast
- (3) Verhältnismäßigkeit
- b. Die Entwicklung der EuGH-Rechtsprechung zu Ausgleichzahlungen
- aa. Kompensationszahlungen für Altölbeseitigung (ADBHU)
- bb. Abgabenvergünstigungen gegenüber Pharmaherstellern (Ferring SA)
- cc. Öffentliche Zuschüsse für Verkehrsbetriebe (Altmark Trans)
- dd. Zuweisung von Hafenabgaben (Enirirsorse SpA)
- c. Der Gemeinschaftsrahmen für Ausgleichszahlungen
- d. Besonderheiten bei sog. Mischfinanzierungen
- e. Die Vorgaben der Transparenzrichtlinie
- f. Ergebnis
- 3. Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen gem. Art. 87 Abs. 2 und Abs. 3 EGV (jetzt Art. 107 Abs. 2 und Abs. 3 AEUV)
- a. Legalausnahmen gemäß Art. 87 Abs. 2 EGV (jetzt Art. 107 Abs. 2 AEUV)
- b. Ermessens-Ausnahmen gemäß Art. 87 Abs. 3 EGV (jetzt Art. 107 Abs. 3 AEUV)
- c. Spezielle Gruppenfreistellungen und Branchenförderung
- d. Beihilferechtliche Vereinbarkeit von Stabilisierungsmaßnahmen nach dem FMStG
- 550–555 III. Verfahrensrechtliche Grundzüge der Beihilfeaufsicht 550–555
- 1. Grundsatz der Anmeldung und Notifikation staatlicher Beihilfen
- 2. Rückforderung rechtswidrig gewährter oder missbräuchlich verwendeter Beihilfen
- a. Rückforderung bei fehlender Notifizierung neuer Beihilfen
- b. Abschaffung bereits bestehender Beihilfen
- 3. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 555–556 IV. Zusammenfassung zu B.: Beihilferechtliche Zulässigkeit institutioneller Zuwendungen 555–556
- 556–570 C. Beihilferechtliche Aspekte des europäischen Vergaberechts 556–570
- 556–558 I. Rechtsgrundlagen des Beihilferechts 556–558
- 558–559 II. Zulässigkeit der Teilnahme subventionierter Unternehmen am Vergabeverfahren 558–559
- 559–560 III. Berücksichtigung von nichtleistungsbezogenen Zwecken bei der Auftragsvergabe 559–560
- 560–570 IV. Indirekte Subventionierung von Unternehmen durch öffentliche Auftragsvergabe 560–570
- 1. Öffentlicher Auftraggeber
- 2. Öffentlicher (Dienstleistungs-) Auftrag
- a. Abgrenzung zu Dienstleistungskonzessionen
- b. Interne Auftragsvergabe (In-House-Vergabe)
- aa. Die Entwicklung der „Inhouse“- Rechtsprechung des EuGH
- (1) EuGH-Urteil in der Rechtssache Teckal
- (2) Reaktionen der vergaberechtlichen Literatur
- (3) Standpunkt der Europäischen Kommission
- (4) EuGH-Urteil in der Rechtssache Stadt Halle
- bb. Kritische Stellungnahmen
- cc. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- c. Auftragsvergabe und Beteiligungsveräußerung
- aa. Umgehung der Ausschreibungspflicht durch materielle Teilprivatisierung
- bb. Folgerungen für die staatliche Beteiligungsverwaltung
- 570–572 D. Ergebnis zu Teil 5 570–572
- 573–584 Teil 6 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 573–584
- 573–574 A. Rechtspolitische Implikationen der staatlichen Beteiligungsverwaltung 573–574
- 574–582 B. Das Normprogramm des § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO 574–582
- 574–577 I. Das Gemeinwohlprinzip 574–577
- 577–581 II. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip 577–581
- 581–582 III. Das Subsidiaritätsprinzip 581–582
- 582–583 C. Gemeinschaftsrechtliche Implikationen der staatlichen Beteiligungsverwaltung 582–583
- 583–584 D. Fazit und Ausblick 583–584
- 585–610 Anhang 585–610
- 585–586 Anlage 1: § 65 BHO [Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen] 585–586
- 586–587 Anlage 2: Verwaltungsvorschriften des Bundes zu § 65 BHO (VV-BHO zu § 65) 586–587
- 587–590 Anlage 3: Sonstige beteiligungsrechtlich relevante Vorschriften 587–590
- 590–593 Anlage 4: Synopse Art. 5, 16, 86, 87, 295 EGV und Art. 5 EUV, Art. 14, 107, 107 AEUV 590–593
- 593–597 Anlage 5: Fragekatalog des IDW PS 720 (Stand: 6.10.2006) 593–597
- 597–598 Anlage 6: Schaubilder zu Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Effektivität 597–598
- 598–599 Anlage 7: Auszüge aus der Enzyklika „Quadragesimo anno“ Seiner Heiligkeit Papst Pius XI. (15.05.1931) 598–599
- 599–603 Anlage 8: Privatisierung unmittelbarer Beteiligungen des Bundes (Stand: Juli 08) 599–603
- 603–610 Anlage 9: Berufungsrichtlinien des BMF zu § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO 603–610
- 610–610 Anlage 10: Auslagerung kommunaler Schulden in Schattenhaushalte 610–610
- 611–658 Literaturverzeichnis 611–658