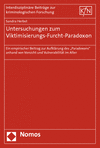Untersuchungen zum Viktimisierungs-Furcht-Paradoxon
Ein empirischer Beitrag zur Aufklärung des "Paradoxons" anhand von Vorsicht und Vulnerabilität im Alter
Zusammenfassung
Haben ältere Menschen mehr Furcht vor kriminellen Handlungen als Jüngere, obwohl das Opferrisiko im Alter sinkt? Ist die Kriminalitätsfurcht älterer Menschen damit irrational oder wird das Wohlbefinden durch die Furcht vor kriminellen Handlungen beeinträchtigt? Welche Rolle spielt der Gesundheitszustand und sind im Alter Strategien denkbar, um kriminalitätsfurchtbedingte Einschränkungen zu bewältigen?
Diesen Fragen geht die Autorin mit einer quantitativen empirischen Untersuchung nach. Es werden Ergebnisse aus einer für die Bundesrepublik Deutschland repräsentativen Opferbefragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen aus dem Jahr 2005 berichtet. Die Stichprobe umfasst 3330 Personen im Alter von 40-85 Jahren. Thematisch ist die Arbeit in den Überschneidungsgebieten der kriminologischen Forschung und der entwicklungspsychologischen Altersforschung angesiedelt.
Es wird gezeigt, dass ältere Menschen durchaus ein angemessenes Vorsichtsverhalten haben, das sich weniger an objektiven Opferdaten, sondern vielmehr an ihrer subjektiven Gesundheitseinschätzung orientiert. Gleichzeitig verfügen sie über Strategien, die Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens verhindern.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–10 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–10
- 11–12 Abkürzungsverzeichnis 11–12
- 13–15 Einleitung 13–15
- 16–28 1. Die Widersprüchlichkeit von Opferwerdung und Kriminalitätsfurcht im Alter 16–28
- 16–19 1.1 Das Risiko der Opferwerdung im Alter 16–19
- 19–25 1.2 Kriminalitätsfurcht: Darstellung des Konzeptes 19–25
- 19–23 1.2.1 Die emotionale Facette der Kriminalitätsfurcht 19–23
- 23–23 1.2.3 Die kognitive Facette der Kriminalitätsfurcht 23–23
- 23–25 1.2.3 Die behaviorale Facette der Kriminalitätsfurcht 23–25
- 25–27 1.3 Kriminalitätsfurcht im Alter: Stand der Forschung 25–27
- 27–28 1.4 Die Infragestellung des Paradoxons – ein Widerspruch im Widerspruch? 27–28
- 29–38 2. Überlegungen zur Vulnerabilität und zum Vorsichtsverhalten im Alter 29–38
- 29–33 2.1 Gesundheit im Fokus 29–33
- 33–38 2.2 Empirische Befunde zur Vulnerabilität und zur Kriminalitätsfurcht im Alter 33–38
- 39–67 3. Einschränkungen durch Vorsicht im Alter – Bewältigungsmöglichkeiten 39–67
- 39–40 3.1 Auswirkungen des Vorsichtsverhaltens 39–40
- 40–44 3.2 Resilienzkonstellationen im Alter 40–44
- 44–49 3.3 Bewältigung im Alter – Bewältigung des Alters 44–49
- 49–53 3.4 Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation 49–53
- 53–54 3.5 Theoretischer Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit 53–54
- 54–67 3.6 Hypothesen 54–67
- 68–112 4. Methodisches Vorgehen 68–112
- 68–86 4.1 Untersuchungsplanung 68–86
- 68–70 4.1.1 Erhebungsmethode/Befragungsform 68–70
- 70–85 4.1.2 Erhebungsinstrumente 70–85
- 85–86 4.1.3 Stichprobenplanung 85–86
- 86–90 4.2 Durchführung der Untersuchung 86–90
- 86–89 4.2.1 Stichprobenziehung 86–89
- 89–90 4.2.2 Interviewereinsatz 89–90
- 90–101 4.3 Beschreibung der Stichprobe 90–101
- 90–94 4.3.1 Stichprobenausschöpfung 90–94
- 94–101 4.3.2 Repräsentativität und Grundmerkmale der Stichprobe 94–101
- 101–103 4.4 Methoden der Datenauswertung 101–103
- 103–112 4.5 Psychometrische Analysen 103–112
- 103–107 4.5.1 Analysen der Skalen zu Kriminalitätsfurcht und Opfererfahrungen 103–107
- 107–111 4.5.2 Analysen der Skalen zur Gesundheit 107–111
- 111–112 4.5.3 Analysen der Skalen zur akkommodativen Flexibilität, Depressivität und zum Freizeitverhalten 111–112
- 113–136 5. Ergebnisse zum Viktimisierungs-Furcht-Paradoxon 113–136
- 113–123 5.2 Befunde zu Opfererfahrungen und Kriminalitätsfurcht im Altersvergleich 113–123
- 113–117 5.1.1 Prävalenzen von Opfererfahrungen 113–117
- 117–123 5.1.2 Kriminalitätsfurcht im Altersvergleich 117–123
- 123–136 5.2 Die Rolle gesundheitlicher Beeinträchtigungen für die Entstehung von Vorsichtsverhalten 123–136
- 123–129 5.2.1 Deskriptive Befunde zum Gesundheitszustand 123–129
- 129–130 5.2.2 Bivariate Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen Einschränkungen und dem Vorsichtsverhalten 129–130
- 130–136 5.2.3 Gesundheitliche Beeinträchtigungen als Mediator der Funktion von Alter 130–136
- 137–156 6. Ergebnisse zu Bewältigungsoptionen 137–156
- 137–147 6.1 Umgang mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Alter: Moderationsbefunde zu Akkommodation 137–147
- 137–139 6.1.1 Korrelationen zwischen den Gesundheitsindikatoren, subjektiver gesundheitlicher Beeinträchtigung und Akkommodation 137–139
- 139–142 6.1.2 Akkommodative Einflüsse auf die subjektive Gesundheitseinschätzung im Alter 139–142
- 142–147 6.1.3 Das Zusammenspiel zwischen subjektiver gesundheitlicher Beeinträchtigung, Akkommodation und Vorsichtsverhalten im Altersvergleich 142–147
- 147–153 6.2 Schutz vor Unzufriedenheit und depressiven Tendenzen: Pufferfunktionen von Akkommodation 147–153
- 147–149 6.2.1 Korrelationen zwischen Kriminalitätsfurcht, Depressivität und Akkommodation 147–149
- 149–153 6.2.2 Zur Rolle von Akkommodation bei der Bewältigung kriminalitätsfurchtbedingter Beeinträchtigungen 149–153
- 153–156 6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 153–156
- 157–171 7. Diskussion und Ausblick 157–171
- 157–165 7.1 Diskussion und Integration der wichtigsten Befunde 157–165
- 165–168 7.2 Kritische Betrachtung und Grenzen der Untersuchung 165–168
- 168–171 7.2 Konsequenzen für den Umgang mit der Furcht im Alter 168–171
- 172–176 Anhang 172–176
- 177–188 Literaturverzeichnis 177–188