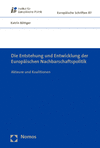Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik
Akteure und Koalitionen
Zusammenfassung
Die vorliegende Studie untersucht die Entstehung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) im Aushandlungsprozess zwischen Akteuren Brüsseler Institutionen und mitgliedstaatlichen Koalitionen unter Vermittlung der Europäischen Kommission. Hierbei zeigt sich, wie in den letzten zehn Jahren ein neues außenpolitisches Instrument der EU entstanden ist, mit welchem sie die Erweiterung und deren Erfolge zu ergänzen versucht.
Die Autorin: Dr. Katrin Böttger, geboren 1977, ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin und Lehrbeauftragte an der Universität Leipzig.
Das Institut für Europäische Politik ist ein strategischer Partner der Europäischen Kommission und wird von ihr finanziell unterstützt.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–9 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–9
- 10–10 Abbildungsverzeichnis 10–10
- 11–12 Abkürzungsverzeichnis 11–12
- 13–20 1. Einleitung 13–20
- 13–17 1.1 Forschungsstand 13–17
- 17–19 1.2 Fragestellung 17–19
- 19–20 1.3 Vorstellung der Gliederung der Analyse 19–20
- 21–41 2. Forschungsdesign 21–41
- 21–23 2.1 Politikfeldanalyse 21–23
- 23–35 2.2 Der Advocacy-Koalitionsansatz 23–35
- 23–25 2.2.1 Prämissen für den Policy-Wandel 23–25
- 25–27 2.2.2 Exogene Variablen 25–27
- 27–28 2.2.3 Das Policy-Subsystem 27–28
- 28–29 2.2.4 Advocacy-Koalitionen 28–29
- 29–31 2.2.5 Das koalitionäre belief system 29–31
- 31–32 2.2.6 Policy-Vermittler 31–32
- 32–32 2.2.7 Ressourcen und Arenen 32–32
- 32–35 2.2.8 Policy-Wandel und Policy-orientiertes Lernen 32–35
- 35–37 2.3 Präzisierung des Forschungsdesigns 35–37
- 37–41 2.4 Methodische Herangehensweise 37–41
- 37–38 2.4.1 Qualitative Einzelfallstudie 37–38
- 38–40 2.4.2 Experteninterviews 38–40
- 40–41 2.4.3 Dokumentenanalyse und verwendete Quellen 40–41
- 42–72 3. Vorgeschichte und Konstituierung des Policy-Subsystems „EU-Politik gegenüber den osteuropäischen Staaten“ 42–72
- 42–50 3.1 Die Beziehungen der osteuropäischen Staaten zur EU bis 1999: Die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen 42–50
- 42–48 3.1.1 Ukraine 42–48
- 48–49 3.1.2 Moldau 48–49
- 49–50 3.1.3 Belarus 49–50
- 50–69 3.2 Die Konstituierung des Policy-Subsystems „EU-Politik gegenüber den osteuropäischen Staaten“ 50–69
- 50–53 3.2.1 Die Reaktionen der EU-Mitgliedstaaten 50–53
- 53–54 3.2.2 Die Bewertung aus der Wissenschaft 53–54
- 54–58 3.2.3 Die polnische Position 54–58
- 58–61 3.2.4 Die Entstehung des Policy-Subsystems 58–61
- 61–62 3.2.5 Der rechtliche und formale Rahmen 61–62
- 62–69 3.2.6 Aufgreifen der Initiative durch Rat und Europäischen Rat 62–69
- 69–72 3.3 Zwischenbewertung 69–72
- 73–93 4. Etablierung des Policy-Subsystems: Aus Wider Europe wird die Europäische Nachbarschaftspolitik 73–93
- 73–77 4.1 Die Aktivitäten der MOE-Koalition 73–77
- 77–78 4.2 Die Weiterentwicklung des rechtlichen und politischen Rahmens der Politik gegenüber den Nachbarn in Verfassungsvertrag und Vertrag von Lissabon 77–78
- 78–83 4.3 Die EU-Kommission erarbeitet Aktionspläne und Finanzinstrument 78–83
- 83–86 4.4 Das Europäische Parlament und die ENP 83–86
- 86–88 4.5 Der Europäische Rat von Thessaloniki (2003) beschließt Elemente und Instrumente der Neighbours Initiative 86–88
- 88–90 4.6 Die ENP und die Konditionalität 88–90
- 90–92 4.7 Die Benennung der EU-Politik gegenüber den osteuropäischen Staaten 90–92
- 92–93 4.8 Zwischenbewertung 92–93
- 94–101 5. Implementierung und Ausdifferenzierung der ENP 94–101
- 94–122 5.1. Das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) 94–122
- 94–101 5.2 Die Ausarbeitung der Aktionspläne 94–101
- 101–106 5.3 Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und die „Orangene Revolution“ 101–106
- 106–108 5.4 Ein neuer Anlauf nach den Regenbogen-Revolutionen: Ostpolitik/ENP plus 106–108
- 108–111 5.5 Evaluation und Reformulierung 108–111
- 111–112 5.6 Verhandlungen über ein Vertieftes Abkommen mit der Ukraine als Nachfolger des PKA 111–112
- 112–116 5.7 Die Östliche Partnerschaft 112–116
- 116–120 5.8 Die Zivilgesellschaft in den Nachbarstaaten 116–120
- 120–122 5.9 Zwischenbewertung 120–122
- 123–160 6. Die Interaktion der Akteure im Policy-Subsystem: Die Advocacy-Koalitionen und der Policy-Vermittler EU-Kommission 123–160
- 123–125 6.1 Das Subsystem „EU-Politik gegenüber den osteuropäischen Staaten“ 123–125
- 125–128 6.2 Typisierung der ENP 125–128
- 125–126 6.2.1 Nominalkategorien 125–126
- 126–127 6.2.2 Wirkungskategorien 126–127
- 127–127 6.2.3 Steuerungsprinzip 127–127
- 127–128 6.2.4 Beschaffenheit der ENP 127–128
- 128–132 6.3 Die beiden Advocacy-Koalitionen 128–132
- 128–131 6.3.1 Die MOE-Koalition 128–131
- 131–132 6.3.2 Die Mittelmeer-Koalition 131–132
- 132–142 6.4 Die belief systems der beiden Koalitionen 132–142
- 132–135 6.4.1 Der Hauptkern des belief systems 132–135
- 135–139 6.4.2 Der Policy-Kern der belief systems 135–139
- 139–142 6.4.3 Die sekundären Aspekte der belief systems 139–142
- 142–149 6.5 Ergänzungen des Ansatzes 142–149
- 142–143 6.5.1 Allgemeine beliefs zur EU-Integration 142–143
- 143–149 6.5.2 Beliefs zum Selbstverständnis der EU-Außenpolitik 143–149
- 149–151 6.6 Der Policy-Vermittler: Die EU-Kommission 149–151
- 151–160 6.7 Policy-Wandel und Policy-orientiertes Lernen im Subsystem 151–160
- 151–153 6.7.1 Interaktion der Advocacy-Koalitionen in der Anfangsphase 151–153
- 153–156 6.7.2 Exogene Variablen 153–156
- Wandel in den sozioökonomischen Bedingungen
- Wandel in der öffentlichen Meinung
- Wandel in der regierenden Koalition auf Bundesebene
- Auswirkungen aus anderen Subsystemen
- 156–157 6.7.3 Koalitionsinternes Policy-Lernen 156–157
- 157–160 6.7.4 Koalitionsübergreifendes Policy-Lernen 157–160
- Intensität des Konflikts
- Analytische Nachvollziehbarkeit
- Art des Analyseforums
- 160–160 6.8 Zwischenbewertung 160–160
- 161–168 7. Zusammenfassung und Ausblick 161–168
- 161–164 7.1 Zusammenfassung 161–164
- 164–166 7.2 Bewertung der theoretischen Herangehensweise 164–166
- 166–168 7.3 Perspektiven 166–168
- 169–196 Literaturverzeichnis 169–196
- 197–200 Anhang 197–200