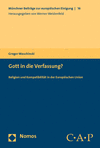Gott in die Verfassung?
Religion und Kompatibilität in der Europäischen Union
Zusammenfassung
Die Europäische Union sieht sich immer häufiger mit der „Gretchenfrage“ konfrontiert, wie es der Kontinent bei seinem Einigungsprojekt denn mit der Religion halte. Die Debatte um den Gottesbezug in der EU-Verfassung hat gezeigt, dass diese Frage auch zu ernsthaften politischen Auseinandersetzungen führen kann: die religiöse Selbstpositionierung der Gemeinschaft war einer der umstrittensten Punkte der Regierungsverhandlungen. Gregor Waschinski beschäftigt sich in diesem Band mit dem bislang wenig beachteten Verhältnis von Religion und Politik in der Europäischen Union. Er beschreibt die religionspolitische Situation in der EU und analysiert anhand der Gottesbezug-Debatte den Verlauf der religionspolitischen Konfliktlinien zwischen den Mitgliedstaaten.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–10 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–10
- 11–12 Abkürzungsverzeichnis 11–12
- 13–14 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 13–14
- 15–23 1. Einleitung 15–23
- 15–17 1.1 Forschungsstand, Theorieansatz und Forschungsfragen 15–17
- 17–18 1.2 Aufbau der Arbeit 17–18
- 18–21 1.3 Methodische Herangehensweise und Quellen 18–21
- 18–20 1.3.1 Die makro-qualitative vergleichende Methode 18–20
- 20–21 1.3.2 Qualitative Befragung 20–21
- 21–23 1.4 Religion als Thema der vergleichenden Politikwissenschaft 21–23
- 24–49 2. Religion, Politik und die Europäische Union 24–49
- 24–31 2.1 Ein säkularisierter Kontinent? 24–31
- 24–27 2.1.1 Individualisierung und Pluralisierung der Religion in Westeuropa 24–27
- 27–29 2.1.2 Ostmitteleuropa und das Erbe des Kommunismus 27–29
- 29–30 2.1.3 Südosteuropa und das orthodoxe Christentum 29–30
- 30–31 2.1.4 Der ambivalente Charakter der Eurosäkularität 30–31
- 31–43 2.2 Die mitgliedstaatliche Ebene: ein religionspolitischer Flickenteppich 31–43
- 31–35 2.2.1 Divergenz der Staat-Kirche-Beziehungen 31–35
- 35–37 2.2.2 Divergenz der Konfessionsmuster 35–37
- 37–40 2.2.3 Divergenz der Religiosität 37–40
- 40–41 2.2.4 Divergenz der religiösen Konfliktlinien 40–41
- 41–43 2.2.5 Die religionspolitische Landkarte in der Europäischen Union 41–43
- 43–49 2.3 Die supranationale Ebene: „religion matters“ 43–49
- 43–47 2.3.1 Bereiche europäischer Religionspolitik 43–47
- 2.3.1.1 Herausbildung eines europäischen Religionsrechts
- 2.3.1.2 Die religiöse Dimension des Einigungsprojektes
- 47–49 2.3.2 Religionsgemeinschaften und die Europäische Union 47–49
- 50–58 3. Die Kompatibilitätperspektive in der Europaforschung 50–58
- 50–53 3.1 Das europäische Mehrebenensystem als Forschungsfeld 50–53
- 53–58 3.2 Kompatibilitätsprobleme in Mehrebenensystemen 53–58
- 53–55 3.2.1 Kompatibilität in der Europäischen Union: Theorieansätze 53–55
- 55–58 3.2.2 Konstitutionelle Kompatibilitätsprobleme als Konfliktpotenzial 55–58
- 59–60 Zwischenergebnis: Religion als europäisches Kompatibilitätsproblem 59–60
- 61–93 4. Der Präambel-Streit: Gott in die Verfassung? 61–93
- 61–73 4.1 Der Konflikt um religiöse Bezüge in der EU-Verfassung 61–73
- 61–65 4.1.1 Religion in der Verfassung: Gott, Christentum und Kirchen 61–65
- 65–71 4.1.2 Verlauf der Auseinandersetzung 65–71
- 4.1.2.1 Verfassungskonvent
- 4.1.2.2 Regierungskonferenzen
- 71–73 4.1.3 Die Bedeutung des Präambel-Streits 71–73
- 73–90 4.2 Der Präambel-Streit als Kompatibilitätsproblem 73–90
- 73–81 4.2.1 Untersuchungsdesign 73–81
- 4.2.1.1 Untersuchungsgegenstand und -zeitraum
- 4.2.1.2 Fallauswahl
- 4.2.1.3 Operationalisierung der abhängigen Variablen
- 4.2.1.4 Operationalisierung der unabhängigen Variablen
- 81–85 4.2.3 Makro-qualitative Analyse des Präambel-Streits 81–85
- 85–88 4.2.4 Kompatibiltätsstreben der EU-Mitgliedsstaaten 85–88
- 88–90 4.2.5 Alternative Erklärungsmuster 88–90
- 4.2.5.1 Der Präambel-Streit und die Türkei-Frage
- 4.2.5.2 Der Präambel-Streit als „Machtspiel“
- 4.2.5.3 Der Präambel-Streit und parteipolitische Einflüsse
- 90–93 4.3 Religionspolitische Konfliktlinien in der Europäischen Union 90–93
- 90–92 4.3.1 Das katholische Europa: Anwalt der Religion 90–92
- 92–92 4.3.2 „Religionsskeptik“ im postprotestantischen Nordeuropa 92–92
- 92–93 4.3.3 Belgien und Frankreich: laizistische Einwände 92–93
- 94–97 5. Zusammenfassung 94–97
- 98–100 6. Ausblick: Passt „Gott“ ins Mehrebenensystem? 98–100
- 101–108 Literaturverzeichnis 101–108
- 109–112 Quellenverzeichnis 109–112
- 113–118 Anhang 113–118