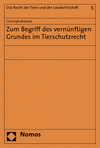Zum Begriff des vernünftigen Grundes im Tierschutzrecht
Zusammenfassung
Das Tierschutzrecht ist in Bewegung geraten, u. a. durch die verfassungsrechtliche Einbindung des Staatsziels Tierschutz in Art. 20 a GG. Das Spannungsverhältnis zwischen dem gesetzlich gewollten, umfassenden Lebens- und Wohlbefindensschutz für Tiere und dem Schutz der berechtigten Nutzungsinteressen und -ansprüchen des Menschen muss nun nach den Grundsätzen zur praktischen Konkordanz in einen möglichst schonenden Ausgleich gebracht werden. Das vorliegende Werk untersucht den Begriff des vernünftigen Grundes, der in vier Vorschriften des Tierschutzgesetzes verwendet wird. Neben dem Anwendungsbereich und der Rechtsnatur analysiert der Autor das Verhältnis des vernünftigen Grundes zu anderen gesetzlichen Bestimmungen. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass der vernünftige Grund eine Ausprägung des Güterabwägungsprinzips ist. Es reicht also nicht aus, dass mit einer tierbelastenden Handlung ein vernünftiger, berechtigter Zweck verfolgt wird; vielmehr muss zusätzlich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingehalten werden. Nutzerinteressen, die nicht hinreichend gewichtig sind, können die Beeinträchtigung von Lebens- und Wohlbefindensinteressen von Tieren nicht auf- und überwiegen. Aber auch dort, wo es um gewichtige Nutzerinteressen geht, darf nur dasjenige Mittel gewählt werden, das die Tiere am wenigsten belastet. Gründe der Arbeits-, Zeit- oder Kostenersparnis rechtfertigen es nicht, Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–30 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–30
- 31–36 Einleitung 31–36
- 37–140 Teil I: Historische Entwicklung. Rechtsnatur. Anwendungsbereich. Verhältnis zu anderen Normen und zu behördlichen Genehmigungen 37–140
- 37–53 Kapitel 1: Historische Entwicklung des Begriffes »vernünftiger Grund« 37–53
- 37–37 Übersicht 37–37
- 37–38 I Entwicklung der deutschen Tierschutz-Gesetzgebung bis 1871 37–38
- 38–39 II Tierschutz nach dem Strafgesetzbuch von 1871 38–39
- 39–40 III Reformbestrebungen zwischen 1900 und 1932 39–40
- 40–40 IV Die Strafgesetznovelle vom 26. Mai 1933 40–40
- 40–44 V Das Tierschutzgesetz vom 24. November 1933: Erstmalige Verwendung der Begriffe »unnötig« und »vernünftig«. 40–44
- 44–45 VI Der Gesetzentwurf vom 14. Dezember 1961: Festhalten an dem Begriff »unnötig« 44–45
- 45–47 VII Der Gesetzentwurf vom 22. September 1966: Erstmals Verwendung der Worte »ohne vernünftigen Grund« 45–47
- 47–51 VIII Das Tierschutzgesetz vom 24. Juli 1972: Der »vernünftige Grund« kommt ins Gesetz 47–51
- 1. »Ohne vernünftigen Grund«
- 2. Auslegungshilfen aus den Gesetzesmaterialien
- 3. Kontinuität zu »unnötig«
- 4. »Sorgfältige Güterabwägung«
- 5. Spannungsverhältnis Pathozentrik/Anthropozentrik
- 6. Forderung nach Abwägung in den Gesetzesmaterialien
- 51–51 IX Änderungsgesetze 51–51
- 51–53 Zusammenfassung und Ergebnis 51–53
- 53–65 Kapitel 2: Vernünftiger Grund als Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes? 53–65
- 53–53 Übersicht 53–53
- 53–55 I Steht der vernünftige Grund in seiner Reichweite dem Begriff »unnötig« nach? 53–55
- 1. »Unnötig« i. S. des Tierschutzgesetzes von 1933
- 2. Bedeutungswandel?
- 3. Kein Bedeutungswandel
- 55–58 II Dient der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur dem Menschen oder auch dem Tier? 55–58
- 1. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur zur Abwehr hoheitlicher Eingriffe in menschliche Freiheitsrechte?
- 2. Gesetzgeber will die Abwägung auch dort, wo sie sich zugunsten der Tiere auswirken kann
- 3. Relativer Tierschutz erfordert Kompromiss durch Abwägung
- 4. Verfassungskonforme Auslegung
- 58–60 III Auslegung nach dem Wortsinn der Begriffe »Vernunft« und »vernünftig« 58–60
- 1. Vernunft-Definitionen in der Philosophie
- 2. Ableitungen aus diesen Definitionen
- 3. Vernunft erfordert Abwägung
- 4. Verbindung von Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und (praktischer) Vernunft
- 60–62 IV Rechtsprechung 60–62
- 62–63 V Kommentarliteratur 62–63
- 63–65 Zusammenfassung und Ergebnis: 63–65
- 65–74 Kapitel 3: Tatbestandsmerkmal oder Rechtfertigungsgrund? 65–74
- 65–65 Übersicht 65–65
- 65–67 I Negativ gefasstes Tatbestandsmerkmal? Gesamttatbewertendes Merkmal? Sozialadäquanzklausel? 65–67
- 1. Negativ gefasstes Tatbestandsmerkmal?
- 2. Gesamttatbewertendes Merkmal?
- 3. Sozialadäquanzklausel?
- 4. Gegen die Annahme einer »Sozialadäquanzklausel«
- 5. Dogmatische Schwierigkeiten
- 67–70 II Rechtfertigungsgrund? 67–70
- 1. Zwecktheorie
- 2. Prinzip des überwiegenden (Gegen-)interesses
- 3. Verwandtschaft mit den Fällen des Notstands
- 4. Allgemeine Struktur einer Rechtfertigungsnorm
- 70–72 III Rechtsprechung und Literatur zur Frage »Tatbestandsmerkmal oder Rechtfertigungsgrund« 70–72
- 1. Rechtsprechung
- 2. Literatur
- 72–73 IV Geringe praktische Konsequenzen des Meinungsstreits 72–73
- 73–74 Zusammenfassung 73–74
- 74–82 Kapitel 4: Der vernünftige Grund und das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot (Art. 103 Abs. 2 GG) 74–82
- 74–74 Übersicht 74–74
- 74–75 I Bedenken 74–75
- 75–76 II Allgemein zu vagen, wertausfüllungsbedürftigen Begriffen 75–76
- 1. Vernünftiger Grund als vager, wertausfüllungsbedürftiger Begriff
- 2. Kein automatischer Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz
- 76–78 III Gibt es Gründe für die vom Gesetzgeber hier in Kauf genommene Unbestimmtheit? 76–78
- 78–81 IV Ausreichende Maßstäbe zur Konkretisierung? 78–81
- 1. Konkretisierung durch Rechtsprechung
- 2. Konkretisierung durch spezielle Ge- und Verbote
- 3. Konkretisierung anhand grundsätzlicher Wertentscheidungen des Gesetzes
- 4. Weitere Maßstäbe zur Konkretisierung
- 81–82 Zusammenfassung und Ergebnis 81–82
- 82–98 Kapitel 5: Anwendungsbereich innerhalb des Tierschutzgesetzes 82–98
- 82–82 Übersicht 82–82
- 82–83 I Tierschutzrechtliche Vorschriften, die das Merkmal »vernünftiger Grund« enthalten 82–83
- 83–88 II Genereller Vorbehalt für alle Ge- und Verbote im Tierschutzgesetz? 83–88
- 1. Ansichten
- 2. Abschließende Regelung in § 3
- 3. Abschließende Regelung auch in § 6
- 4. Kein genereller Vorbehalt bei anderen Ge- und Verboten
- 5. Verwandte Begriffe
- 88–96 III Abschließende Regelung auch in § 17 Nr. 2 b? 88–96
- 1. Wortfassung
- 2. Auslegung nach Entstehungsgeschichte, Zweck und systematischem Zusammenhang
- a) Gesetzesmaterialien
- b) Schultze-Petzold
- c) Systematischer Zusammenhang mit § 18
- d) Systematischer Zusammenhang mit § 1 Satz 2
- e) Folgenbetrachtung
- f) Zweck
- g) Staatsziel Tierschutz
- 3. Kommentare und Monographien
- 4. Rechtsprechung
- 96–98 Zusammenfassung und Ergebnis 96–98
- 98–105 Kapitel 6: Anwendungsbereich außerhalb des Tierschutzgesetzes 98–105
- 98–98 Übersicht 98–98
- 98–102 I »Ohne vernünftigen Grund« im Bundesnaturschutzgesetz 98–102
- 1. Verwendung des Begriffs »vernünftiger Grund«
- 2. Entstehungsgeschichte
- 3. Zur Auslegung des vernünftigen Grundes in § 41 Abs. 1 BNatSchG
- 4. Wesentlicher Unterschied Naturschutzrecht/Tierschutzrecht
- 102–103 II Der vernünftige Grund im Landesnaturschutzrecht 102–103
- 103–105 Zusammenfassung und Ergebnis 103–105
- 105–108 Kapitel 7 Verhältnis zu allgemeinen Rechtfertigungsgründen 105–108
- 105–105 Übersicht 105–105
- 105–106 I Verhältnis zum rechtfertigenden Notstand 105–106
- 106–106 II Verhältnis zur rechtfertigenden und mutmaßlichen Einwilligung 106–106
- 106–106 III Verhältnis zur Notwehr. 106–106
- 106–108 Zusammenfassung und Ergebnis 106–108
- 108–123 Kapitel 8 Verhältnis zu spezialgesetzlichen Regelungen 108–123
- 108–108 Übersicht 108–108
- 108–111 I Spezialgesetzliche Regelungen über Tötungen und andere tierbelastende Handlungen 108–111
- 1. Zuordnung von Tiertötungen und anderen tierbelastenden Handlungen zu spezialgesetzlich geregelten Sachbereichen
- 2. Bestimmte Regelungen/unbestimmte Regelungen
- 3. Die zwei Seiten der bestimmten spezialgesetzlichen Regelungen
- 4. »Klar ist die Grenze des Erlaubten dort, wo sie der Gesetzgeber in irgendeinem Zusammenhang selbst zieht«
- 111–113 II Beispiel: Jagdausübung 111–113
- 1. Spezialgesetzliche Regelungen des Jagdrechts
- 2. Die positive Seite dieser Regelungen für den Nutzer
- 3. Die negative Seite dieser Regelungen für den Nutzer
- 113–113 III Weiteres Beispiel: Tötung von Kormoranen 113–113
- 113–121 IV Exkurs: Die verfassungskonforme Auslegung der spezialgesetzlichen Regelungen im Licht von Art. 20 a GG. 113–121
- 1. Unbestimmte, vage Rechtsbegriffe als »Einbruchstelle« für verfassungskonforme Auslegungen
- 2. Einige Beispiele für solche »Einbruchstellen«
- 3. Konsequenzen aus dem Staatsziel »Tierschutz« für die Auslegung unbestimmter, vager Rechtsbegriffe
- 4. Konkretisierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung für den Sachbereich »Schädlingsbekämpfung«
- 5. Konkretisierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung für den Sachbereich »Jagdschutz«
- 121–123 Zusammenfassung und Ergebnis 121–123
- 123–131 Kapitel 9: Verhältnis zu behördlichen Genehmigungen 123–131
- 123–123 Übersicht 123–123
- 123–127 I Genehmigungen aufgrund von Vorschriften innerhalb des Tierschutzgesetzes 123–127
- 1. Tatbestandsausschluss oder Rechtfertigung?
- 2. Voraussetzungen für eine solche Rechtfertigung
- 3. Eingeschränkte Verwaltungsaktakzessorietät
- 4. Nebenbestimmungen
- 5. Behördliche Duldung
- 127–129 II Genehmigungen aufgrund von Vorschriften außerhalb des Tierschutzgesetzes 127–129
- 1. Objektiver Erklärungssinn des Gestattungsakts?
- 2. Keine generelle Dispositionsbefugnis der Behörden über die Rechtsgüter des Tierschutzgesetzes
- 129–131 Zusammenfassung und Ergebnis 129–131
- 131–140 Kapitel 10: Fehlen eines vernünftigen Grundes bei Anwendung gesetzwidriger Mittel? 131–140
- 131–131 Übersicht 131–131
- 131–132 I Fragestellung 131–132
- 1. Vorschriften zum »Wie« des Tötens im Tierschutzrecht
- 2. Vorschriften zum »Wie« des Tötens auf anderen Sachgebieten
- 2. Fragestellung
- 132–134 II Lösung mit Hilfe der allgemeinen Rechtfertigungsprinzipien 132–134
- 134–135 III Konsequenzen für die Anwendung des § 17 Nr. 1. 134–135
- 135–136 IV Praxis der Behörden und Gerichte 135–136
- 136–140 Zusammenfassung und Ergebnis: 136–140
- 141–204 Teil II: Zweck. Geeignetheit. Erforderlichkeit. Verhältnismäßigkeit i.e.S. 141–204
- 141–155 Kapitel 11: Zweck 141–155
- 141–142 Übersicht 141–142
- 142–143 I Nicht nur Handeln aus »negativer Schutzintention«, sondern auch aus »positiver Nutzintention«. 142–143
- 143–148 II Hauptzweck und Nebenzweck 143–148
- 1. Rechtfertigung auch durch Nebenzwecke?
- 2. Rechtfertigung nur durch den Hauptzweck
- 3. Rechtsprechung
- 4. Literatur
- 148–154 III Unzureichende Zwecke 148–154
- 1. Negative Emotionen
- 2. Rechtswidrige Motive
- 3. Sittenwidrige Motive
- 4. »Wertung, die der allgemeinen Kulturentwicklung entspricht«
- a) Befriedigung von Luxusbedürfnissen
- b) Sportliche Interessen
- c) Liebhaberei/Freizeitgestaltung
- 154–155 Zusammenfassung und Ergebnis: 154–155
- 155–163 Kapitel 12: Geeignetheit 155–163
- 155–155 Übersicht 155–155
- 155–156 I Allgemeines 155–156
- 156–158 II Beispiele für eine fehlende oder zumindest zweifelhafte Geeignetheit beim Töten von Tieren 156–158
- 1. Fehlende Zweckeignung beim Töten von Kormoranen
- 2. Fehlende Zweckeignung beim Töten von Graureihern
- 3. Fehlende Zweckeignung der Tötung von Stadttauben
- 4. Zur generellen Ungeeignetheit von Tötungen zum Zweck der Schädlingsbekämpfung
- 5. Exkurs: Zur Geeignetheit von Tierversuchen
- 158–161 III Auswirkungen von Zweifeln an der Geeignetheit auf die anderen Teilelemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung 158–161
- 1. Zweck
- 2. Erforderlichkeit
- 3. Verhältnismäßigkeit i.e.S.
- 161–163 Zusammenfassung und Ergebnis 161–163
- 163–190 Kapitel 13: Erforderlichkeit 163–190
- 163–163 Übersicht 163–163
- 163–164 I Allgemeine Prüfung 163–164
- 164–171 II Einschränkungen bei der Prüfung, ob tierschonende Handlungsalternativen zur Verfügung stehen? 164–171
- 1. Beschränkung auf Alternativen, die bereits allgemein anerkannt sind?
- 2. Pflicht zur Untersuchung aller Alternativen
- 3. Kein Rückschritt gegenüber »unnötig«
- 4. Prinzip von der praktischen Konkordanz
- 5. Keine Einschränkung des Untersuchungsgrundsatzes bei der Prüfung der Erforderlichkeit
- 6. Keine Einschätzungsprärogative zugunsten Privater
- 7. Tierschonende Alternativen
- 171–176 III Zur Ermittlung alternativer Maßnahmen oder Maßnahmenbündel, die gleich zweckeffektiv und weniger tierbelastend sind 171–176
- 1. Hauptschwierigkeit: Ermittlung alternativer Maßnahmen mit gleicher Zweckeffektivität
- 2. Beispiel: Unerlässlichkeit von Tierversuchen
- 3. Beispiel: Erforderlichkeit der Tötung von Tieren zu Ausbildungszwecken
- 4. Weitere Beispiele
- 176–179 IV Erforderlichkeit von tierbelastenden Handlungen, wenn es zwar ein gleich zweckeffektives und auch weniger tierbelastendes Mittel gibt, dafür aber höhere Aufwendungen an Zeit, Arbeit und/oder Kosten notwendig sind? 176–179
- 1. Die Ansicht Meyer-Ravensteins
- 2. Andere gesetzliche Wertung in § 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3.
- 3. Beispielsfälle für die Anwendung des allgemeinen Rechtsgedankens aus § 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3
- 4. Einschränkung?
- 179–184 V Situationen, die bereits im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung (und nicht erst bei der Verhältnismäßigkeit i.e.S.) eine Abwägung notwendig machen 179–184
- 1. Erforderlichkeit von tierbelastenden Maßnahmen, wenn es zwar eine grundsätzlich geeignete und weniger tierbelastende Alternative gibt, diese aber einen geringeren Grad an Zwecksicherheit / Zweckwahrscheinlichkeit aufweist?
- 2. Erforderlichkeit einer tierbelastenden Maßnahme, wenn es zwar eine gleich zwecksichere und weniger tierbelastende Alternative gibt, von ihrem Einsatz aber möglicherweise andere, zusätzliche Nachteile ausgehen?
- 184–187 VI Prüfungsbefugnis und Prüfungspflicht der Behörden und Gerichte 184–187
- 1. Untersuchungsgrundsatz im Verwaltungsverfahren
- 2. Untersuchungsgrundsatz im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht / Strafgericht
- 3. Generelle Beschränkung der behördlichen und gerichtlichen Prüfung?
- 4. Beschränkung der behördlichen und gerichtlichen Prüfung bei vorbehaltlosen Grundrechten?
- 5. Neue Rechtslage durch das Staatsziel Tierschutz in Art. 20 a GG
- 187–187 VII Objektive Beweislast 187–187
- 187–190 Zusammenfassung und Ergebnis 187–190
- 190–204 Kapitel 14: Verhältnismäßigkeit i. e. S. 190–204
- 190–190 Übersicht 190–190
- 190–193 I Allgemeine Prüfung 190–193
- 1. Nutzen-Schaden-Abwägung
- 2. Aufteilung in Fragen
- 3. Weshalb Abwägung?
- 4. Lösung von Prinzipienkollisionen durch Abwägung
- 5. Sinnbild der Waage
- 193–198 II Das Problem der »inkommensurablen Größen«; Hilfsmittel zu seiner Lösung 193–198
- 1. Erstes Hilfsmittel: Vollständige Zusammenstellung des Abwägungsmaterials
- 2. Zweites Hilfsmittel: Verfahrensrechtliche Regelungen
- 3. Drittes Hilfsmittel: Gesetzliche Präjudizien
- 4. Viertes Hilfsmittel: Gerichtliche Präjudizien
- 5. Fünftes Hilfsmittel: Aussagen zur christlichen Tierethik der Mitgeschöpflichkeit
- 6. Sechstes Hilfsmittel: Ethische Konzeptionen, die mit den grundsätzlichen Wertentscheidungen der Tierschutzgesetzgebung übereinstimmen
- 7. Siebentes Hilfsmittel: »Eine der allgemeinen Kulturentwicklung entsprechende Wertung«
- 198–200 III Übergewicht des Nutzens gegenüber dem Schaden. 198–200
- 1. Genügt schon die Einhaltung einer »Disproportionalitätsgrenze«?
- 2. Das menschliche Interesse am Nutzungszweck muss das tierliche Integritäts- und Wohlbefindensinteresse wesentlich überwiegen
- 3. Andere Situation als bei der gerichtlichen Überprüfung von Gesetzen und Ermessensentscheidungen
- 4. Überwiegende Meinung
- 200–204 Zusammenfassung und Ergebnis 200–204
- 205–332 Teil III Maßstäbe und Hilfsmittel für die Nutzen-Schaden-Abwägung 205–332
- 205–235 Kapitel 15: Maßstäbe aus dem Staatsziel Tierschutz, Art. 20 a GG 205–235
- 205–205 Übersicht 205–205
- 205–206 I Allgemeines zu Staatszielen 205–206
- 206–208 II Zum Unterschied von Regeln und Prinzipien. Was bedeutet die Herstellung »praktischer Konkordanz«? 206–208
- 1. Regeln und Prinzipien
- 2. Praktische Konkordanz
- 3. Vermittlung der praktischen Konkordanz durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
- 208–214 III Wesentlicher Inhalt der Staatszielbestimmung »Tierschutz« 208–214
- 1. Schutzerweiterung auf das Tier als Einzelwesen um seiner selbst willen
- 2. Drei Gewährleistungselemente
- 3. Achtungspflicht
- 4. Gewichtsverschaffende Funktion der Staatszielbestimmung
- 5. Einschränkung (auch) vorbehaltloser Grundrechte
- 6. »Überragend wichtiges Gemeinschaftsgut«
- 7. Maßgabeklausel
- 214–219 IV Grundsätze und Gebote für den Tierschutz aus Art. 20 a GG 214–219
- 1. Optimierungsgebot für den Tierschutz
- 2. Integritätsgrundsatz
- 3. Minimierungsgrundsatz
- 4. Grundsatz des zureichenden Interesses
- 5. Gebot zur Rücksichtnahme
- 6. Auftrag zum effektiven Tierschutz; mittelbare Drittwirkung
- 7. Weitere Grundsätze
- 219–224 V Konsequenzen aus diesen Grundsätzen und Geboten für die Nutzen-Schaden-Abwägung im Rahmen des vernünftigen Grundes 219–224
- 1. Höhergewichtung des Tierschutzes
- 2. Spannungsverhältnis zwischen § 1 Satz 1 und § 1 Satz 2 in neuem Licht
- 3. »Vernünftiger Grund« = »notwendiger, gewichtiger Grund«
- 4. »Vernünftiger Grund« = »zwingender Grund«?
- 5. Wirtschaftliche Gründe sind nicht ausreichend
- 6. Gründe, die bei näherem Hinsehen ebenfalls rein wirtschaftlicher Natur sind, reichen ebenfalls nicht aus
- 7. Achtungspflicht
- 224–230 VI Vorrang von EU-Recht, wenn dieses Tiertötungen oder andere Belastungen aus wirtschaftlichen Gründen vorsieht oder zulässt? 224–230
- 1. Beispiel 1: Rinder-Massentötung zur Marktbereinigung.
- 2. Beispiel 2: Tiervernichtung durch »Herodes-Prämie«
- 3. Beispiel 3: »Keulen statt Impfen« bei Maul- und Klauenseuche und Schweinepest.
- 4. Beispiel 4: Exporterstattung für lebende Rinder
- 5. Beispiel 5: Tierversuche
- 6. Beispiel 6: Tierhaltung und -schlachtung
- 230–235 Zusammenfassung und Ergebnis: 230–235
- 235–250 Kapitel 16: Maßstäbe aus gesetzlichen Wertungen 235–250
- 235–235 Übersicht 235–235
- 235–236 I Präjudizien aus dem Gesetz? 235–236
- 236–237 II Vorgehensweise, wenn ein gesetzliches Präjudiz auf einen konkreten Fall angewendet werden soll 236–237
- 237–247 III Einzelne Gesetze, denen verallgemeinerbare Vorgaben (»Maximen«) entnommen werden können 237–247
- 1. § 3 Nr. 6:
- a) Auslegung
- b) Ausformulierung einer Maxime
- c) Anwendbarkeit der Maxime über den gesetzlich geregelten Sachverhalt hinaus
- d) Verfassungskonforme Auslegung
- 2. § 5 Abs. 2 Nr. 1 erste Alt.
- a) Auslegung
- b) Ausformulierung einer Maxime
- c) Anwendbarkeit der Maxime über den gesetzlich geregelten Sachverhalt hinaus
- d) Verfassungskonforme Auslegung
- 3. § 7 Abs. 5
- a) Auslegung
- b) Ausformulierung einer Maxime
- c) Anwendbarkeit der Maxime über den gesetzlich geregelten Sachverhalt hinaus
- d) Verfassungskonforme Auslegung
- 4. § 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3
- a) Auslegung
- b) Ausformulierung einer Maxime
- c) Anwendbarkeit der Maxime über den gesetzlich geregelten Sachverhalt hinaus
- d) Verfassungskonforme Auslegung
- 5. § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 Fleischhygienegesetz (FlHG)
- a) Auslegung
- b) Ausformulierung einer Maxime
- c) Anwendbarkeit
- d) Verfassungskonforme Auslegung
- 247–250 Zusammenfassung und Ergebnis 247–250
- 250–285 Kapitel 17: Maßstäbe aus gerichtlichen Entscheidungen (Präjudizien) 250–285
- 250–250 Übersicht 250–250
- 250–251 I Präjudizien aus gerichtlichen Entscheidungen? 250–251
- 251–252 II Vorgehensweise, wenn eine von einem (Ober-)Gericht ergangene Abwägungsentscheidung auf einen anderen, ähnlich gelagerten Fall angewendet werden soll 251–252
- 252–255 III Nur relativ wenige Präjudizien im Tierschutzrecht. 252–255
- 255–279 IV Einzelne beispielgebende gerichtliche Entscheidungen (Präjudizien) 255–279
- 1. VG Gießen, Urt. v. 13. 8. 2003, NuR 2004, 64 ff. (Tierversuche)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maximen
- c) Anwendbarkeit dieser Maximen über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 2. VG Frankfurt a. M., Urt. v. 23. 5. 2001, NVwZ 2001, 1320 ff. (Tötung eines gefährlichen Hundes)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maximen
- c) Anwendbarkeit dieser Maximen über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art 20 a GG
- 3. OVG Koblenz, Urt. v. 20. 3. 2001, NuR 2001, 596 f. (Prüfung des Jagdhundes an der lebenden Ente).
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maximen
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 4. VGH Kassel, Beschl. v. 6. 11. 1996, NuR 1997, 296 ff.; OVG Schleswig, AtD 1999, 38 ff. (Prüfung des Jagdhundes an der lebenden Ente)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 5. VGH Mannheim, Urt. v. 25. 8. 2000, NVwZ-RR 2001, 380 ff. (Sanfte Tötung von Freilandrindern)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 6. Bundesverwaltungsgericht, Urt. v. 18. 1. 2000, AgrarR 2001, 59 f. (Angelzirkus)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 7. OVG Münster, Urt. v. 17. 11. 1994, NuR 1996, 362 ff. (Schnabelkürzen)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 8. AG Neunkirchen, Urt. v. 31. 1. 1994, NuR 1994, 520 f. (Schmerzzufügung wegen eines Modetrends)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 9. VG Berlin, Urteil in der Sache 1 A 6/93, AtD 1998, 48 ff. (Hunde- und Katzenhaltung in einer Tierhandlung)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 10. BayObLG, Beschl. v. 5. 5. 1993, NuR 1994, 512 f. (Tiertötung wegen angenommener Gefahr)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 11. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20. 4. 1993, NuR 1994, 517 ff. (Setzkescher-Hälterung)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 12. OLG Karlsruhe, Urt. v. 10. 5. 1990, NJW 1991, 116 f. (Tötung von Tieren, um ihnen weitere Schmerzen und Leiden zu ersparen)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 13. LG Mainz, Urt. v. 7. 10. 1985, MDR 1988, 1080 (Angeln mit lebendem Köderfisch)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 14. OLG Frankfurt/M, Beschl. v. 14. 9. 1984, NStZ 1985, 130 (Käfigbatteriehaltung von Legehennen)
- a) Sachverhalt und wesentlicher Entscheidungsinhalt
- b) Entscheidungsleitende Maxime
- c) Anwendbarkeit dieser Maxime über den konkret entschiedenen Fall hinaus
- d) Vertretbarkeit, auch im Licht von Art. 20 a GG
- 15. Weitere Entscheidungen von Strafgerichten und Staatsanwaltschaften zur Frage einer möglichen Rechtfertigung der Käfigbatteriehaltung von Legehennen (LG Düsseldorf RdL 1980, 189 ff.; AG Leverkusen AgrarR 1979, 229 f.; StA Stuttgart, Vfg. v. 20. 12. 1977, 40 Js 2312/77, zit. n. Sojka RdL 1979, 256, 257)
- 279–285 Zusammenfassung und Ergebnis 279–285
- 285–301 Kapitel 18: Konkretisierende Aussagen zur Tierethik der Mitgeschöpflichkeit als Hilfsmittel für die Abwägung? 285–301
- 285–285 Übersicht 285–285
- 285–287 I »Mitgeschöpf« / «Mitgeschöpflichkeit« 285–287
- 1. Einfügung des Begriffs »Mitgeschöpf« in das Gesetz
- 2. Erwähnung auch im Zusammenhang mit Art. 20 a GG
- 3. Zur theologischen Herkunft des Begriffs
- 4. Zur Ethik der Mitgeschöpflichkeit
- 287–289 II Aussagen zur christlichen Tierethik der Mitgeschöpflichkeit als Hilfsmittel für die Abwägung? 287–289
- 289–297 III Auszüge aus Verkündigungen, Verlautbarungen und Stellungnahmen von Kirchenleitungen, Synoden und Ausschüssen zur Ethik der Mitgeschöpflichkeit 289–297
- 1. ‚Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung’, Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh 1985
- 2. ‚Gottes Gaben – Unsere Aufgabe’, Die Erklärung von Stuttgart, Forum »Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, 20.-22. 10. 1988
- 3. ‚Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens.’ Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh 1989
- 4. ‚Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf’. Ein Diskussionsbeitrag des Wissenschaftlichen Beirats des Beauftragten für Umweltfragen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hannover 1991
- 5. ‚Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf’
- 6. ‚Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Wachsen und Weichen, Ökologie und Ökonomie, Hunger und Überfluss’. Eine Denkschrift der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für soziale Ordnung, Gütersloh 1984
- 7. Joseph Kardinal Höffner in: Weltbild 8/83
- 8. ‚Arnoldshainer Tiererklärung’ vom 7. 12. 1997
- 9. ‚Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf’
- 10. ‚Für ein Ethos der Mitgeschöpflichkeit’. Wort der Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche zum 4. 10. 1998
- 11. ‚Für ein Ethos der Mitgeschöpflichkeit’
- 12. ‚Für ein Ethos der Mitgeschöpflichkeit’
- 13. ‚Für ein Ethos der Mitgeschöpflichkeit’
- 14. ‚Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf’
- 297–301 Zusammenfassung und Ergebnis 297–301
- 301–332 Kapitel 19: Ethische Konzeptionen zum Mensch-Tier-Verhältnis als Hilfsmittel für die Abwägung? 301–332
- 301–301 Übersicht 301–301
- 301–303 I Vorgehensweise 301–303
- 303–308 II Einige grundsätzliche Wertentscheidungen, die der Tierschutzesetzgebung zugrunde liegen 303–308
- 1. Entscheidung für den pathozentrischen (ethischen) Tierschutz
- 2. Entscheidung für den Lebensschutz
- 3. Entscheidung für den Schutz des Wohlbefindens (i. S. eines Freiseins von Schmerzen und Leiden) und der Unversehrtheit (i. S. eines Freiseins von Schäden)
- 4. Entscheidung für die Anerkennung einer human-analogen Schmerz- und Leidensfähigkeit
- 5. Entscheidung für eine ausdrückliche Bezugnahme auf die christliche Tierethik der Mitgeschöpflichkeit in § 1 Satz 1
- 6. Entscheidung zur Gewaltminimierung
- 7. Entscheidung zur Güter- und Interessenabwägung
- 8. Entscheidung für einen verstärkten Schutz von Tieren, die sich in der Hand des Menschen befinden.
- 9. Wertentscheidungen im Rahmen der Staatszielbestimmung Tierschutz, Art. 20 a GG
- 308–311 III Ethische Konzeptionen, die eine Einbeziehung der Tiere in die Moral abgelehnt haben und die mit den o. e. Wertentscheidungen unvereinbar erscheinen 308–311
- 1. Platon/Aristoteles
- 2. Epikuräer/Stoiker
- 3. Einzelne frühe Kirchenlehrer
- 4. Descartes/Spinoza/Darmanson/Hobbes/Fichte
- 5. Ethischer Naturalismus und rein anthropozentrischer Humanismus
- 311–312 IV Zur Position Kants 311–312
- 1. Philosophische Position
- 2. Philosophische Kritik
- 3. Nicht anthropozentrischer, sondern pathozentrischer (ethischer) Tierschutz
- 312–319 V Ethische Konzeptionen, die direkte Pflichten des Menschen gegenüber dem Tier bejahen und mit den o. e. Wertentscheidungen vereinbar scheinen 312–319
- 1. Antike
- 2. Naturrechtliche Position
- 3. Montaigne/Tryon/Rousseau
- 4. Herder/Goethe
- 5. Jeremy Bentham
- 6. Schopenhauer
- 7. von Hartmann/Krause/Salt
- 8. Albert Schweitzer
- 9. Leonard Nelson
- 10. Karl Barth
- 319–323 VI Philosophie der Gegenwart 319–323
- 323–327 VII Ethische Grundpositionen, über die ein mehrheitlicher Wertekonsens besteht 323–327
- 1. Einbeziehung der Tiere in die Gebote der Humanität
- 2. Unteilbarkeit der Ethik
- 3. Anerkennung der Individualität und Subjektivität von Tieren
- 4. Mit der Macht des Menschen wächst auch seine Verantwortung
- 5. Ablehnung eines radikalen Speziesismus
- 6. Allenfalls Anerkennung eines milden Speziesismus
- 7. Gebot zur »Minimierung der Gewalt und Linderung des Leidens der Tiere, wo immer es geht«
- 8. Einbeziehung der Tiere in das sittengesetzliche Gebot des »neminem laede« (d. h. »schädige niemanden«)
- 9. Gebot zur Rücksichtnahme gegenüber dem Tier
- 10. Gebot zur Einnahme eines möglichst neutralen, unparteilichen Standpunktes
- 327–332 Zusammenfassung und Ergebnis 327–332
- 333–388 Teil IV: Untersuchungsgrundsatz. Beweislast. Sachverständige. Verwandte Begriffe. 333–388
- 333–344 Kapitel 20: Untersuchungsgrundsatz (Sammlung des Abwägungsmaterials) 333–344
- 333–333 Übersicht 333–333
- 333–335 I Amtsermittlungs- oder Untersuchungsgrundsatz 333–335
- 1. Gesetzliche Vorschriften
- 2. Sammlung des Abwägungsmaterials als Postulat der Vernunft und logische Voraussetzung einer jeden Abwägung
- 3. Ermittlungsverbote?
- 335–339 II Vorteils- und Nachteilsermittlung 335–339
- 1. Allgemeine Fragen
- 2. Fragen, die zur ethischen Vertretbarkeit von Tierversuchen gestellt werden sollten
- a) Nachteilsseite
- b) Vorteilsseite
- 3. Folgenberücksichtigung
- 339–342 III Einzelne Fragen im Zusammenhang mit der Sammlung des Abwägungsmaterials 339–342
- 1. Auf welche Tiere soll man abstellen?
- 2. Tod als Schaden?
- 3. Fernwirkungen?
- 342–344 Zusammenfassung und Ergebnis 342–344
- 344–364 Kapitel 21: Objektive Beweislast (Feststellungslast) 344–364
- 344–344 Übersicht 344–344
- 344–346 I Problemstellung 344–346
- 346–348 II Objektive Beweislast im Straf- und im Bußgeldverfahren 346–348
- 348–356 III Objektive Beweislast im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess 348–356
- 1. Gesichtspunkte, die es nahe legen könnten, die objektive Beweislast für das Fehlen eines vernünftigen Grundes auf Seiten der Behörde zu sehen
- a) Belastender Verwaltungsakt
- b) Normgünstigkeitsregel
- c) »In dubio pro libertate«
- d) Gesichtspunkt der Zumutbarkeit
- 2. Auslegung von § 1 Satz 2 im Hinblick auf die Frage: Wer hat die objektive Beweislast für das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines vernünftigen Grundes?
- a) Wortlaut
- b) Entstehungsgeschichte
- c) Gesetzeszweck
- d) Ergebnis
- 3. Bestätigung des aufgefundenen Ergebnisses zur objektiven Beweislast durch Rechtsprechung und Literatur
- a) Grundsatz-Ausnahme-Verhältnis
- b) Struktur des vernünftigen Grundes als Rechtfertigungsgrund
- 4. Falls dieses Ergebnis nicht akzeptiert wird: Beweislastverteilung nach der Sphärentheorie und dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit
- a) Sphärentheorie
- b) Gesichtspunkt der Zumutbarkeit
- 356–359 IV Objektive Beweislast in einigen speziellen Vorschriften des Tierschutzgesetzes 356–359
- 1. Genehmigungspflichtige Tierversuche
- 2. Genehmigungsfreie, anzeigepflichtige Tierversuche
- 3. Eingriffe und Behandlungen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
- 4. Genehmigungspflichtige Teilamputationen
- 5. Hetzen von Tieren
- 359–360 V Objektive Beweislast in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den Landesbauordnungen 359–360
- 360–364 Zusammenfassung und Ergebnis 360–364
- 364–372 Kapitel 22: Zuziehung von Sachverständigen 364–372
- 364–364 Übersicht 364–364
- 364–365 I Allgemeines 364–365
- 365–366 II Auswahl von Sachverständigen 365–366
- 1. Der richtige Gutachter für das richtige Sachgebiet
- 2. Distanz zu den beteiligten wirtschaftlichen Interessen
- 3. »Gesamte Bandbreite der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Kenntnis nehmen«
- 366–370 III Würdigung der Gutachten anhand bestimmter Fragen 366–370
- 1. Hat der Sachverständige die Anknüpfungstatsachen offengelegt und geht sein Gutachten insoweit von zutreffenden und vollständigen Tatsachen aus?
- 2. Hat der Sachverständige seine Methoden offengelegt und sind diese mit der überwiegenden Auffassung auf dem betreffenden Sachgebiet und mit den Wertentscheidungen des Gesetzes vereinbar?
- 3. Hat der Sachverständige die Prämissen, von denen er ausgeht, offengelegt, und sind auch diese mit den Wertentscheidungen des Gesetzes vereinbar?
- 4. Kann davon ausgegangen werden, dass der Sachverständige über die nötige Distanz zu den an der Fragestellung oder am Ausgang des Verfahrens möglicherweise beteiligten wirtschaftlichen Interessen verfügt?
- 5. Beschränkt sich der Sachverständige auf die Mitteilung von Befundtatsachen und Schlussfolgerungen, oder beantwortet er darüber hinaus Rechtsfragen?
- 6. Sind die Schlussfolgerungen, die der Sachverständige aus den Anknüpfungstatsachen zieht, vollständig und widerspruchsfrei? Sind die dabei angewendeten Erkenntnis- und Erfahrungssätze mitgeteilt und entsprechen sie der allgemeinen oder jedenfalls überwiegenden Auffassung auf dem jeweiligen Sachgebiet?
- 370–372 Zusammenfassung und Ergebnis 370–372
- 372–388 Kapitel 23: Begriffe, die mit dem vernünftigen Grund verwandt sein können 372–388
- 372–372 Übersicht 372–372
- 372–374 I »Vermeidbar/unvermeidbar« 372–374
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Parallelen zum vernünftigen Grund?
- 3. Unterschiede zum vernünftigen Grund
- 374–376 II »Unerlässlich« 374–376
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Parallelen zum vernünftigen Grund
- 3. Unterschiede zum vernünftigen Grund
- 376–380 III »Ethisch vertretbar« 376–380
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Parallelen zum vernünftigen Grund
- 3. Unterschiede zum vernünftigen Grund
- 380–386 IV »Angemessen« i. S. von § 2 Nr. 1 380–386
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Meint »angemessen« dasselbe wie »aus vernünftigem Grund«?
- a) Geänderte Fassung seit 1986
- b) Auslegungen in der Literatur
- c) Steht § 2 Nr. 1 unter dem Vorbehalt des vernünftigen Grundes?
- d) »Angemessen« = »unvermeidbar« = »aus vernünftigem Grund«?
- e) »Angemessen« als notwendige Ergänzung zu »artgemäß«?
- 3. Bedeutung des Legehennen-Urteils des Bundesverfassungsgerichts für das Verständnis von »angemessen«
- a) Ruhen
- b) Gleichzeitige Nahrungsaufnahme
- c) Weitere Grundbedürfnisse
- d) Allgemeines Ergebnis zur Auslegung von »angemessen«
- e) Grundlegender Unterschied von »angemessen« und »unvermeidbar«
- f) In diese Richtung weist auch der Zusammenhang von § 2 Nr. 1 TierSchG mit dem Schweizer Tierschutzrecht
- g) Unterschied von § 2 Nr. 1 und § 2 Nr. 2
- h) Auslegung von § 2 Nr. 1 im Licht von Art. 20 a GG
- 386–388 Zusammenfassung und Ergebnis 386–388
- 389–419 Gesamtzusammenfassung 389–419
- 420–432 Literatur 420–432
- 433–441 Sachverzeichnis 433–441