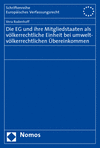Die EG und ihre Mitgliedstaaten als völkerrechtliche Einheit bei umweltvölkerrechtlichen Übereinkommen
Zusammenfassung
Aus der Außenperspektive betrachtet, gilt die EU als bedeutender „global player“. Dabei ist der Auftritt der EU bei genauer Betrachtung regelmäßig ein gemeinsames Auftreten von EG und Mitgliedstaaten. Dies manifestiert sich in rechtlicher Hinsicht in Gestalt der gemischten Abkommen. Die internationale Gemeinschaft hat die gemischten Abkommen akzeptiert. EU-intern werden sie demgegenüber bis heute skeptisch betrachtet.
Dies nimmt die Arbeit zum Anlass, um die europarechtlichen und völkerrechtlichen Voraussetzungen, Formen und Verfahren, aber auch die rechtlichen Folgen des gemeinsamen Auftretens von EG und Mitgliedstaaten exemplarisch anhand der regelmäßig gemischt abgeschlossenen, umweltvölkerrechtlichen Übereinkommen zu untersuchen.
Ergebnis der Untersuchung ist, dass EG und Mitgliedstaaten eine „völkerrechtliche Einheit“ bilden, die gemeinsam die Trägerschaft, Ausübung und Erfüllung völkerrechtlicher Rechte und Pflichten übernommen hat, welche sonst in ihrer Gesamtheit nur von einem Völkerrechtssubjekt übernommen werden. Mit der völkerrechtlichen Einheit wird so eine neue völkerrechtliche Kategorie eingeführt, die der internen Struktur des europäischen Verfassungsverbundes entspricht.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 2–16 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–16
- 17–22 Abkürzungsverzeichnis 17–22
- 23–54 Kapitel 1: Einleitung und Grundlegung 23–54
- 23–45 A Der Begriff der völkerrechtlichen Einheit 23–45
- 23–34 I. Das Völkerrechtssubjekt als Handlungseinheit der völkerrechlichen Ordnung 23–34
- 34–45 II. Die völkerrechtliche Einheit im Einzelnen 34–45
- 1. Die gemeinsame Trägerschaft, Ausübung und Erfüllung völkerrechtlicher Rechte und Pflichten
- 2. Anerkennung als Einheit
- 3. Geschlossene völkerrechtliche Vertretung
- 45–48 B Gang der Untersuchung 45–48
- 48–54 C Terminologie 48–54
- 48–52 I. Grundlegende Begriffe 48–52
- 52–54 II. Gemischte Abkommen 52–54
- 55–104 Kapitel 2: Die europäische Verfassungsordnung als Wegbereiter gemischter Abkommen 55–104
- 55–78 A Die Außenkompetenzen von EG und Mitgliedstaaten 55–78
- 55–60 I. Gemeinschaftskompetenzen - Unterteilung und Terminologiefragen 55–60
- 1. Ausschließliche Gemeinschaftskompetenzen
- 2. Nicht-ausschließliche Gemeinschaftskompetenzen
- 60–75 II. Die Außenkompetenzen der EG 60–75
- 1. Bestehen der EG-Außenkompetenzen
- a) Explizite Außenkompetenzen
- b) Implizite Außenkompetenzen
- aa) Alternative 1 („Bestehen einer Außenkompetenz im AETR-Sinne“)
- bb) Alternative 2 („Bestehen einer Außenkompetenz im Sinne des Gutachtens 1/76“)
- 2. Ausschließlichkeit der EG-Außenkompetenzen
- a) Anfängliche Ausschließlichkeit
- b) Nachträgliche Ausschließlichkeit
- aa) „Ausschließlichkeit einer Außenkompetenz im AETR-Sinne“
- bb) „Ausschließlichkeit einer Außenkompetenz im Sinne des Gutachtens 1/76“
- cc) „Einschränkung der Ausschließlichkeit im Sinne des Gutachtens 2/91“
- 75–76 III. Die Außenkompetenzen der Mitgliedstaaten 75–76
- 76–78 IV. Grundsätzliche Parallelität von Innen- und Außenkompetenzen 76–78
- 78–94 B Erforderlichkeit und Zulässigkeit gemischter Abkommen 78–94
- 78–82 I. Erforderlichkeit gemischter Abkommen 78–82
- 1. Erforderlichkeit bei eindeutiger Kompetenzverteilung
- 2. Erforderlichkeit bei unklarer Kompetenzverteilung
- 82–87 II. Zulässigkeit gemischter Abkommen 82–87
- 1. Bereiche nicht-ausschließlicher Gemeinschaftskompetenz
- 2. Bereiche ausschließlicher Gemeinschaftskompetenz
- 87–94 III. Unzulässigkeit des „alleinigen“ mitgliedstaatlichen Vertragsschlusses? 87–94
- 1. Bereiche paralleler Kompetenz
- 2. Bereiche konkurrierender Kompetenz
- 3. Ergebnis
- 94–100 C Tendenzen 94–100
- 94–95 I. Tendenzen in der Vertragsentwicklung 94–95
- 95–100 II. Tendenzen in der Rechtsprechung 95–100
- 100–101 D Fazit 100–101
- 101–104 E. Exkurs: Die Außenkompetenzen im Reformvertrag 101–104
- 101–103 I. Systematisierung der Kompetenzarten 101–103
- 103–104 II. Kompetenzgrundlagen für auswärtiges Handeln 103–104
- 105–151 Kapitel 3: EG und Mitgliedstaaten als durch die umweltpolitischen Normen verbundene Einheit 105–151
- 105–117 A Ziele und Grundsätze der Umweltpolitik 105–117
- 105–113 I. Der Grundsatz des bestmöglichen Umweltschutzes 105–113
- 1. Der Grundsatz als Auslegungsregel
- 2. Der Grundsatz als Supplementierungsregel
- 3. Der Grundsatz als Kooperationsregel
- 4. Berücksichtigung im Rahmen der Abwägung
- 113–114 II. Das Internationalitätsprinzip 113–114
- 114–116 III. Bindung von EG und Mitgliedstaaten an die umweltpolitischen Grundsätze 114–116
- 116–117 IV. Ergebnis 116–117
- 117–143 B Außenkompetenzen der EG für den Abschluss umweltvölkerrechtlicher Übereinkommen 117–143
- 117–126 I. Die „umweltpolitische“ Außenkompetenz der EG 117–126
- 1. Wahl der gemeinschaftlichen Kompetenznorm innerhalb des Umwelttitels
- 2. Umfang der Gemeinschaftskompetenz
- 3. Die implizite umweltpolitische Außenkompetenz der EG
- a) Bestehen der Außenkompetenz der EG
- b) Ausschließlichkeit der Außenkompetenz der EG
- aa) Bedeutung des Art. 176 EGV
- bb) Bedeutung des Art. 174 Abs. 4 EGV
- cc) Einschränkung der Ausschließlichkeit
- 126–140 II. Sonstige umweltschutzrelevante Kompetenzen 126–140
- 1. Vorgaben für die Kompetenzabgrenzung und Mehrfachabstützung
- 2. Abgrenzung der Kompetenzen der EG im Einzelnen
- a) Abgrenzung von der handelspolitischen Kompetenz (Art. 133 EGV)
- b) Abgrenzung der sonstigen Kompetenzen
- aa) Abgrenzung nach dem Schwerpunkt des Abkommens
- bb) Abgrenzung aufgrund einer Vorrangregelung
- 3. Abgrenzung der umweltpolitischen Kompetenz von der GASP
- a) Anwendungsbereich der GASP
- b) Abgrenzung der GASP von der gemeinschaftlichen Umweltpolitik
- 140–143 III. Anwendung des Subsidiaritätsprinzip bei umweltvölkerrechtlichen Abkommen 140–143
- 143–143 IV. Ergebnis 143–143
- 143–149 C Mitgliedstaatliche Kompetenzen zum Abschluss umweltvölkerrechtlicher Übereinkommen 143–149
- 143–146 I. Allgemeine Vorgaben 143–146
- 1. Zulässige und unzulässige Abschlusskonstellationen
- 2. Autonomiesichernde Klauseln
- 146–149 II. Der durch Art. 176 EGV geschaffene Spielraum 146–149
- 149–150 D Fazit 149–150
- 150–151 E Exkurs: Der Reformvertrag 150–151
- 152–185 Kapitel 4: Europarechtliche Ermöglichung und Notwendigkeit gemischter umweltvölkerrechtlicher Übereinkommen am Beispiel der Aarhus Konvention 152–185
- 152–159 A Die Aarhus Konvention 152–159
- 152–155 I. Zugang zu Umweltinformationen 152–155
- 155–156 III. Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltangelegenheiten 155–156
- 156–158 III. Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 156–158
- 158–159 IV. Sonstige Bestimmungen der Konvention 158–159
- 159–161 B EG und Mitgliedstaaten „auf dem Weg nach Aarhus“ 159–161
- 161–183 C Die Kompetenzverteilung für die Aarhus Konvention 161–183
- 161–180 III. Die Aarhus Konvention als „geteilt-gemischtes“ Abkommen 161–180
- 1. Kompetenzen für Umweltinformationen
- a) Kompetenzen der EG
- b) Kompetenzen der Mitgliedstaaten
- c) Abgrenzung der Kompetenzbereiche
- 2. Kompetenzen für die Beteiligung der Öffentlichkeit
- a) Kompetenzen der EG
- b) Kompetenzen der Mitgliedstaaten
- c) Abgrenzung der Kompetenzbereiche
- 3. Kompetenzen für den Zugang zu Gerichten
- a) Kompetenzen der EG
- aa) Gemeinschaftskompetenz für Art. 9 Abs. 3 AK
- bb) Gemeinschaftskompetenz für Art. 9 Abs. 4 und 5 AK
- cc) Ergebnis
- b) Kompetenzen der Mitgliedstaaten
- c) Abgrenzung der Kompetenzen
- 4. Kompetenzen für sonstige Bestimmungen der Konvention
- 5. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
- 180–181 II. Die Aarhus Konvention als „parallel-gemischtes“ Abkommen 180–181
- 181–182 III. Kompetenzen für die formellen Bestimmungen (Art. 10 bis 22 AK) 181–182
- 182–183 IV. Ergebnis 182–183
- 183–183 D Zulässigkeit des gemischten Abschlusses 183–183
- 183–185 E Fazit 183–185
- 186–256 Kapitel 5: Völkerrechtliche Ermöglichung und Anerkennung der Teilnahme von EG und Mitgliedstaaten als Einheit bei umweltvölkerrechtlichen Übereinkommen 186–256
- 186–196 A Öffnung der Übereinkommen für die EG 186–196
- 186–188 I. Nennung der EG 186–188
- 188–188 II. Öffnung für IGOs mit bestimmten Eigenschaften (IOs) 188–188
- 188–193 III. Öffnung für „Regional Economic Integration Organizations“ (REIOs) 188–193
- 1. Verwendung des REIO-Begriffs
- 2. Die einzelnen Elemente des REIO-Begriffs
- 193–194 IV. Eingrenzung der Abschlussberechtigten durch die Beteiligungsklauseln 193–194
- 194–196 V. Anerkennung von EG und Mitgliedstaaten als Einheit 194–196
- 196–218 B Sonderklauseln über die gemeinsame Teilnahme an gemischten Abkommen 196–218
- 196–198 I. Besondere Schlussbestimmungen 196–198
- 1. Besondere Klauseln für Abschluss und Kündigung
- 2. Besondere Klauseln für das Inkrafttreten
- 198–212 II. Trennungsklauseln 198–212
- 1. Allgemeine Trennungsklauseln
- 2. Besondere Trennungsklauseln
- 3. Alternativität und Flexibilität bei der Rechtsausübung und Pflichtenerfüllung
- a) Grundsatz der Alternativität der Rechtsausübung
- b) Flexibilität bei der Rechtsausübung und Pflichtenerfüllung
- c) Die Flexibilität bei der Rechtsausübung und Pflichtenerfüllung im Einzelnen
- aa) Standardisierte allgemeine Trennungsklauseln
- bb) Standardisierte besondere Trennungsklauseln
- cc) Trennungsklauseln des UN-Seerechtsübereinkommens (1982)
- 212–214 III. Besondere Stimmrechtsklauseln 212–214
- 214–215 IV. Besondere Erfüllungsklauseln 214–215
- 215–216 V. Besondere Klauseln für die Streitbeilegung 215–216
- 216–217 VI. Ermöglichung der gemeinsamen Rechtsausübung und Pflichtenerfüllung als Einheit 216–217
- 217–218 VII. Anerkennung von EG und Mitgliedstaaten als Einheit 217–218
- 218–229 C Rechtsausübung und Pflichtenerfüllung in der Praxis 218–229
- 218–221 I. Stimmrechte 218–221
- 221–223 II. Rede- und Vorschlagsrechte 221–223
- 223–224 III. Wählbarkeit in Ämter und Beteiligung in Gremien 223–224
- 224–225 IV. Materielle Übereinkommenspflichten 224–225
- 225–226 V. Berichtspflichten 225–226
- 226–228 VI. Finanzierungspflichten 226–228
- 228–229 VII. Ergebnis 228–229
- 229–255 D Ausgestaltung der Bindung und Haftung 229–255
- 229–244 I. Grundsätze der Bindung und Haftung bei gemischten Abkommen 229–244
- 1. Kompetenztheorie
- 2. Vertragskonflikttheorie
- 3. Stellungnahme
- a) Bindung
- b) Haftung
- 244–255 II. Anwendung der Grundsätze auf umweltvölkerrechtliche Übereinkommen 244–255
- 1. Übereinkommen ohne Trennungsklauseln
- 2. Übereinkommen mit allgemeinen Trennungsklauseln
- 3. Übereinkommen mit besonderen Trennungsklauseln
- 4. Die Trennungsklauseln des UN-Seerechtsübereinkommens (1982)
- a) Bindung von EG und Mitgliedstaaten
- b) Haftung von EG und Mitgliedstaaten
- 5. Ergebnis
- 255–256 E Fazit 255–256
- 257–324 Kapitel 6: Die europarechtliche Seite der einheitlichen völkerrechtlichen Vertretung von EG und Mitgliedstaaten 257–324
- 257–292 A Verhandlungen und Beteiligung bei gemischten Übereinkommen 257–292
- 257–271 I. Aushandlung von gemischten Übereinkommen 257–271
- 1. Einleitung der Verhandlungen
- 2. Erteilung der Verhandlungsermächtigung
- 3. Inhalt und Umfang der Verhandlungsermächtigung
- a) Die Verhandlungsermächtigung im engeren Sinne
- b) Verhandlungsrichtlinien
- c) Konsultation der Mitgliedstaaten
- d) Kooperationspflicht
- 4. Verhandlungsführung der EG
- a) Gemeinschaftsdelegationen
- b) Bestimmung von Standpunkten der EG
- c) Vertretung der EG bei Standpunkten und Abstimmungen
- 271–276 II. Besondere Vorgaben für die Beteiligung in IGOs und Regimen 271–276
- 1. Vorgaben für die Aufrechterhaltung der Arbeitsbeziehungen der EG
- 2. Vorgaben für die inhaltliche Beteiligung der EG
- a) Art. 300 Abs. 2 Unterabs. 2 EGV
- b) Art. 300 Abs. 4 EGV
- 276–292 III. Zusammenwirken von EG und Mitgliedstaaten 276–292
- 1. Pflicht zur engen Kooperation
- 2. Vereinbarungen über die Rechte und Pflichten von EG und Mitgliedstaaten
- 3. Koordinierung im Einzelnen
- 4. Vorgaben für die Einigung und die Vertretung von Standpunkten
- a) Bereiche ausschließlicher Gemeinschaftskompetenz
- b) Bereiche ausschließlich mitgliedstaatlicher Kompetenz
- c) Bereiche nicht-ausschließlicher Gemeinschaftskompetenz
- aa) Einigung auf einen gemeinsamen Standpunkt
- bb) Scheitern der Einigung auf einen gemeinsamen Standpunkt
- 5. Ausübung des Stimmrechts
- 6. Zusammenwirken in der Praxis
- 7. Ergebnis
- 292–312 B Abschluss gemischter Abkommen 292–312
- 292–297 I. Gemeinschaftsinternes Abschlussverfahren 292–297
- 1. Abschluss von Abkommen durch die EG
- 2. Abgabe von Kompetenzerklärungen
- 297–312 III. Gemeinsamer Abschluss durch EG und Mitgliedstaaten 297–312
- 1. Lösungswege für eine geschlossene völkerrechtliche Vertretung
- 2. Primärrechtliche Pflicht zum gemeinsamen Abschluss
- a) Meinungen in Literatur und Rechtsprechung
- b) Eigene Auffassung
- 3. Ausgestaltung der Pflicht zum gemeinsamen Abschluss
- 4. Sekundärrechtliche Pflicht zum gemeinsamen Abschluss
- 5. Der Abschluss gemischter Abkommen in der Praxis
- 6. Ergebnis
- 312–314 C Beendigung, Suspendierung und Änderung der Vertragsbindung 312–314
- 314–322 D Verbesserung der geschlossenen völkerrechtlichen Vertretung 314–322
- 314–316 I. Kodex für die Beteiligung von EG und Mitgliedstaaten bei umweltvölkerrechtlichen Übereinkommen 314–316
- 316–317 II. Kodifizierte Kooperationspflicht ergänzt durch Einzelinstrumente 316–317
- 317–322 III. Eigener Vorschlag 317–322
- 1. Kodifizierte Kooperationspflicht ergänzt durch Einzelvereinbarungen
- 2. Kodifizierung der Pflicht zum gemeinsamen Abschluss und zur gemeinsamen Beendigung, Suspendierung und Änderung von Abkommen
- 3. Regelungsvorschlag
- 322–324 E Fazit 322–324
- 325–348 Kapitel 7: Schlussfolgerungen 325–348
- 325–329 A Die völkerrechtliche Einheit von EG und Mitgliedstaaten 325–329
- 329–338 B Die völkerrechtliche Einheit in der Völkerrechtsordnung 329–338
- 338–347 C Rückschlüsse auf die Gestalt der EG/EU 338–347
- 347–348 D Der gemischte Vertragsschluss 347–348
- 349–352 Übereinkommensregister 349–352
- 353–373 Literaturverzeichnis 353–373