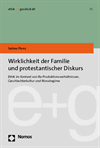Wirklichkeit der Familie und protestantischer Diskurs
Ethik im Kontext von Re-Produktionsverhältnissen, Geschlechterkultur und Moralregime
Zusammenfassung
Was macht heute die Wirklichkeit der Familie aus und wie erklärt sich ihre Vernachlässigung im protestantisch-ethischen Diskurs? Beide Fragen hängen sachlich zusammen: Sabine Plonz entwickelt einen praxis- und regimetheoretischen Begriff der Familie, der normative Aspekte einbezieht. Sie stellt dar, wie restaurativ und patriarchalisch denkende protestantische Akteure die Ideologie- und Sozialgeschichte von Wohlfahrtsstaat und Familie beeinflusst haben; und sie zeigt, wie diese Moraldiskurse den Regimewandel spiegeln. Viele Quellenzitate machen die Rekonstruktion lebendig. Überlegungen zu einer evangelischen Ethik des privaten Lebens nehmen die gewonnenen Einsichten auf.
Das Werk konfrontiert die Theologie erstmals mit hegemonie-, geschlechter- und religionskritischen Analysen ihrer Diskurse. Es ergänzt die Familien-, Wohlfahrts- und Geschlechterforschung um die Dimension des Moralregimes. So eröffnet das engagiert geschriebene Buch neue Perspektiven für Ethik und politische Praxis.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–16 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–16
- 17–20 Zur Einführung 17–20
- 21–179 A. Das Thema Familie in Theologie und Sozialforschung 21–179
- 1. Die Wirklichkeit der Familie im Diskurs des zeitgenössischen Protestantismus
- 1.1 Die Schrift Zwischen Autonomie und Angewiesenheit in der evangelischen Diskussion
- 1.1.1 Dokument im diskursiven Prozess
- 1.1.2 Zur Textgattung
- 1.1.3 Hermeneutische Achsen der Debatte
- Beziehung zwischen Recht und Moral
- Theologische Bedeutung von Institutionalität
- Bibelauslegung und Bibelausleger
- 1.1.4 Ethisches Objekt und protestantisches Subjekt im familienbezogenen Diskurs
- 1.1.5 Kirchliche Stellungnahmen im Vorfeld der Orientierungshilfe
- 1.2 Die Wirklichkeit der Familie als Thema in der gegenwärtigen theologischen Ethik
- 1.2.1 Protestantische Ansätze
- 1.2.2 Katholische Ansätze
- 1.3 Bilanz: Auf dem Weg zu einer familienbezogenen Ethik?
- 2. Die Wirklichkeit der Familie im Licht der zeitgenössischen Sozialforschung
- 2.1 Die Aufgabe der Sozialanalyse im diskurskritischen Ethik-Projekt
- 2.2 Familie in wohlfahrtsstaatlicher Forschung und Praxis
- 2.2.1 Beobachtungen zur Familienforschung
- Auf der Suche nach dem Familienbegriff in den Fachwissenschaften
- Zum ethischen Gehalt des Begriffs
- 2.2.2 Wohlfahrtsstaatlicher Kontext
- Krisenbewältigung, Vergesellschaftung, Institutionalisierung der Lebensläufe
- Zwischenfazit zur Verknüpfung zwischen wohlfahrtsstaatlicher Theorie und theologischer Ethik
- Wohlfahrtsstaat und Religion: die Frage nach dem Moralregime
- 2.2.3 Familienpolitik im wohlfahrtsstaatlichen Paradigmenwechsel
- Politische Querschnittaufgabe
- Regulierungsfunktion für Arbeitsteilung und Geschlechterbeziehungen
- Handlungsfeld zwischen politisch-ökonomischen Prozessen und normativen Orientierungen
- 2.3 Familie als soziale Praxis
- 2.3.1 Herstellungsleistung zwischen Arbeits-, Wohlfahrts- und Geschlechterregime
- Zwischenmenschliche Praxis und ökonomische Ressource
- Doppelte Entgrenzung und Bedarf an fürsorglicher Praxis
- Politisch-ethische Aufgabe im Regimewandel
- 2.3.2 Gesellschaftliche Verhältnisse oder: „Der Ort, wo alles zusammenkommt“
- Armut, Prekarisierung und Erschöpfung
- Globalisierung der Realregimes
- Migrationsgesellschaft und Dominanzkultur
- Bildung und Privatheit in der Konkurrenzgesellschaft
- Körper als Kapital in der Hightech-Ökonomie
- 2.3.3 Zwischenbesinnung
- 2.4 Familie als Feld gelebter Beziehungen
- 2.4.1 Von der Ehe zur Familie
- Abgrenzung: Ehe, Lebensformen und das Recht der Familie
- Rechtliche Vermittlung zwischen öffentlichen Normen und gesellschaftlichem Wandel
- Gleichstellungsauftrag der Familienpolitik
- 2.4.2 Von der Frau zum Mann
- Erweiterung: Väter auf dem Weg in die Familie
- Geschlecht als gesellschaftliche Strukturkategorie
- Hegemoniale Männlichkeit in der Analyse der Wirklichkeit der Familie
- 2.4.3 Merkposten für die ethische Weiterarbeit
- 2.5 Familiale Praxis im Re-Produktionszusammenhang. Zusammenfassung der sozialwissenschaftlichen Untersuchung
- 2.5.1 Rahmenbedingungen: Arbeits-, Wohlfahrts-, Geschlechter- und Moral-Regime
- 2.5.2 Ein zeitgenössisches, kontextuelles Verständnis von „Familie“ als Praxis
- 2.5.3 Folgerungen zum politisch-ethischen Charakter der familialen Praxis
- 2.5.4 Der Begriff der Familie: alltägliche, generative und soziale, fürsorgliche Praxis im Re-Produktionszusammenhang
- 2.5.5 Real-Utopischer Gehalt
- 180–459 B. Die Wirklichkeit der Familie in ihrer Geschichte: Eine Rekonstruktion der protestantischen Diskurse im 19. und 20. Jahrhundert 180–459
- 3. Aufgabe und Profil der Diskursgeschichte
- 4. Der Befund in den führenden Nachschlagewerken des Protestantismus (1855-2015)
- 4.1 Der Begriff der Familie im Kreis seiner Verwandten – eine Felderkundung
- 4.2 Von der Begriffsgeschichte zur Diskurskritik
- 4.3 Die Begriffsgeschichte der „Familie“ in den Nachschlagewerken und Handbüchern. Tabellarische Darstellung
- 5. Die Konstituierung des Moralregimes: Das 19. Jahrhundert bis zum Ende des Kaiserreichs (1850-1918)
- 5.1 Familie im 19. Jahrhundert
- 5.1.1 Zur Begriffs- und Sozialgeschichte der Familie
- Familienbegriff im Werden
- Familienformen im Umbruch
- 5.1.2 Protestantische Modernisierung des Patriarchats
- 5.2 Geschlechterverhältnisse
- 5.2.1 Frauenfrage: Das Politische wird privat
- 5.2.2 Die Natur der Geschlechter
- 5.2.3 Protestantische Ethik: Geschlecht als Beruf
- 5.3 Arbeit und Leben mit der Geschlechterdifferenz
- 5.3.1 Soziale Frage und Wandel des Arbeitsregimes
- 5.3.2 Protestantische Wohltätigkeit: Feminisierung der Reproduktionsaufgaben
- 5.3.3 Arbeitsethik der Geschlechterdifferenz
- Weibliche Erwerbsarbeit
- Männliche Erwerbsarbeit
- 5.4 Geschlechterkultur im sozialen Nationalstaat
- 5.4.1 Sozialpolitik zwischen der Konstruktion der Mutter und hegemonialer Männlichkeit
- 5.4.2 Protestantische Praxis zwischen Arbeiter- und Frauenfragen
- 5.4.3 Bevölkerungs- und Mütterlichkeitsdiskurs im Imperialismus
- 5.5 Die Ehe und der Geist der Gesetze
- 5.5.1 Moralisierung des Rechts – Institution des Moralregimes
- 5.5.2 Protestantische Geschlechtermoral: Freiheit als Unterwerfung (J. G. Fichte und sein Echo)
- 5.5.3 Das höchste Gut: Eheliche Gemeinschaft und Differenz der Geschlechter
- 5.6 Protestantischer Diskurs und Moralregime: Die Wirklichkeit der Familie in ihrer Genese
- 5.6.1 Rekapitulation
- 5.6.2 Folgen für die Ethik
- 6. Erschütterung und Reaktion: Das 20. Jahrhundert bis zur doppelten Staatsgründung (1919-1948)
- 6.1 Familiendiskurs (Rhetorik) in der Weimarer Republik
- 6.1.1 Reaktionäre Moderne: Hegemoniesicherung unter republikanischen Bedingungen
- 6.1.2 Familie als moralische Ressource in der öffentlichen Positionierung
- 6.1.3 Arbeits- und Geschlechterregime im Spiegel familienethischer Diskurse
- 6.2 Wohlfahrts- und Moralregime im Zeichen der politischen Biologie
- 6.2.1 Etablierung und Radikalisierung des bevölkerungspolitischen Paradigmas
- Politische Biologie als moralische Praxis
- Kooperation und Kollaboration im Wohlfahrtsstaat
- 6.2.2 Verantwortung und Nächstenliebe
- „Verantwortungsbewußte positive Mitarbeit“ – Ethischer Konformismus
- Christliches Ethos in der Sackgasse
- 6.3 Geschlechterordnung und Politik in der NS-Zeit
- 6.3.1 Agieren zwischen reaktionärer Mütterlichkeit und nazistischem Maskulinismus
- Die „Mutter des Volkes“ im protestantischen Diskurs
- Mütterarbeit – Arbeit der Mutter
- Volk, Blut und Boden
- Zum Geschlechter- und sozialpolitischen Profil des NS-Staates
- Herausforderung Maskulinismus – Anpassung unter Wahrung der Geschlechtseigenschaften
- Zwischenbilanz
- 6.3.2 Gegenprobe: Zum Geschlechterverhältnis bei Dietrich Bonhoeffer
- 6.3.3 Das protestantische Theorem der Geschlechterdifferenz im Moralregime der Epoche
- 6.4 Dämmerung des hegemonialen Moralregimes und einer nicht hegemonialen Ethik
- 6.4.1 Christliche Sittlichkeit als Zivilisierung der nationalsozialistischen Rassenpolitik (Reinhold Seeberg)
- 6.4.2 Ethik des natürlichen Lebens als Rechtsfolge der Menschwerdung Christi (Dietrich Bonhoeffer)
- 6.5 Moraldiskurs im politischen Raum: Die Wirklichkeit der Familie in ihrer Gefährdung
- 6.5.1 Rekapitulation
- 6.5.2 Fragen an die Nachgeschichte
- 7. Die Wirklichkeit der Familie in der Zeitschrift für Evangelische Ethik (1957-2013)
- 7.1 Gegenstand, Umfang und Methode der Untersuchung
- 7.2 Bestandsaufnahme
- 7.2.1 Chronologische Sichtung
- Die fünfziger Jahre
- Die sechziger Jahre
- Die siebziger Jahre
- Die achtziger Jahre
- Die neunziger Jahre
- Die 2000er Jahre
- Das zweite Jahrzehnt im 21. Jahrhundert
- 7.2.2 Thematische Bündelung: Ehe, Sexualität, Familie, Geschlechterforschung
- 7.3 De- und Rekonstruktion: Die Wirklichkeit der Familie im Schatten der Geschlechterordnung
- 7.3.1 Die implizite Geschlechterkonzeption
- 7.3.2 Familienpolitischer Handlungsansatz und biblisch-theologisches Schlüsseltheorem
- 7.3.3 Zwischenbilanz zur familienbezogenen (Sozial-)Ethik
- 8. Restauration und Modernisierung des Moralregimes: Die Entwicklung in der bundesrepublikanischen Epoche
- 8.1 Restauration der Ehe als Institution (Ordnung) in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts
- BRD
- DDR
- Zeitgenössische Ethik: Helmut Thielickes Versuch, die Geschlechterordnung zu zementieren (Exkurs 1)
- 8.2. Zwischen De-Konstruktion von Ehe / Familie und ihrer semantischen Sicherung als Leitbild
- BRD
- DDR
- Zeitgenössische Ethik: Hermann Ringelings Versuch, die Geschlechterordnung zu verflüssigen (Exkurs 2)
- Menschenbild und Rechtsordnung. Ein Beitrag zur Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau (Dissertation 1959)
- Die Frau zwischen gestern und morgen. Der sozialtheologische Aspekt ihrer Gleichberechtigung (1962)
- Debattenbeiträge im letzten Jahrhundertdrittel
- Auswertung und Überleitung in die Gegenwartsdiskussion
- 8.3 Die Neu-Konstruktion von Familie als Lebensform im Kontext von Pluralisierung und Privatisierung nach 1989
- Resümee
- 460–482 C. Resümee und Ausblick 460–482
- 9. Vom Begriff der Familie zur alltäglichen Praxis des privaten Lebens
- 9.1 Die Wirklichkeit der Familie in der Interaktion von Moral- und Realregimes. Rekapitulation und Ertrag des Untersuchungsgangs
- 9.2 Präliminarien zu einer Ethik des privaten Lebens
- 9.2.1 Politische Perspektive: Realutopische Transformation
- 9.2.2 Theologische Voraussetzung: die Bibel in Konflikten der Zeit lesen
- Befreiung von geschlechterhierarchischer Auslegung als Anfang egalitärer Beziehungen (Sozialkritische Bibelhermeneutik)
- Bruch mit der „Familie“ als Voraussetzung solidarisch-fürsorglicher Praxis (Zur Kritik und Transformation von Institutionalität)
- Biblische Rechts- und Liebespraxis als Inspiration für politische Erneuerung (Beziehung zwischen Recht und Moral in Geschichte und Gegenwart)
- Recht und Gerechtigkeit
- Nächstenliebe
- 483–536 Literaturverzeichnis 483–536
- 1. Evangelische Nachschlagewerke und Lexika
- 2. Literatur