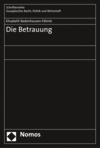Die Betrauung
Zusammenfassung
Die Betrauung von Unternehmen mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse dient der Sicherstellung von elementaren Grundbedürfnissen der Bevölkerung. Fehlt es an einer ordnungsgemäßen Betrauung, birgt dies in der Praxis mitunter Gefahren wie die Rückforderung bereits gewährter Beihilfen. Der Betrauungsbegriff ist jedoch nicht einheitlich geklärt. Erschwerend kommt hinzu, dass er in verschiedenen Normen in einem anderen Zusammenhang verwendet wird. In der Praxis hat dies zu einer gewissen „Begriffsverwirrung“ und zu Anwendungsschwierigkeiten beigetragen. Die Studie erforscht ausgehend von dem Standort der Betrauung in Art. 106 Abs. 2 AEUV den Ursprung der Begrifflichkeit, dessen Auslegung und Anwendung durch die europäischen Institutionen sowie dessen Verwendung im nationalen Recht und stellt eigene Betrauungsanforderungen auf, welche zu einer Lösung der „scheinbaren“ Problematik beitragen.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–20 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–20
- 21–24 A. Einleitung 21–24
- 25–274 B. Begriffsbestimmung durch Auslegung der Verträge 25–274
- I. Besonderheiten bei der Begriffsbestimmung
- 1. Dynamische Auslegung
- 2. Effet utile
- 3. Die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips
- 4. Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs und Gang der Untersuchung
- II. Standort des Betrauungsbegriffs auf europäischer Ebene
- 1. Art. 106 Abs. 2 AEUV als Standort des Betrauungsbegriffs
- a) Das Verhältnis von Art. 106 Abs. 1 AEUV zu Art. 106 Abs. 2 AEUV
- b) Bedeutung und Tragweite des Art. 106 Abs. 1 AEUV
- c) Bedeutung und Tragweite des Art. 106 Abs. 2 AEUV
- d) Die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen
- aa) Unternehmen
- bb) Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
- cc) Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Bestimmung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
- dd) Übertragung einer besonderen Aufgabe
- ee) Verhinderung der Aufgabenerfüllung
- ff) Beeinträchtigung der Entwicklung des Handelsverkehrs
- gg) Rechtsfolge
- e) Unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 106 Abs. 1 und 2 AEUV
- 2. Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- III. Historie
- 1. Mitgliedstaatliche Vorbilder als Ursprung des Betrauungsbegriffs?
- a) Frankreich
- aa) Geschichtliche Entwicklung und Bedeutung des service public
- bb) Der Begriff des service public
- cc) Die Funktionen des service public
- (1) Der service public als Staatstheorie
- (2) Der service public als Abgrenzungskriterium der Gerichtsbarkeiten
- (3) Der service public als materielle Aufgabe der Verwaltung zur Befriedigung der Bedürfnisse in der Bevölkerung
- dd) Organisation des service public
- (1) Erbringung des service public in öffentlich-rechtlicher Form
- (a) La régie
- (b) Les établissements publics
- (c) La collaboration organique entre collectivités
- (2) Erbringung des service in privatrechtlicher Form
- (a) La concession
- (b) L‘affermage
- (c) La régie intéressée
- (d) La gérance
- (3) Zusammenfassung
- ee) Der Begriff „chargé“ als Vorbild für den (europäischen) Betrauungsbegriff?
- b) Italien
- c) Niederlande
- d) Belgien
- e) Luxemburg
- f) Deutschland
- aa) Forsthoffs Lehre von der Daseinsvorsorge
- (1) Der Begriff der Daseinsvorsorge
- (2) Die Funktion der Daseinsvorsorge bei Forsthoff
- (3) Organisation der Daseinsvorsorge
- bb) Die Indienstnahme von Unternehmen mit Leistungen der Daseinsvorsorge als Vorbild für den europäischen Betrauungsbegriff?
- cc) Zusammenfassung
- g) Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- 2. Historischer Kontext des Art. 106 Abs. 2 AEUV
- a) Die Wirtschaftskonzeptionen der Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Gründungsverträge
- aa) Frankreich und Italien
- bb) Deutschland, Niederlande, Belgien
- b) Das Wirtschaftskonzept der Verträge von Rom
- c) Der Betrauungsbegriff des Art. 106 AEUV als offener Formelkompromiss
- 3. Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- IV. Wortlaut des Art. 106 Abs. 2 AEUV
- 1. Verschiedene Wortlaute während der Verhandlungen zu den Gründungsverträgen
- 2. Vergleich mit den unterschiedlichen Sprachfassungen
- a) Französisch
- b) Niederländisch
- c) Italienisch
- 3. Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- V. Telos und Systematik des Art. 106 Abs. 2 AEUV
- 1. Art. 106 AEUV als Teil des europäischen Wettbewerbs- und Wirtschaftsmodells
- a) Das Wettbewerbs- und Wirtschaftsmodell nach dem EWG-Vertrag und der Einheitlichen Europäischen Akte
- b) Das Wettbewerbs- und Wirtschaftsmodell nach Maastricht
- c) Das Wettbewerbs- und Wirtschaftsmodell nach Lissabon
- d) Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- 2. Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten nach Art. 345 AEUV im Rahmen des europäischen Wirtschaftsmodells und als eine Art Vorstufe zu Art. 106 Abs. 2 AEUV
- a) Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund
- b) Bedeutung und Tragweite
- c) Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- 3. Art. 106 Abs. 2 AEUV und die soziale Dimension der Verträge
- a) Art. 14 AEUV
- aa) Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund
- bb) Bedeutung und Tragweite
- cc) Gewährleistungsgehalt
- (1) Art. 14 S. 1 AEUV als Gestaltungsauftrag
- (2) Art. 14 S. 1 AEUV als Abwägungsbelang
- dd) Einfluss auf die Auslegung des Art. 106 Abs. 2 AEUV
- ee) Einfluss auf den Betrauungsbegriff
- ff) Kompetenzerweiterung nach Lissabon, Art. 14 S. 2 AEUV
- (1) Bedeutung und Gewährleistungsgehalt
- (2) Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- gg) Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- b) Protokoll Nr. 26
- aa) Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund
- bb) Bedeutung und Tragweite
- cc) Gewährleistungsgehalt
- (1) Ermessensspielraum
- (2) Vielfältigkeit der Dienste
- (3) Qualitäts- und Zugangssicherung der Dienste
- dd) Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- c) Art. 36 GRCh
- aa) Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund
- bb) Gewährleistungsgehalt
- (1) Funktion
- (2) Tatbestandsmerkmale
- cc) Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- d) Art. 3 Abs. 3 EUV Ziel einer wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft und Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts
- aa) Gewährleistungsgehalt
- bb) Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- VI. Ergebnis
- 275–358 C. Der Betrauungsbegriff in der Auslegung der Europäischen Gerichte 275–358
- I. Die Rechtsprechung des EuGH
- 1. Erste Phase der Auslegung: Vor Erlass der Einheitlichen Europäischen Akte (1971 – 1986)
- a) Auslegung des Art. 90 Abs. 2 EWGV (Art. 106 Abs. 2 AEUV)
- b) Betrauungsanforderungen
- c) Betrauungsform
- 2. Zweite Phase der Auslegung: Ab Erlass der Einheitlichen Europäischen Akte bis zum Vertrag von Maastricht (1986 – 1992)
- a) Auslegung des Art. 90 Abs. 2 EWGV (Art. 106 Abs. 2 AEUV)
- b) Betrauungsanforderungen
- c) Betrauungsform
- 3. Dritte Phase der Auslegung: Die Einleitung der Trendwende durch das Corbeau-Urteil und die Urteile zu den Energiemonopolen (1993 – 2001)
- a) Auslegung des Art. 90 EWGV (Art. 86 EGV; Art. 106 Abs. 2 AEUV)
- b) Betrauungsanforderungen
- c) Betrauungsform
- 4. Vierte Phase der Auslegung: Verfestigung der großzügigen Auslegung des Art. 106 Abs. 2 AEUV durch den EuGH (1999 – 2001)
- a) Auslegung des Art. 86 EGV (Art. 106 Abs. 2 AEUV)
- b) Betrauungsanforderungen
- c) Betrauungsform
- 5. Fünfte Phase der Auslegung: Einleiten einer Trendwende mit dem Urteil Ferring (2001 – 2009)
- a) Auslegung des Art. 86 EG (Art. 106 Abs. 2 AEUV) und Anwendung der Altmark Trans-Kriterien
- b) Betrauungsanforderungen
- c) Betrauungsform
- 6. Sechste Phase der Auslegung: Verstärkung der Daseinsvorsorge durch Lissabon (2009 – heute)
- a) Auslegung des Art. 106 Abs. 2 AEUV und Anwendung der Altmark Trans-Kriterien
- b) Betrauungsanforderungen
- c) Betrauungsform
- II. Die Rechtsprechung des EuG
- 1. Auslegung des Art. 106 Abs. 2 AEUV und Anwendung der Altmark Trans-Kriterien
- 2. Betrauungsanforderungen
- 3. Betrauungsform
- III. Ergebnis
- 1. Entwicklung der Auslegung des Art. 106 Abs. 2 AEUV und der Altmark Trans-Kriterien
- 2. Betrauungsanforderungen
- 3. Betrauungsform
- 359–468 D. Der Betrauungsbegriff in der europäischen Praxis: Vorgaben durch die Kommission sowie ausgewähltes sekundär- und tertiärrechtliches Vorkommen 359–468
- I. Befugnisse der Kommission
- 1. Wächterin der Einhaltung der Beihilfevorschriften, Art. 108 AEUV
- a) Notifizierungspflicht
- aa) Grundsätzliche Anmeldung bei Vorliegen einer Beihilfe
- bb) Durchführungsverbot nach Art. 108 Abs. 3 AEUV
- b) Legalausnahmen
- aa) Art. 107 Abs. 2 AEUV
- bb) Art. 107 Abs. 3 AEUV
- c) Erlass von Verordnungen nach Art. 108 Abs. 4 AEUV
- d) Rückforderung von rechtswidrigen Beihilfen
- 2. Gestaltungsbefugnisse im Rahmen der europäischen Wirtschaftspolitik
- 3. Bindungswirkung der von der Kommission erlassenen Regelungsgegenstände
- 4. Entwicklung der Regelungsansätze der Kommission
- II. „Interpretation“ der Beihilfevorschriften durch die Kommission
- 1. Die Bedeutung von Binnenmarkt und Wettbewerb bei der Gewährleistung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
- 2. Die Bedeutung der Anerkennung des mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielraums bei der Bestimmung und Organisation von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse als Grenze der Interpret...
- a) Das Vorliegen von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nach der Kommission
- b) Die Anerkennung des mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielraums bei der Bestimmung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
- 3. Zusammenfassung und Auswirkungen auf die Auslegung des Betrauungsbegriffs
- III. Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch die Gewährung von Ausgleichsleistungen
- 1. Überblick über die Maßnahmepakete
- a) Monti-Kroes-Paket
- b) Alumnia-Paket
- 2. Betrauungsanforderungen
- a) Kontextuelle Erwähnung und Konkretisierung des Betrauungsbegriffs
- aa) Alumnia-Paket
- bb) Vergleich des Alumnia-Pakets mit dem Monti-Kroes-Paket
- cc) Leitfaden über die Anwendung der Beihilfevorschriften auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
- b) Zusammenfassung der notwendigen Betrauungsanforderungen
- aa) „Öffentlicher Auftrag“
- bb) Notwendiger Betrauungsinhalt
- (1) Gegenstand und Dauer der Verpflichtung
- (2) Benennung des betreffenden Unternehmens und gegebenenfalls des Gebiets
- (3) Art und Dauer der dem Unternehmen gewährten ausschließlichen oder besonderen Rechte
- (4) Festlegung der Parameter für die Berechnung, Änderung und Überwachung der Ausgleichsleistung
- (5) Maßnahmen zur Vermeidung der Rückforderung von Überkompensationszahlungen
- (6) Vorliegen eines Hoheitsakts
- cc) Betrauungsform
- dd) Festlegung von Anreizkriterien
- ee) Auswahl des Betrauungsempfängers
- ff) Funktion der Betrauung
- 3. Ergebnis und Verwendung des Betrauungsbegriffs in den verschiedenen Sprachfassungen
- IV. Sonstige sekundärrechtliche Verwendung des Betrauungsbegriffs
- 1. Der Betrauungsbegriff im Vergaberecht
- a) Die Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU
- aa) Kontextuelle Erwähnung
- bb) Vergleich der verschiedenen Sprachfassungen
- cc) Untersuchung der Verfahrensmaterialien
- dd) Ergebnis und Stellungnahme
- b) Die Richtlinie 2014/23/EU
- aa) Kontextuelle Erwähnung
- bb) Vergleich der verschiedenen Sprachfassungen
- cc) Untersuchung der Verfahrensmaterialien
- dd) Ergebnis und Stellungnahme
- 2. Der Betrauungsbegriff in der Verordnung 1370/2007/EG
- a) Kontextuelle Erwähnung
- b) Vergleich der verschiedenen Sprachfassungen
- c) Untersuchung der Verfahrensmaterialien
- d) Ergebnis und Stellungnahme
- 3. Ergebnis
- 469–478 E. Zusammenfassung zur Auslegung des Betrauungsbegriffs und eigener Lösungsvorschlag 469–478
- 479–584 F. Die Betrauung im deutschen Recht 479–584
- I. Mögliche Rechtsformen des Betrauungsakts
- 1. Verwaltungsakt
- 2. Gesetz/Rechtssatz
- a) Verwendung des Betrauungsbegriffs jenseits von Daseinsvorsorgeleistungen
- aa) Betrauung durch das Handelsgesetzbuch (HGB)
- bb) Betrauung durch das Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- b) Verwendung des Betrauungsbegriffs im Zusammenhang mit Daseinsvorsorgeleistungen
- aa) Betrauung durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- (1) § 20 KrWG
- (2) § 22 KrWG
- bb) Betrauung durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- cc) Betrauung durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- (1) § 30 Abs. 2a GWB
- (2) § 105 GWB
- (3) § 108 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 GWB
- c) Ergebnis
- 3. Öffentlich-rechtlicher Vertrag
- 4. Öffentlich-rechtlicher Konzessionsvertrag
- 5. Privatrechtlicher Vertrag
- 6. Erlaubnis/Genehmigung
- 7. Ratsmodell/Gesellschaftsrechtliches Modell
- 8. Gründungsakt/Satzung
- a) Regiebetriebe
- b) Eigenbetriebe
- c) Anstalt des öffentlichen Rechts
- d) Möglichkeiten einer Betrauung
- aa) Regiebetriebe
- bb) Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
- cc) Exkurs: Unternehmen in Privatrechtsform
- 9. Beleihung
- II. Der Betrauungsakt in der Praxis ausgewählter Universaldienstsektoren: Europäische Vorgaben und deren Umsetzung im deutschen Recht
- 1. Telekommunikationsrecht
- a) Auslegung des Art. 106 Abs. 2 AEUV
- b) Betrauungsanforderungen
- aa) Europarechtliche Vorgaben
- bb) Umsetzung im nationalen Recht
- (1) Betrauung durch das Telekommunikationsgesetz (TKG)
- (2) Die Verpflichtung zur Erbringung einer Universaldienstleistung nach § 78 Abs. 2 TKG i.V.m. § 81 TKG als Betrauung?
- c) Betrauungsform
- d) Ergebnis
- 2. Rundfunk
- a) Auslegung von Art. 106 Abs. 2 AEUV
- b) Betrauungsanforderungen
- aa) Europarechtliche Vorgaben
- bb) Gestaltungsspielraum
- cc) Betrauung durch den Rundfunkstaatsvertrag (RStV)
- c) Betrauungsform
- d) Ergebnis
- 3. Post
- a) Auslegung des Art. 106 Abs. 2 AEUV
- b) Betrauungsanforderungen
- aa) Europarechtliche Vorgaben
- bb) Umsetzung im nationalen Recht
- (1) Betrauung durch das Postgesetz (PostG)
- (2) Auferlegung der Verpflichtungen
- c) Betrauungsform
- d) Ergebnis
- 4. Energie
- a) Auslegung von Art. 106 Abs. 2 AEUV
- b) Betrauungsanforderungen
- aa) Europarechtliche Vorgaben
- bb) Umsetzung im nationalen Recht
- (1) Betrauung auf Grund der Regelung einer Anschlusspflicht nach § 10 EnWG 1998
- (2) Betrauung auf Grund der Regelung einer Grundversorgungspflicht nach § 36 Abs. 2 S. 2 EnWG (2005)
- c) Betrauungsform
- d) Ergebnis
- 5. Verkehr
- a) Art. 93 AEUV als Sondervorschrift
- b) Inhaltliche Anforderungen an den Betrauungsbegriff
- aa) Europarechtliche Vorgaben
- bb) Umsetzung im nationalen Recht
- c) Betrauungsform
- d) Ergebnis
- 6. Ergebnis
- III. Der Betrauungsakt in der Kommunalen Praxis
- 1. Beihilfepolitik der Kommunen
- 2. Risiken bei fehlendem Betrauungsakt
- 3. Die steuerrechtliche Bedeutung der Betrauung
- 4. Die Bedeutung der Betrauung in der Bilanz der Unternehmen
- 5. Gemeindeordnungen
- 6. Ergebnis
- 585–592 G. Abschließende Bewertung und Thesen 585–592
- 593–626 Literaturverzeichnis 593–626