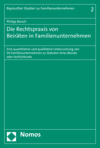Die Rechtspraxis von Beiräten in Familienunternehmen
Eine quantitative und qualitative Untersuchung von 34 Familienunternehmen zu Statuten ihres Beirats oder Aufsichtsrats
Zusammenfassung
Der Beirat ist Produkt gesellschaftsvertraglicher Gestaltungsfreiheit, gleich ob er berät oder auch aufsichtsratsähnlich die Geschäftsführung kontrolliert. Da es keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften für Beiräte in Familienunternehmen gibt, sind die Erscheinungsformen sehr heterogen. Daraus ergibt sich das Bedürfnis, sich mit Beiräten in Familienunternehmen zu befassen. Denn in der Rechtswissenschaft kaum behandelt ist die Verfassung des Beirats in der Praxis. Wie nutzen Familienunternehmen in ihrer Rechtswirklichkeit die Gestaltungsfreiheit? Anknüpfend an die Distanz zwischen wissenschaftstheoretischer Auseinandersetzung und praktischer Verwirklichung wird das rechtlich-organisatorische Konzept der Beiräte von 34 Familienunternehmen anhand von über 40 Kriterien untersucht; die Befunde werden abgebildet und analysiert. Weiterführend werden ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung in anschließenden Interviews durch Experten bewertet. Das besondere Vorgehen macht die Arbeit für die Wissenschaft wie auch die Praxis gleichermaßen relevant.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–28 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–28
- 29–33 1. Kapitel Einleitung 29–33
- 33–59 2. Kapitel Gang der Untersuchung 33–59
- A. Aufbau der Arbeit
- B. Der Beirat von Familienunternehmen als Forschungsgegenstand
- I. Beirat
- 1. Definition
- 2. Ausgrenzung – was ist nicht erfasst?
- 3. Beirat und Aufsichtsrat – das Gleiche?
- 4. Zusammenfassung
- 5. Praxisbedeutung
- II. Familienunternehmen
- 1. Definition
- 2. Bedeutungsdimensionen
- C. Forschungsmethodik
- I. Dokumentenanalyse
- 1. Das Ausgangsmaterial
- a) Bestimmung des Ausgangsmaterials
- b) Die Materialbeschaffung
- c) Untersuchungskriterien
- 2. Die Quellenkritik
- II. Zusammenfassung
- III. Experteninterviews
- IV. Kritische Einschränkung
- 59–71 3. Kapitel Der Beirat als gesellschaftsrechtliches Institut 59–71
- A. Errichtungsmotive und Funktionen
- B. Konstituierung
- 1. Ungeregelte (faktische) Tätigkeit
- 2. Schuldrechtlicher Beirat
- 3. Statutarischer Beirat
- a) Gesetzliches Leitbild
- b) Abwandlung des gesetzlichen Leitbilds
- 4. Sonderfall: Der repräsentierende Beirat
- a) Gesamtorgan
- b) Gesamtvertretung oder Gruppenorgan
- c) Auswirkung auf die Untersuchung
- 5. Ermächtigung oder verbindliche Errichtung
- 6. Zusammenfassung
- 71–91 4. Kapitel Die Untersuchungsgruppe 71–91
- A. Charakterisierung der Probanden
- I. Rechtsform
- II. Unternehmensdaten
- 1. Branche
- 2. Beschäftigtenzahlen
- 3. Umsatz
- B. Das Untersuchungsmaterial
- I. Urheber der Beiratsverfassung
- II. Adressaten der Beiratsverfassung
- III. Regelungsbedarf der Beiratsverfassung
- 1. Gründe für Regelungsnotwendigkeit
- a) Gesellschaftsrechtliche Gründe
- b) Kautelarjuristische Gründe
- c) Sonstige Gründe
- 2. Gründe gegen eine hohe Regelungsdichte
- 3. Zwischenergebnis
- IV. Auffälligkeiten der Gestaltungstechnik der Beiratsverfassung
- 91–261 5. Kapitel Befund und Analyse der Dokumente 91–261
- 91–254 A. Inhalt der untersuchten Dokumente 91–254
- 91–94 I. Bezeichnung des freiwilligen Gremiums 91–94
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 94–97 II. Anzahl der Mitglieder 94–97
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 97–101 III. Angabe von Auswahlkriterien 97–101
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 101–105 IV. Angabe von Ausschlussgründen 101–105
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 105–108 V. Familienzugehörigkeit 105–108
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 108–113 VI. Art der Bestellung 108–113
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 113–116 VII. Stimmverhältnisse für Wahl der Beiratsmitglieder 113–116
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 116–119 VIII. Amtszeit 116–119
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 119–122 IX. Minimum der Sitzungsfrequenz 119–122
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 122–128 X. Ausschluss von § 52 GmbHG 122–128
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 4. Zwischenergebnis:
- 128–132 XI. Hauptaufgaben des Beirats 128–132
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 132–137 XII. Beteiligung am Jahresabschluss 132–137
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 137–140 XIII. Weisungsbefugnis gegenüber Geschäftsführung 137–140
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 140–145 XIV. Informationsrecht 140–145
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 145–149 XV. Berechtigter des Informationsrechts 145–149
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 149–152 XVI. Informationszuständigkeit 149–152
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 152–156 XVII. Informationsgegenstand 152–156
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 156–160 XVIII. Frequenz der Informationsbeschaffung 156–160
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 160–163 XIX. Zwischenergebnis: Informationsrechte 160–163
- 163–168 XX. Berichtspflichten gegenüber dem Beirat 163–168
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 168–171 XXI. Berichtsgläubiger 168–171
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 171–172 XXII. Berichtszuständigkeit 171–172
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 172–174 XXIII. Berichtsgegenstand 172–174
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 174–177 XXIV. Berichtsfrequenz 174–177
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 177–179 XXV. Berichtsperspektive 177–179
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 179–182 XXVI. Regelungsort der Berichtspflicht 179–182
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 182–183 XXVII. Zwischenergebnis: Berichtspflichten 182–183
- 183–185 XXVIII. Widerspruchsrecht nach § 164 S. 1 HGB 183–185
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 185–188 XXIX. Beteiligungsgeschäfte 185–188
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 188–192 XXX. Art der Beteiligung bei Vorbehaltsgeschäften 188–192
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 192–196 XXXI. Regelungsort der Beteiligungsgeschäfte 192–196
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 196–204 XXXII. Typen der Beteiligungsgeschäfte 196–204
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 204–207 XXXIII. Beteiligung an strategischer Unternehmensplanung 204–207
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 207–209 XXXIV. Zwischenergebnis Beteiligungsgeschäfte 207–209
- 209–212 XXXV. Rechte in anderen Organen 209–212
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 212–215 XXXVI. Berichtspflicht des Beirats gegenüber der Gesellschafterversammlung 212–215
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 215–224 XXXVII. Haftungserleichterungen 215–224
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- a) Grundlage
- b) Verschuldensmaßstab
- c) Begrenzung auf Höchstbetrag
- d) Verkürzung der Verjährung
- e) Entlastung
- f) Zwischenergebnis
- 224–228 XXXVIII. Vergütung 224–228
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 228–231 XXXIX. Teilnahmerechte Dritter an Beiratssitzungen 228–231
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 231–235 XL. Kompetenzverhältnis zur Gesellschafterversammlung 231–235
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 235–243 XLI. Beschlussdurchbrechung durch Gesellschafterversammlung 235–243
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 243–246 XLII. Kompetenzregelung zur Funktionsunfähigkeit des Beirats 243–246
- 1. Untersuchungskriterium
- 2. Befund
- 3. Analyse
- 246–252 XLIII. Die Beiratsordnung 246–252
- 1. Erlasskompetenz
- 2. Regelungsgegenstand und Adressat
- 252–254 XLIV. Die Geschäftsordnung der Geschäftsführung 252–254
- 254–261 B. Zwischenergebnis 254–261
- 261–289 6. Kapitel Leitfadengestützte Experteninterviews 261–289
- A. Leitfaden als Instrument des teilstandardisierten Interviews
- B. Auswahl der Experten
- C. Auswertung der Experteninterviews
- I. Frage 1: Gestaltungsfreiheit
- II. Frage 2: „Gute“ und „schlechte“ Beiräte
- III. Frage 3: Konfliktfähigkeit des Beirats
- IV. Frage 4: Selbstverständnis eines Beiratsmitglieds
- V. Frage 5: Zustimmungsgeschäfte
- VI. Frage 6: Transparenz
- VII. Frage 7: Professionalisierung
- VIII. Frage 8: Abweichen von Regelungen
- IX. Frage 9: Haftungssituation
- X. Zwischenergebnis
- 289–293 7. Kapitel Schlussbemerkung 289–293
- 293–306 Literaturverzeichnis 293–306