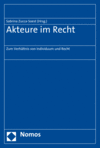Akteure im Recht
Zum Verhältnis von Individuum und Recht
Zusammenfassung
Der Band untersucht die Funktionalität von Recht im Spannungsfeld von Individuen und Institutionen. Recht nimmt als sinnstiftende und handlungsanleitende Institution eine wesentliche Rolle in den gesellschaftlichen Integrations- und Legitimationsprozessen ein. Hier wird untersucht, inwiefern und gestützt auf welche theoretisch einsehbare Fundierung unterschiedliche normative Quellen zu in der Praxis anerkennungswürdigen Handlungsorientierungen und damit zu Stabilität, Integration und Legitimität von politischen Gesellschaftsstrukturen führen können. Vor diesem Hintergrund wird der grundlegenden Frage nachgegangen, ob und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen Recht überhaupt zur Integration pluralistischer Gesellschaften beitragen kann. Die einzelnen Akteure werden dabei als Rechtserzeuger wie auch -adressaten aus unterschiedlichen Perspektiven und in verschiedenen Interaktionsprozessen betrachtet.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–10 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–10
- 11–30 Das alleingelassene Individuum? Eine Kritik des (globalen) Rechtspluralismus – oder weshalb Widerspruchsfreiheit auch für überlappende inter- supra- und nationale Rechtsordnungen wichtig ist 11–30
- I. Einleitung
- II. Radikaler Rechtspluralismus: Normkonflikte seien hinzunehmen
- 1. Der entscheidende Unterschiede: partielle, aktive Völkerrechtssubjektivität von Individuen
- 2. Das alleingelassene Individuum: passive Völkerrechtssubjektivität
- III. Das Streben nach dem Sinn: Widerspruchsfreiheit als Grundvoraussetzung
- 1. Sinnhaftigkeit, Widerspruchsfreiheit und menschliche Kommunikation
- 2. Sinnvolle Widersprüche?
- 3. Grundsätzliche Widerspruchsfreiheit als Voraussetzung für ein Rechtssystem
- IV. Konsequenzen und Aussicht: TREK
- 31–46 Das Recht der Klage oder Individuen als Rechtserzeuger 31–46
- I. Der unklare Status des Klagerechts
- II. Die „Rechtsmacht“ des Subjekts als Mitwirkung an der Normerzeugung
- III. Ein Exkurs: Die passivierende Wirkung der Rechte als Problem
- IV. Zwischen Privatisierung und Politisierung
- V. Ausblick: Politische Neutralisierung durch das Klagerecht?
- 47–64 Die Argumentationsfigur der einzig richtigen Entscheidung und die kollektive Anerkennung richterlicher Urteile 47–64
- I. Wahrheit und Anerkennung richterlicher Urteile
- 1. Die Ausgangsfrage
- 2. Das Teilnehmerargument
- II. Das sprechakttheoretische Instrumentarium
- 1. Begründung und Tenor richterlicher Urteile in sprechakttheoretischer Hinsicht
- 2. Das linguistische Spannungsverhältnis von Tenor und Begründung
- III. Die Argumentationsfigur der einzig richtigen Entscheidung und die Kritikfähigkeit der Justiz
- 1. Die Kritik an der Argumentationsfigur der einzig richtigen Entscheidung
- 2. Das Problem der Kritikfähigkeit der Justiz
- IV. Die Argumentationsfigur der einzig richtigen Entscheidung als rationale Fiktion
- 1. Die Anerkennungsrelativität der sprachlichen Darstellung richterlicher Entscheidungen
- 2. Fiktionalität und Rationalität der Argumentationsfigur der einzig richtigen Entscheidung
- 65–86 Recht – Konflikt – Integration: Rechtsstreitigkeiten um religiöse Symbole und Praxen als unteilbare identitäre Konflikte? 65–86
- I. Integrationsmodelle
- II. Integration und Konflikt
- 1. Integrative Konflikte – eine theoretische Strömung
- 2. Hirschmans teilbare und unteilbare Konflikte
- III. Integration und Recht
- 1. Regulative und konstitutive Funktionen von Recht
- 2. Integration durch Exklusion
- 3. Wirksamkeitsvoraussetzungen und die Rolle der Gerichte
- IV. Beispiele für Identitätskonstruktion und Exklusion in Gerichtsurteilen
- V. Unteilbarkeit identitärer Konflikte?
- 1. Exklusion hier gleich Integration da?
- 2. Wider die Hirschmansche These
- a) Unteilbare individuelle, teilbare kollektive Identität
- b) Anwendung auf die untersuchten Konflikte
- aa) Kompromisse trotz Identitätsbezug
- bb) Umstrittene Erzählungen
- cc) Identität ja, Identitätsrhetorik nein?
- Fazit
- 87–106 Ordnung ohne Herrschaft? Anarchistische Prinzipien als Leitlinien für das Zusammenleben freier IndividuenOrdnung ohne Herrschaft? 87–106
- 1. Einleitung
- 2. Anarchie und Anarchismus
- I. Anarchie als Zustand der Herrschaftslosigkeit
- II. Anarchismus als Theorie und Praxis der Herrschaftslosigkeit
- III. Entwicklung des Anarchismus
- a) Die Anfänge anarchistischer Theorie und Praxis
- b) Der klassische Anarchismus und die anarchistischen Bewegungen
- c) Anarchismus heute
- 3. Anarchistische Prinzipien für ein geordnetes Zusammenleben freier Individuen
- I. Gesellschaftliche Ordnung durch Anarchie?
- II. Vielfalt des Anarchismus
- a) In theoretischer Hinsicht
- b) In praktischer Hinsicht
- c) Vielfalt als Chance
- III. Minimale Prinzipien
- a) Grundprinzip
- b) Prinzip der Gleichwertigkeit
- c) Konsensprinzip
- d) Prinzip der Problematik des Eigentums
- e) Prinzip der gegenseitigen Hilfe und Solidarität
- f) Prinzip der Selbstreflexion
- 4. Kritik
- 107–126 Nudging is Judging: Über die Unvermeidbarkeit von Werturteilen Konsequenzen des Zusammenbruchs der Fakt/Wert-Dichotomie für Behavioural Law and Economics 107–126
- I. Einleitung
- II. Die analytisch/synthetische Dichotomie und die Fakt/Wert-Dichotomie
- 1. Vom Empirismus und Humes Gesetz zum logischen Positivismus
- 2. Der Zusammenbruch der analytisch/synthetisch-Dichotomie nach W. V. O. Quine
- 3. Der Zusammenbruch der Fakt/Wert-Dichotomie nach Hilary Putnam
- 1. Rational Choice und Behavioural Law and Economics sind unvollständig
- 2. Autonomie statt Rationalität?
- 3. Opting-out ein Etikettenschwindel?
- IV. Schlussfolgerungen
- 127–128 Autorenübersicht 127–128