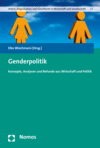Genderpolitik
Konzepte, Analysen und Befunde aus Wirtschaft und Politik
Zusammenfassung
Der Band vermittelt einen Überblick über aktuelle Wissenschaftsdiskurse der Genderpolitik in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Es werden sowohl theoriegeleitete Analysen und empirische Befunde als auch Konzepte und Lösungsansätze für mehr Geschlechtergerechtigkeit vorgestellt.
Ziel des Lehrbuches ist es, Ergebnisse der Geschlechterforschung aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen zu präsentieren, um zu zeigen, wie vergleichbare Ungleichheitsmuster in Strukturen, Normen und Gesetzen wirken. Darüber hinaus zeigen sich Fortschritte, Persistenz aber auch Neukonfigurationen der Geschlechterverhältnisse in Organisationen und Institutionen. Das Werk richtet sich an Studierende ebenso wie an die Fachpraxis und die Wissenschaft.
Mit Beiträgen von:
Jana Belschner, Caroline Friedhoff, Nina Hossain, Maria Funder, Gertraude Krell, Renée Parlar, Edeltraud Ranftl, Daniela Rastetter, Birgit Riegraf, Friedel Schreyögg, Barbara Stieg-ler, Kristina Walden, Elke Wiechmann
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–22 Einleitung: Kontext, Begriffe und Zielsetzung – eine genderpolitische Einführung 9–22
- 9–13 Eine wissenschaftliche Verortung der Frauen- und Geschlechterforschung 9–13
- 14–22 Aufbau des Lehrbuchs 14–22
- 23–126 I Genderpolitik in der Wirtschaft 23–126
- 23–48 Arbeits- und Geschlechterpolitik – Zur Wirkungsmacht der „(Gender)Relations of (Re)Production“ 23–48
- Einleitung
- 1 Arbeitspolitik: Begriff, Konzepte und die Ausblendung von Genderdimensionen
- 2 Arbeitspolitik aus einer Genderperspektive: Zur Relevanz eines erweiterten arbeits- und geschlechterpolitischen Konzepts – „Gender Politics of (Re)Production“
- 3 Arbeits- und Geschlechterpolitik: „(Gender)Politics of (Re)Production“
- 3.1 „(Gender)Relations in Production“ – Die neue Leistungspolitik und ihre Folgen
- 3.2 „(Gender)Relations of (Re)Production“ – Zur Wirkungsmacht asymmetrischer Branchenkonfigurationen und vorherrschender Geschlechterarrangements
- 3.2.1 Die Geschlechterwirksamkeit asymmetrischer Branchenkonfigurationen
- 3.2.2 Geschlechterarrangements und ihre Wirkungsmacht auf die Vereinbarkeitspolitik
- Das Beispiel der Vereinbarkeitspolitik
- 4 Fazit: Grenzen und Spielräume für Gleichstellungspolitik
- 49–78 Führung und Geschlecht aus mikropolitischer Perspektive 49–78
- 1 Einleitung
- 2 Mikropolitik: der Aufbau von Macht
- 3 Mikropolitik: zwei Perspektiven
- 4 Führung: eine mikropolitische Arena
- 5 Führungsstereotype: „think manager think male“
- 6 Weiblichkeit als neues Machtmittel?
- 7 Mikropolitisches Kompetenzmodell
- Sachkompetenz oder ‚Was muss ich über Mikropolitik wissen?
- Aktivitätskompetenz oder ‚Was kann ich konkret tun?‘
- Soziale Kompetenz oder ‚Mit welcher Situation, welchen Regeln und Normen, welchen Personen habe ich zu tun‘?
- Selbstkompetenz oder ‚Was bin ich bereit zu tun?‘
- 8 Mikropolitische Handlungsfelder
- 8.1 Selbstdarstellung: zwiespältige Anforderung
- 8.2 Vereinbarkeit von Karriere und Familie/Work-Life-Balance
- 8.3 Netzwerke und Koalitionen
- 8.4 Körper und Sexualität
- 8.5 Emotionen und Emotionsausdruck
- 8.6 Unternehmenskultur
- 8.7 Verhältnis zu Macht
- 9 Fazit
- 79–106 Entgeltpolitik aus einer Gender Perspektive 79–106
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeines zu Systemen Industrieller Beziehungen – Akteur_innen der Entgeltpolitik
- 3 Der Gender Pay Gap und die Suche nach Erklärungen
- Exkurs Mindestlohn und Niedriglohn
- Ursachen für niedrige und ungleiche Entlohnung
- 4 Zum Grundsatz der Entgeltgleichheit
- 5 Feststellen von Gleichwertigkeit
- Einfallstore für Diskriminierung
- 6 Gleichstellungs- und Entgeltgleichheitspolitik der Organisationen der Sozialpartner
- 7 Perspektiven für Schlüsselakteur_innen – proaktive Maßnahmen
- Staat und Regierungen
- 8 Fazit: Abschließende Bemerkungen
- 107–126 Arbeitszeit- und Vereinbarkeitspolitik – mehr Talk als Action? 107–126
- 1 Einleitung
- 2 Arbeitszeit und Vereinbarkeit – Kernfelder von Genderpolitik
- 3 Talk, Decision und Action – eine neo-institutionalistische Perspektive auf Genderpolitik in Wirtschaftsorganisationen
- 4 Mehr Talk als Action? Arbeitszeit und Vereinbarkeit in einem Wirtschaftsunternehmen aus der Perspektive des Neo-Institutionalismus
- 4.1 Arbeitszeit: „Vollzeit PLUS“
- 4.2 Vereinbarkeit – „kein Problem“: Ein Blick hinter die Fassade
- 5 Fazit: Mehr Talk als Action?
- 127–240 II Genderpolitik – Staat und Politik 127–240
- 127–158 Die Modernisierung des Staates und der Wandel der Geschlechterverhältnisse 127–158
- Einleitung
- 1 Der Wandel von Wohlfahrtsstaaten und das 'New Public Management'
- 2 Instrumente und Zielsetzung des New Public Management
- Das 'New Public Management' zielt zusammenfassend in vier Richtungen:
- 3 Gerechtigkeitskonzeptionen im Wandel
- 4 Bezugstheorien des New Public Management
- 5 Grenzen der Ökonomisierung des öffentlichen Sektors
- 6 Modernisierung des Staates und neue Ungleichheiten nach Geschlecht, Ethnie und Schicht
- 7 Fazit: Ein Ausblick
- 159–186 Kommunalpolitische Führung: Bürgermeister_innen im Fokus 159–186
- 1 Einleitung
- 2 Theorien zur politischen Repräsentanz der Geschlechter
- 2.1 Politikwissenschaftliche Genderforschung und kommunalpolitische Führungsforschung
- 2.2 Integrierende und gewichtende Ansätze
- 3 Bürgermeister_innen im Fokus: Forschungsergebnisse
- 3.1 Kommunale Kontextfaktoren der Geschlechterrepräsentanz
- a) Gemeindegröße
- b) Wahlrecht
- c) Parteienwettbewerb und -system
- 3.2 Akteurspezifische Einflüsse
- a) Kandidat_innen-Pool
- b) Die Rolle der Parteien
- c) Wähler_innen-Verhalten
- 4 Fazit: Ein Forschungsausblick
- 187–214 Frauen in der Politik – eine Standortbestimmung 187–214
- 1 Einleitung
- 2 Ausgangshypothese
- 3 Erklärungsmodell für die politische Unterrepräsentanz von Frauen
- 4 Frauenrepräsentanz auf Bundesebene
- 5 Frauenrepräsentanz auf Länderebene
- 6 Frauenrepräsentanz auf kommunaler Ebene
- 6.1 Frauenrepräsentanz in den Rathäusern
- 6.2 Genderranking deutscher Großstädte
- 7 Die Quote
- 8 Das Wahlrecht
- 8.1 Parteien und Nominierungsprozesse
- 8.2 Rolle der Ortsvereine
- 9 Fazit: Wege aus der Unterrepräsentanz von Frauen in den Kommunalparlamenten
- 215–240 Partizipation, Migration und Geschlecht – Zur politischen Partizipation von Frauen mit Migrationshintergrund 215–240
- 1. Einleitung
- 2. Politik und Intersektionlität – Forschungsstand und theoretische Anknüpfungspunkte
- 3. Empirische Ergebnisse zur Unterrepräsentanz von Frauen mit Migrationshintergrund in der Kommunalpolitik
- 3.1 „Ich bin nicht die Vorzeigemigrantin, ich mache Politik für jeden“ – Zur deskriptiven und substanziellen Repräsentanz von Migrantinnen
- Deskriptive Repräsentanz von Frauen mit Migrationshintergrund
- Substanzielle Repräsentanz von Frauen mit Migrationshintergrund
- 3.2 Politik und Heteronormativität – Erklärungsansätze für die Unterrepräsentanz von Frauen mit Migrationshintergrund
- Lineares Regressionsmodell zur Erklärung der Repräsentanz von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund
- Die Sichtweise der Akteur_innen: Steinige Wege in die Politik
- 3.3 „Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ – Die Kategorien Geschlecht und Migrationshintergrund in Personalunion
- 4. Fazit
- 241–330 III Reformkonzepte 241–330
- 241–274 Gender Mainstreaming 241–274
- 1 Einleitung
- 2 Herkunft
- 3 Rechtliche und programmatische Grundlagen
- 3.1 Europäische Ebene
- 3.2 Nationale Ebene: Deutschland
- 4. Das Herzstück: die Genderanalyse
- 4.1 Implementationsvoraussetzungen für Verwaltungen und Organisationen
- 4.2 Die Genderanalyse
- 4.2.1 Klärung des Genderbegriffs
- 4.2.2 Formulierung der geschlechterpolitischen Zielsetzungen
- 4.2.3 Sammlung geschlechtersensibler Befunde
- 4.2.4 Formulierung geschlechtersensibler Problemstellungen, vorläufige Schlussfolgerungen und geschlechterpolitische Optionen
- 5 Die Umsetzung von Gender Mainstreaming
- 5.1 Anwendungsfelder
- 5.2 Der Prozess der Einführung
- 5.3 Erfahrungen und Umsetzungsstand in Deutschland
- 6 Verhältnis zu anderen geschlechterpolitischen Strategien und Institutionen
- 6.1 Gender Mainstreaming und Antidiskriminierungspolitik
- 6.2 Gender Mainstreaming und Frauenförderung
- 6.2.1 Position der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- 6.2.2 Frauenförderung als Teil des Gender-Mainstreaming-Prozesses in der Personalentwicklung
- 6.3 Gender Mainstreaming und Diversity
- 7 Zur Kritik an Gender Mainstreaming
- 275–304 Gender Budgeting 275–304
- 1 Einleitung
- 2 Historische Entwicklung
- 3 Gender Mainstreaming und Gender Budgeting
- 4 In welchen Organisationen kann Gender Budgeting umgesetzt werden?
- Betriebe im öffentlichen Eigentum
- Freie Träger der Wohlfahrtspflege
- Parafisici
- 5 Gestaltungsmöglichkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden
- Verpflichtende und freiwillige Aufgaben sowie übertragener Wirkungskreis
- 6 Haushaltstypen – Kameralistik – Doppik
- 7 Methoden
- Die Geschlechterdifferenzierte Nutzenanalyse
- Der zielgruppenorientierte Ansatz
- 8 Handlungsansätze und Praxisbeispiele für Gender Budgeting
- 8.1 Bundesebene
- 8.2 Länderebene
- Land Berlin (Gesamtstadt und Bezirke)
- 8.3 Kommunen
- Landeshauptstadt München:
- Stadt Freiburg
- 9 Ein Blick über die Landesgrenzen – Österreich und die Schweiz
- 9.1 Österreich
- Bundesebene
- Stadt Wien (Stadtstaat)
- 9.2 Schweiz
- Kanton Basel-Stadt
- 10 Fazit: Ein Ausblick
- 305–330 Diversity-Konzepte 305–330
- 1 Einleitung: Diversity als Gegenstand und Produkt von Deutungskämpfen
- 2 Ein Rückblick auf Pionierarbeiten in den USA
- 3 Gestaltung von Diversity-Konzepten: Grundfragen, Grundlagen, Varianten
- 3.1 Gesetzliche Grundlagen
- 3.2 Handlungsfelder
- 3.3 Maßnahmen
- 3.4 Dimensionen von Vielfalt
- 3.5 Kombinationen schon vorhandener gleichstellungspolitischer Konzepte
- 3.6 Namensgebung
- 3.7 Initiator_innen und Mitwirkende
- 4 Fazit: Eine Schlussbemerkung
- 331–332 Autorinnenverzeichnis 331–332
- 333–338 Register 333–338