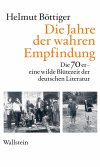Die Jahre der wahren Empfindung
Die 70er - eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur
Zusammenfassung
Die Literaturgeschichte der 70er Jahre, faszinierend und facettenreich als Zeit- und Gesellschaftsgeschichte erzählt.
Helmut Böttiger zeichnet ein differenziertes, bunt schillerndes Bild der politischen, kulturellen und literarischen Prozesse dieses Jahrzehnts zwischen Aufbruch und Desillusionierung. Mit Peter Schneiders Erzählung »Lenz« diagnostiziert Helmut Böttiger der Literatur am Beginn der siebziger Jahre eine »plötzliche Verunsicherung«. Er spürt ihren Wurzeln und Konsequenzen in den Werken der wichtigen Autorinnen und Autoren nach.
Hermann Peter Piwitt, Bernward Vesper, Christoph Meckel stehen ihm für die Auseinandersetzungen mit den Nazi-Vätern. Ein anderes Kapitel widmet sich einem neuen Ton, den Autorinnen wie Karin Struck und Verena Stefan in die Literatur gebracht haben. An Nicolas Born und Rolf Dieter Brinkmann erkennt er symptomatische Sprechweisen in der Lyrik dieser Jahre.
In einzelnen Kapiteln setzt Böttiger sich mit literaturhistorischen Zusammenhängen, den individuellen Korrespondenzen und Unterschieden einzelner Werke auseinander, sie sind gewidmet: Ingeborg Bachmann, Peter Handke, Wolf Biermann, Franz Fühmann, Christa Wolf, Fritz Rudolf Fries, Peter Weiss, Manfred Esser, Guntram Vesper, Peter Rühmkorf, Thomas Bernhard, Uwe Johnson, Arno Schmidt, Wilhelm Genazino, Eckhard Henscheid und Jörg Fauser sowie den Nobelpreisträgern Heinrich Böll und Günter Grass. Ein Kapitel widmet sich den neu entstandenen (und oft bald eingegangenen) Alternativzeitschriften, Verlagen und Buchhandlungen, ein anderes speziell dem Wagenbach-Rotbuch-Komplex.
Schlagworte
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–16 Vorspiel. Uwe Johnson, die Kommune 1 und das Puddingattentat 9–16
- 17–27 Das Manifest der plötzlichen Verunsicherung. Peter Schneiders Erzählung »Lenz« 17–27
- 28–44 Ein Aspirin von der Größe der Sonne. Von »Sprachlos« bis »Der Metzger«: Alternative Zeitschriften, Verlage, Buchhandlungen und Dichter 28–44
- 45–58 Klassenliebe. Frauen beginnen sich zu wehren 45–58
- 59–78 Die Phrasen zerschreiben. Ingeborg Bachmanns verzweifelte Apotheose der Kunst: »Malina« 59–78
- 79–109 Leben ohne Poesie. Peter Handke, die Einsamkeit und das Glück 79–109
- 110–135 Die Krümmung dieser Jahre. Nicolas Born, Jürgen Theobaldy und die schöne Unruhe in Westberlin 110–135
- 136–152 Einer jener schwarzen Tangos. Mit der Schreibmaschine wie auf einer Gitarre spielen: Rolf Dieter Brinkmann justiert die Wahrnehmung 136–152
- 153–179 Die Narben sind die alten. Hermann Peter Piwitt, Bernward Vesper, Christoph Meckel: die Auseinandersetzung mit den Nazivätern 153–179
- 180–197 Wenn wir, bei Rot! Klaus Wagenbach, Friedrich Christian Delius und linke Verwerfungen 180–197
- 198–206 Die Gitarre hat immer recht. Der große Tag im Leben von Wolf Biermann 198–206
- 207–223 »Was für NICHT DRUCKBARE Stimmungen!« Volker Braun und Franz Fühmann bewegen sich in Zwischenzeiten 207–223
- 224–237 Wortverfilzung. Christa Wolfs »Sommerstück«: eine Bestandsaufnahme des Jahres 1975 224–237
- 238–250 Die Schwärze Hamlets. Zigarre und Whiskey: Heiner Müller hat alles schon früh gewusst 238–250
- 251–269 Rausch im Niemandsland. Fritz Rudolf Fries, die größte Überraschung der DDR 251–269
- 270–285 Das herausgemeißelte Jahrhundertwerk. Peter Weiss und seine Ästhetik des Widerstands 270–285
- 286–295 Kommunistische Cluster. Manfred Esser und sein postmodern-linker »Ostend-Roman« 286–295
- 296–304 Autobahnkreuze, Betonfertigteile und dazwischen das Ich. Guntram Vespers psychische Geographie: »Nördlich der Liebe und südlich des Hasses« 296–304
- 305–320 Lackstoffe. Lackleder. Pumpsketten. »Das Kaputtgehämmerte durch Sexualität«: Hubert Fichte öffnet eine neue Palette 305–320
- 321–338 Irdisches Vergnügen. Ein kleiner Betriebsausflug mit Peter Rühmkorf, Marcel Reich-Ranicki und Martin Walser 321–338
- 339–348 Literatur als größtmögliche Unzucht. Thomas Bernhard spornt mit seinen artistischen Suaden auch den Verleger Siegfried Unseld zu Höchstleistungen an 339–348
- 349–362 Jung, reich und unglücklich. Die Goldküste in Zürich und andere Abgründe der Schweiz 349–362
- 363–380 Der epische Atem der Gezeiten. Uwe Johnsons epochales Werk: »Jahrestage« 363–380
- 381–403 Madonnen, Glumse und ein Hauch von Ewigkeit. Heinrich Böll und Günter Grass, die bundesdeutschen Nobelpreisträger 381–403
- 404–414 Das Unbewusste und sein Schalks-Esperanto. Spaltentechnik mit »Unterleibswitzn«: Arno Schmidts ominöses Hauptwerk »Zettel’s Traum« 404–414
- 415–429 Der »Geschlechterverkehr« in der Revolte. Abgrund und Hochkomik mit Wilhelm Genazino und Eckhard Henscheid 415–429
- 430–442 Die B-Ebenen der Subkultur. Jörg Fauser und der Übergang zu den achtziger Jahren 430–442
- 443–460 Auswahlbibliographie 443–460
- 461–464 Bildnachweis 461–464
- 465–472 Personenregister 465–472
- 473–473 Dank 473–473